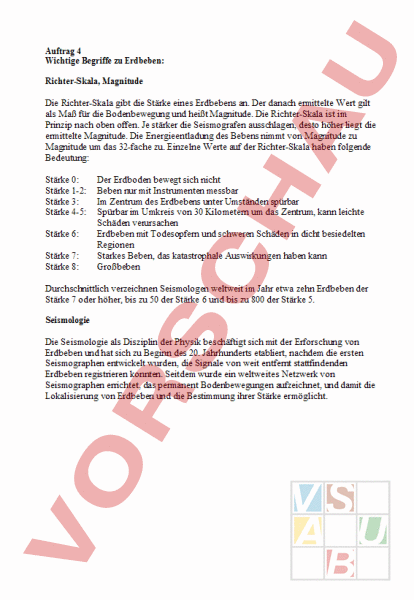Arbeitsblatt: erdbeben
Material-Details
unterrichtsmaterial zum thema erdbeben,
vorhersage
wichtige begriffe zu erdbeben
stärke erdbeben
folgen erdbeben
erdbeben in der schweiz
Geographie
Geologie / Tektonik / Vulkanismus
8. Schuljahr
6 Seiten
Statistik
10871
2456
109
19.10.2007
Autor/in
adriana esposito
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
10 Erdbeben in der CH Exemplarisch. Historisches Beispiel 1 8 Vorbeugung und Konsequenzen Auswirkung für Mensch 2 Katastrophenkarte: Risikogebiete Erdbeben Wichtige Begriffe: Magnitude, .Messinstrumente: Seismograph, Richterskala 5 Plattentektonik 4 6 Ursachen: Warum die Erde bebt 3 7 Vorhersage Nutzen von Erdbeben (Wissenschaft, Ressourcen) 9 Auftrag 4 Wichtige Begriffe zu Erdbeben: Richter-Skala, Magnitude Die Richter-Skala gibt die Stärke eines Erdbebens an. Der danach ermittelte Wert gilt als Maß für die Bodenbewegung und heißt Magnitude. Die Richter-Skala ist im Prinzip nach oben offen. Je stärker die Seismografen ausschlagen, desto höher liegt die ermittelte Magnitude. Die Energieentladung des Bebens nimmt von Magnitude zu Magnitude um das 32-fache zu. Einzelne Werte auf der Richter-Skala haben folgende Bedeutung: Stärke 0: Stärke 1-2: Stärke 3: Stärke 4-5: Stärke 6: Stärke 7: Stärke 8: Der Erdboden bewegt sich nicht Beben nur mit Instrumenten messbar Im Zentrum des Erdbebens unter Umständen spürbar Spürbar im Umkreis von 30 Kilometern um das Zentrum, kann leichte Schäden verursachen Erdbeben mit Todesopfern und schweren Schäden in dicht besiedelten Regionen Starkes Beben, das katastrophale Auswirkungen haben kann Großbeben Durchschnittlich verzeichnen Seismologen weltweit im Jahr etwa zehn Erdbeben der Stärke 7 oder höher, bis zu 50 der Stärke 6 und bis zu 800 der Stärke 5. Seismologie Die Seismologie als Disziplin der Physik beschäftigt sich mit der Erforschung von Erdbeben und hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts etabliert, nachdem die ersten Seismographen entwickelt wurden, die Signale von weit entfernt stattfindenden Erdbeben registrieren konnten. Seitdem wurde ein weltweites Netzwerk von Seismographen errichtet, das permanent Bodenbewegungen aufzeichnet, und damit die Lokalisierung von Erdbeben und die Bestimmung ihrer Stärke ermöglicht. Auftrag 4: 1. Kann man Erdbeben vorhersagen? Was ist eine Erdbebenvorhersage? Eine Erdbebenvorhersage, welche wissenschaftlich abgesichert ist, müsste eindeutige Antworten auf folgende Fragen haben: • Wann genau wird das Erdbeben eintreten? • Wo wird das Erdbeben eintreten? • Wie stark wird es sein? • Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt es ein? • Warum wird die Vorhersage gemacht, aufgrund welcher Erkenntnisse? Wissenschaftler haben beobachtet, dass vor einem Erdbeben verschiedene Phänomene in der Natur eintreten. Diese Phänomene nennt man «VorläuferPhänomene», und sind zum Beispiel: • Vorbeben • Kurzfristiges ausbleiben von schwächeren Erdbeben • Grosse Veränderung des Felsuntergrundes, welche mit Messgeräten in Höhlen oder Minen gemessen werden • Schwankung des Grundwasserspiegels in Brunnen und Bohrlöcher • Änderung der Temperatur und der chemischen Zusammensetzung des Grundwassers • Abnormales Verhalten von Tieren vor Erdbeben • Änderung im Erdmagnetfeld Damit ein Vorläufer-Phänomen für die Wissenschaft nützlich ist, muss es folgende Bedingungen erfüllen: • Es muss zuverlässig vor jedem Erdbeben eintreten • Man muss es nachweisen können • Man muss es richtig deuten können Leider hat man bis heute noch keine Vorläufer-Phänomene festhalten können, die Garantie dafür geben, dass ein Erdbeben entsteht, wie stark es ist und wann es stattfindet. Oft gab es auch Beben, die von keinem Vorläufer-Phänomen angekündigt wurden. Leider ist es der Wissenschaft bis heute nicht gelungen zuverlässige ErdbebenVorhersagen (bzw. Methoden für eine Vorhersage) zu machen. Das Risiko eines Fehlalarms und deren Folgen wären verheerend Auftrag 4: 2. Kann man Erdbeben vorhersagen? Zuverlässigkeit ist gefragt Eine erfolgreiche Erdbebenvorhersage erfolgte im Zusammenhang mit dem Haicheng-Beben in China 1975, als die Bevölkerung am Tag vor dem Beben aufgerufen wurde, die Häuser zu verlassen. In den Monaten zuvor hat man beobachtet, dass sich der Grundwasserspiegel wie auch die Landschaftsform veränderte hatte. Tiere hatten sich seltsam verhalten und man stellte kleine Vorbeben fest. Als die Vorbeben-Aktivität anstieg, schlug man Alarm und evakuierte die Leute. Leider haben die meisten Erdbeben keine so präzisen Vorzeichen sondern treten plötzlich und mit verheerenden Folgen auf. Es ist jedoch wichtig eine zuverlässige Vorhersagemethode zu kennen, denn ein Fehlalarm kann kostspielig werden: • Tausende von Menschen würden ihre Häuser verlassen und in Zeltlagern übernachten • Fabriken und Kraftwerke würden nur noch reduziert arbeiten können oder abgestellt werden • Eisenbahnen würden unter Umständen mit reduzierter Geschwindigkeit fahren müssen So haben Fehlprognosen Konsequenzen, wie zum Beispiel: • Wer zahlt die Betriebsausfälle der Fabriken, wenn das Beben nicht eintritt? • Wird die Bevölkerung, die bei einem ersten Fehlalarm ihre Häuser evakuiert hat um im Notstand in Zelten zu leben, bei einer zweiten Vorhersage dasselbe tun, bzw. die Vorhersage ernst nehmen? Daher muss man sich bewusst sein, dass eine falsche Erdbebenvorhersage unter Umständen sehr kostspielig sein kann und zu einem Rückschlag der Wirtschaft des betroffenen Gebiets und dessen Bewohner führen. Auch hat ein Fehlalarm die Konsequenz, dass die Bevölkerung misstrauisch wird und bei einem weiteren Aufruf nicht mehr reagiert. Immerhin ist der moderne Erdbebendienst schon so weit, dass er gute Angaben zur Erdbebengefährdung machen kann. Im Gegensatz zur Vorhersage, gibt die Erdbebengefährdung an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Erdbeben einer gewissen Stärke in einem gewissen Gebiet innerhalb eines größeren Zeitrums auftreten wird. So wird die betroffene Bevölkerung sensibilisiert. Auch kann man Vorkehrungen treffen, wie zum Beispiel erdbebensicherer Häuserbau etc Die moderne Kommunikationstechnologie hat es möglich gemacht, dass seismische Stationen innerhalb von Sekunden Aufzeichnungen von Erdbebenwellen an die Zentrale liefern können. Voraussetzung ist, dass sich diese Stationen möglichst nah am Erdbebenzentrum befinden. So kann man die gefährdeten Gebiete räumen, bevor sie die Erdbebenwelle erreicht. Moderne Technologie ermöglicht, dass Schnellzüge innerhalb von Sekunden zum stehen kommen, Gasleitungen sich automatisch schliessen und die Rechenzentren ihre Daten sichern, so dass beim Eintreten der Erdbebenwelle, der möglichst kleine Schaden entsteht. Aufträge zu Erdbeben Auftrag 4: Kann man Erdbeben vorhersagen? 1. Lies den Text sorgfältig durch und beantworte die Fragen schriftlich (in Stichworten). 2. Setz dich mit deinem Banknachbarn zusammen und tausche mit ihm die Erkenntnisse aus. Die bearbeiteten Fragen dienen dir, die wichtigsten Punkte im Text zusammenzufassen. Fragen zu Text 1: Kann man Erdbeben vorhersagen? 1. Welche 5 Punkte muss man beachten, um ein Erdbeben vorhersagen zu können? 2. Was versteht man unter Vorläufer-Phänomene? Welche gibt es? 3. Welche Bedingungen muss ein Vorläufer-Phänomen aufweisen um ein Erdbeben zuverlässig vorhersagen zu können? Welche Probleme tauchen dabei auf? 4. Kann man Erdbeben mit Sicherheit vorhersagen? Warum? Fragen zu Text 2: Zuverlässigkeit ist gefragt 1. Was passierte beim Haicheng-Beben in China 1975? 2. Warum ist es wichtig, dass die Erdbebenvorhersage zuverlässig sind, welche Konsequenzen könnte eine Falsch-Vorhersage haben? 3. Was ist der Unterschied zwischen Erdbeben-Vorhersage und Erdbebengefährdung? 4. Inwiefern kann der Erdbebendienst bereits vorsorgend handeln? An welche Infos und hält er sich und welche modernen Kommunikationstechnologien präzisieren/unterstützen seine Arbeit? Auftrag 5: Die Stärke eines Erdbebens Lies den Text sorgfältig durch und fülle den zugehörigen Lückentext aus. Auftrag 6: Folgen der Erdbeben Lies die Verschiedenen Zeitungsmeldungen. Ordne die Nummern der Texte den unten aufgelisteten Begriffen richtig zu. Auftrag 7: Erdbeben in der Schweiz 1. Erdbebengefährdung- auch in der Schweiz: Mit den Infos aus dem Text, versuche zu begründen warum die Schweiz erdbebengefährdet ist? (Gib mindestens zwei mögliche Begründungen) 2. Erdbebenaktive Gebiete in der Schweiz: Zeichne mit zwei verschieden Farben die erdbebengefährdeten bzw. die erdbebensicheren Gebiete der Schweiz ein. 3. Die Bewältigung einer Erdbeben-Katastrophe in der Schweiz: A: Verbinde die zu den verschiedenen Organisationen gehörenden Tätigkeiten B: Such die versteckten Begriffe aus dem Buchstabengitter, die mit der Katastrophenbewältigung zu tun haben. Die begriffe stehen senkrecht, waagrecht, rückwärts vorwärts und diagonal im Buchstabengitter. Auftrag 5: Die Stärke eines Erdbebens Bei einem Erdbeben entstehen Stoßwellen – auch seismische Wellen genannt – die sich in der Erde und an der Erdoberfläche ausbreiten. Am stärksten sind diese Wellen in der Nähe des Erdbebenzentrums (Hypozentrum) und werden schwächer, je weiter sie sich davon entfernen. In der Erde breiten sich die meisten dieser seismischen Wellen mit 20facher Schallgeschwindigkeit aus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Methoden die Stärke eines Erdbebens zu bestimmen. Mit hochempfindlichen Messgeräten, den Seismographen genannt, können die Erdbebenwellen gemessen und aufgezeichnet werden. Diese Messgeräte sind in der Lage, Erdbebenherde aufzuzeichnen, die mehrere tausend Kilometer entfernt sind. Die unterschiedlichen Kurven, die ein Seismograph aufzeichnet, heißen in der Fachsprache Seismogramme. Sie geben den Wissenschaftlern Aufschluss über die Stärke und die Lage eines Erdbebens. Die Stärke der jeweiligen Erschütterungen wird nach der Richter-Skala angegeben. Diese Skala wurde im Jahre 1935 von dem amerikanischen Wissenschaftler und Seismologen Charles Francis Richter (Seismologie ist die Wissenschaft, die sich mit Erdbeben befasst) entwickelt und aufgestellt. Diese Skala reicht von 0 bis 12 und jede Zahl bezeichnet eine Bebenstärke, die zehnmal so hoch ist wie bei der nächstniedrigen Zahl. Die bislang höchsten gemessenen Werte lagen zwischen acht und neun auf der Richter-Skala. Dabei macht die Stärke eines Bebens nicht zwangsläufig auch Aussagen über die Folgen der Zerstörung. Je nach der Art des Bodens, hat ein Erdbeben unterschiedlich schwere Folgen. Wenn das Fundament eines Gebäudes auf eher weichem Boden steht, ist die Gefahr, dass es einstürzt wesentlich größer, als wenn es auf einem harten und festen Untergrund errichtet ist. Mit der Richter-Skala lässt sich nämlich nur die Stärke des Erdbebens beschreiben, nicht aber seine zerstörende Wirkung. So kann ein Erdbeben der Stärke 7 in unbewohnten Gebieten kaum Zerstörungen hervorrufen, während ein zehnfach schwächeres Beben der Stärke 6 unmittelbar unter einer Großstadt zu schwersten Zerstörungen führt. Daher verwenden Seismologen für die Stärke eines Erdbebens, als Ausdruck seiner zerstörerischen Auswirkungen, die abgewandelte Mercalli-Skala. Die Werte dieser Skala reichen von 1 bis 12 und beruhen auf statistisch ausgewerteten Geländebeobachtungen. Eine Stärke von 1 bedeutet, dass die Erschütterungen nicht bemerkbar sind und nur von Seismographen registriert worden sind. Eine Stärke von 12 bedeutet völlige Zerstörung. 1. Das Zentrum des Erdbebens nennt man 2. Der Seismograph ist ein der die misst. Er muss sich dabei nicht in Nähe vom Erdbeben befinden, sondern kann die Messungen über entfernt bestimmen. 3. Die Aufzeichnungen des Seismographen heissen. Sie beschreiben die und die eines Bebens. 4. Die ist eine Tabelle, welche die Stärke des Erdbebens beschreibt. Die Stärken variieren von (niedrig) bis (totale Zerstörung). 5. Die Folgen der Zerstörung eines Bebens hängen nicht nur von der Stärke des Bebens ab sondern vor allem vom auf dem es sich abspielt: So ist die Gefahr der Zerstörung für ein Haus auf Boden grösser, als wenn es auf Boden gebaut ist. 6. Da die Richter-Skala nur die aber nicht die eines Bebens beschreibt, haben die (Wissenschaftler die sich mit Erdbeben beschäftigen) eine andere Messtabelle kreiert, die . Sie beschreibt die effektive die ein Beben verursacht. Auftrag 6: Folgen von Erdbeben: Lies die Zeitungsausschnitte und ordne sie den verschiedenen Folgen-Bereichen zu Auftrag 6: Folgen von Erdbeben 9. 1. Mexiko, 1999 1800 Km Fernstrasse sind wegen eingestürzter Brücken, umgestürzter Bäume, Erdrutschen oder Rissen in der Fahrbahndecke nicht befahrbar. 3. 7. Afghanistan, 1998 .zahllose Opfer mit Brandwunden als Folge von öffentlichen Bränden. 2. 4. Indien, 1999 Auch gestern gab es immer noch kein Wasser in Chamoli. der Wassertank war geborstet, Leitungen gebrochen. 5. Türkei, 1999 An die Stelle der üblichen Regierung, traten zahlreiche Nichtregierungsorganisationen auf 13. Türkei, 1999.Traf das wirtschaftliche Herz des Landesdie Hälfte der türkischen Industrie liegt dort.der Wiederaufbau beläuft sich auf 25Mia. Dollar. Folgen Erdbeben Türkei, 1999 .Spenden über 6.5Mio Fr. gesammelt. M.Y war bereits im Spital und hofft jetzt auf gute Nachrichten von seiner Familie. «Sagen Sie mir, dass meine Kinder noch leben», fleht er verzweifelt den Reporter an. 15. Italien, 1997.letzten August hatten wir den Laden eröffnet, nun ist alles zerstört.bleiben nur Schulden: Hypothekarzinsen für die nächsten 9 Jahre! 10. Kolumbien, 1999 .Nahrungsmittel und Güter zu Wucherpreisen verkauft. 6. Kolumbien, 1999 In der Strasse patrouillieren schwerbewaffnete Soldaten. Sie errichten Absperrungen, um Plünderungen zu verhindern. 8. Indonesien, 1998 Gewaltige, rund 10m hohe Wellen haben an der Küste PapaNeuguinea 1000 von Menschen in den Tod gerissen 11.Türkei, 1999.Viele Betroffene sagen, sie können sich an die 12. Einzelheiten des Bebens nicht mehr erinnern,.Sie hätten das Interesse an wichtigen Dingen im 14 Italien, 1997.der Leben verloren, leiden Tourismus im unter Schlaflosigkeit, Oktober brachte Aggresionen.Die einen Ausfall von psychiatrischen 90%. Abteilungen der Kliniken können sind voll. Wirtschaftliche Probleme Island, 2000 Für eine Stunde ausser Funktion war auch das im dünn besiedelten Island besonders wichtige Netz für Mobiltelefone. Sumatra, 2000.Die grösste Seuchengefahr für die Überlebenden geht vom zerstörten Trink- und Abwassersystem aus.Spitäler wurden evakuiert. der sein: Versorgungs/Entsorgungsprobleme Soziale Auswirkungen, Armut Psychische Auswirkungen Chaos Beeinträchtigung Tourismus Kommunikationseinrichtungen Flutwellen Gewinnsucht Brände Instabile Politik Zerstörte Verkehrsverbindungen Krankheiten Menschen verlieren/sterben Solidarität, Hilfe Auftrag 7: Erdbeben in der Schweiz 1. Erdbebengefährdung- auch in der Schweiz! Im 20 Jh. hat das Erdbebenrisiko weltweit stark zugenommen obwohl sich die Erdbebengefährdung nicht wesentlich verändert hat. Dies hat verschiedene Gründe: Die Weltbevölkerung hat im letzten Jahrhundert stark zugenommen, so dass auch in erdbebengefährdeten Gebieten immer mehr Menschen leben. Durch die Zunahme der globalen Bevölkerung ist der Lebensraum knapper geworden: Industrie wie auch Wohngebiete werden dichter besiedelt, Häuser reihen sich eins nach dem anderen und Hochhäuser sind immer mehr im Trend, da sie Platz sparen. Bei einem Erdbeben ist das Ausmass an Schäden in einem Gebiet dementsprechend grösser, je mehr Leute darin leben. Der Mensch ist von der modernen Infrastruktur wie Verkehrsverbindungen, Versorgungssysteme, Computer und Telekommunikation abhängig. Bei Schäden an diesen sind auch Menschen betroffen, die nicht unmittelbar in der Erdbebenzone leben. 2. Die erdbebenaktiven Gebiete in der Schweiz In der Schweiz lassen sich Regionen abgrenzen, welche gegenüber ihrer Umgebung eine auffallend höhere Erdbebenaktivität aufweisen. Diese Gebiete sind ungleichmässig über die ganze Schweiz verteilt und sind nicht immer gleich aktiv. Gebiete mit erhöhter Erdbebengefahr sind: • Region Basel, Wallis (insbesondere Mittel- und Oberwallis), Zentralschweiz, St. Galler Rheintal, Mittelbünden, Engadin Gebiete, die als «erdbebenruhig» gelten sind: • Zentrale Nordschweiz (mit Ausnahme von der Region Basel), Westschweiz, Tessin 3. Die Bewältigung einer Erdbeben-Katastrophe in der Schweiz Bei einem Erdbeben in der Schweiz sind die betroffenen Kantone verpflichtet Hilfe zu leisten. Darum sind Einsatzdienste wie zum Beispiel Polizei, Feuerwehr kantonal organisiert. Der Bund gibt nur in Spezialfällen Hilfestellung, wie zum Beispiel bei Epidemien, Tierseuchen, Bruch von Talsperren, Radioaktivität oder Satellitenabstürze, da solche Katastrophen Schäden im weiteren Umfeld anrichten können. Zudem unterstützt der Bund Kantone, falls diese mit ihren finanziellen Mittel den Schaden nicht bewältigen können. 2003 wurde ein Verbundsystem zur Bewältigung von Katastrophen und Notlagen lanciert. Dieses setzt sich aus folgenden Organisationen zusammen: • Polizei, Gesundheitswesen, Feuerwehr, Zivilschutz und technische Betriebe Die Polizei ist für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und der Ordnung verantwortlich. Die Feuerwehr ist für die Rettung und die allgemeine Schadenwehr zuständig. Das Gesundheitswesen (Sanität) kümmert sich um die medizinische Versorgung. Der Zivildienst unterstützt die Einsatzkräfte Polizei, Feuerwehr und Sanität. Die technischen Dienste sorgen sich um die Versorgung (Elektrizität, Wasser, Gas), Entsorgung (Abfall, Abwasser), Verkehrsverbindungen und die Kommunikationssysteme. A: Polizei Entsorgung, Versorgung Gesundheitswesen Sicherheit, Ordnung Feuerwehr Unterstützung allgemein Zivilschutz Medizinische Versorgung Technische Betriebe Rettung, Schadenwehr B: ZIVIELDIENST, POLIZEI, SANITAET, FEUERWEHR, NOTLAGE, ENTSORGUNG, VERSORGUNG, ORDNUNG, SICHERHEIT,