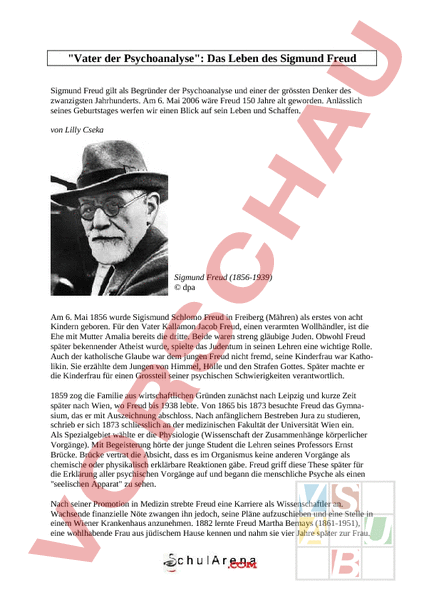Arbeitsblatt: Freud- Vater der Psychoanalyse
Material-Details
Lesetext zu Freud mit Arbeitsblatt und Lösungen
Deutsch
Textverständnis
8. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
108741
1460
22
19.12.2012
Autor/in
Evelyn Widmer
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Vater der Psychoanalyse: Das Leben des Sigmund Freud Sigmund Freud gilt als Begründer der Psychoanalyse und einer der grössten Denker des zwanzigsten Jahrhunderts. Am 6. Mai 2006 wäre Freud 150 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Geburtstages werfen wir einen Blick auf sein Leben und Schaffen. von Lilly Cseka Sigmund Freud (1856-1939) dpa Am 6. Mai 1856 wurde Sigismund Schlomo Freud in Freiberg (Mähren) als erstes von acht Kindern geboren. Für den Vater Kallamon Jacob Freud, einen verarmten Wollhändler, ist die Ehe mit Mutter Amalia bereits die dritte. Beide waren streng gläubige Juden. Obwohl Freud später bekennender Atheist wurde, spielte das Judentum in seinen Lehren eine wichtige Rolle. Auch der katholische Glaube war dem jungen Freud nicht fremd, seine Kinderfrau war Katholikin. Sie erzählte dem Jungen von Himmel, Hölle und den Strafen Gottes. Später machte er die Kinderfrau für einen Grossteil seiner psychischen Schwierigkeiten verantwortlich. 1859 zog die Familie aus wirtschaftlichen Gründen zunächst nach Leipzig und kurze Zeit später nach Wien, wo Freud bis 1938 lebte. Von 1865 bis 1873 besuchte Freud das Gymnasium, das er mit Auszeichnung abschloss. Nach anfänglichem Bestreben Jura zu studieren, schrieb er sich 1873 schliesslich an der medizinischen Fakultät der Universität Wien ein. Als Spezialgebiet wählte er die Physiologie (Wissenschaft der Zusammenhänge körperlicher Vorgänge). Mit Begeisterung hörte der junge Student die Lehren seines Professors Ernst Brücke. Brücke vertrat die Absicht, dass es im Organismus keine anderen Vorgänge als chemische oder physikalisch erklärbare Reaktionen gäbe. Freud griff diese These später für die Erklärung aller psychischen Vorgänge auf und begann die menschliche Psyche als einen seelischen Apparat zu sehen. Nach seiner Promotion in Medizin strebte Freud eine Karriere als Wissenschaftler an. Wachsende finanzielle Nöte zwangen ihn jedoch, seine Pläne aufzuschieben und eine Stelle in einem Wiener Krankenhaus anzunehmen. 1882 lernte Freud Martha Bernays (1861-1951), eine wohlhabende Frau aus jüdischem Hause kennen und nahm sie vier Jahre später zur Frau. Die glückliche Ehe mit drei Söhnen und drei Töchtern stand in völligem Kontrast zu seinem schwierigen Berufsleben. Immer wieder musste Freud für seine Arbeit harte Kritik einstecken, so auch 1884, als er mit der Droge Kokain an Patienten experimentierte. Zwischen 1884 und 1887 publizierte Freud zum Trotz aller Kritiker insgesamt fünf Arbeiten über Kokain. Im September 1885 wurde Freud zum Privatdozenten für Neuropathologie an der Universität Wien ernannt. Kurze Zeit später brach er zu einer viermonatigen Studienreise nach Paris auf, um an der Salpetrière, einem alten Armenkrankenhaus, bei Jean-Martin Charcot zu lernen. Während seines Auslandsaufenthaltes richtete sich sein Interesse auf unterbewusste psychische Beeinflussung und Hypnose. Ihn beschäftigte u.a. die Frage, ob Hysterie mit Hypnose heilbar sei. Nach seiner Rückkehr nach Wien 1886, widmete er sich ganz der hypnotischen Heilmethode, um u.a. körperliche Störungen zu behandeln. Dabei beschäftigten ihn besonders die unbewussten Vorgänge der menschlichen Psyche. In einer aufwändigen Forschungsarbeit entwickelte er die Theorie der Psychoanalyse. Sie zählt heute zu einer der grössten kulturellen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Die Theorie hat sich über hundert Jahre beständig weiterentwickelt und eine Fülle an Erkenntnissen für die Forschung am Menschen hervorgebracht. Schreibtisch-Details und ein Foto von Sigmund Freud im Wiener Freud-Museum dpa Freuds grösstes Werk, die Traumdeutung, erschien 1900 und wurde ein Jahrhundertbuch. Seine bedeutendsten Beiträge neben der Traumlehre sind Abhandlungen zur kindlichen Sexualforschung, insbesondere die Lehre vom Ödipuskomplex (1897) und das Modell des psychischen Apparats über das Ich, Es und Über-ich (1923). Diese Ideen bilden noch immer die Grundlage der Psychotherapie. 1938 zwangen nationalsozialistische Unterdrückungen Freud ins Exil nach Grossbritannien. Bis zu seinem Tod praktizierte er in London, wo er am 23. 9. 1939 im Alter von 83 Jahren an Krebs starb. Das Ich und das Es In einem Modell beschrieb Freud die menschliche Seele einer Person (das Zentrum der Gefühlswelt) als psychischen Apparat und unterschied drei „Persönlichkeiten: das Ich (das Erwachsenen-Ich), das Es (das Kind-Ich) und das Über-Ich (das Eltern-Ich) Das Ich als eine der drei Persönlichkeitsinstanzen hat die Aufgabe zwischen den Triebwünschen des Es und den moralischen Forderungen des Über-Ich zu vermitteln. Das Ich versucht den Anforderungen der Aussenwelt gerecht zu werden und auf vernünftige Art und Weise ein Gleichgewicht zwischen persönlichen und gesellschaftlichen Bedürfnissen zu finden. Das Es stellt das Unterbewusste der menschlichen Psyche dar. Das Es steht für Triebe (z.B. Hunger, Durst, Sexualtrieb), Bedürfnisse und Gefühlsregungen (Neid, Hass, Vertrauen, Liebe). Diese Muster lenken unwillentlich unser Denken und Handeln. Das Über-Ich kann man als moralische Instanz bzw. als Gewissen bezeichnen. Es enthält moralische Massstäbe, Werte und Einstellungen, die in der Kindheit erlernt werden oder aus der Gesellschaft übernommen werden. Das Über-Ich übernimmt gewissermassen die Rolle des Richters, gegenüber dem Es wehrt es alle Triebregungen ab. Aus Konflikten zwischen dem Über-Ich, Ich und Es entstehen Verdrängungen, Depressionen, Ängste usw. Freudsche Versprecher Wenn man in einem Vortrag über den menschlichen Organismus sprechen möchte und anstatt Organismus das Wort Orgasmus verwendet, hat man auf unfreiwillige Weise die Lacher auf seiner Seite. Denn sofort dürfte allen Anwesenden klar sein: Das war ein Freudscher Versprecher. Glaubt man der Theorie Freuds, tritt bei sprachlichen Fehltritten die eigentliche Meinung oder Absicht des Sprechers unfreiwillig zu Tage. Anstatt dass der Sprecher das eigentlich gedachte Wort sagt, rutscht ihm etwas ähnlich Klingendes heraus, das dem Gedachten angeblich sogar besser entspricht. Als Freudsche Versprecher versteht man solche, bei denen eine unterbewusste Motivation angenommen wird, ein eigentlicher Sinn, wie es bei Freud heisst. Wie auch bei vielen anderen, spaltet sich das wissenschaftliche Lager auch bezüglich der Richtigkeit dieser Theorie Freuds. Penisneid Im Rahmen seiner Psychoanalyse prägte Sigmund Freud den Begriff des Penisneids. Auch für diese Theorie musste er viel Kritik einstecken. Heute gilt die These wissenschaftlich kaum noch als anerkannt. Dabei ging er davon aus, dass Mädchen, sobald sie merken, dass sie keinen Penis besitzen, Jungen beziehungsweise Männer darum beneiden. Bei Mädchen passiere das etwa im Alter von vier bis fünf Jahren. Auch als erwachsene Frauen, so die These Freuds, leiden sie manchmal darunter, dass sie keinen Penis besitzen. Folgen des Neids seien schliesslich die oft als typisch weiblich bezeichneten Gefühlsregungen wie Neid, Eifersucht und eine ausgeprägte Konkurrenzhaltung gegenüber Männern.