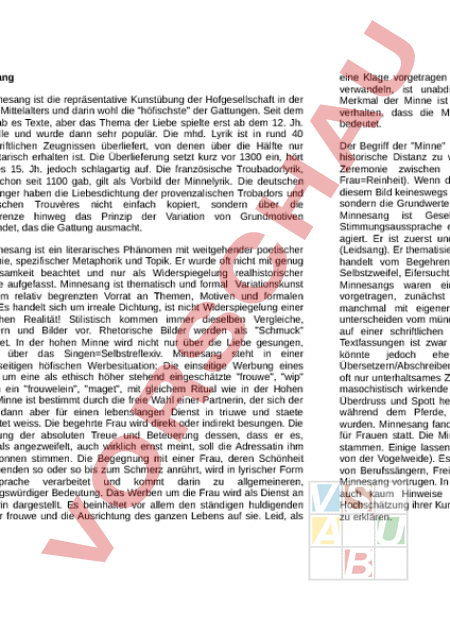Arbeitsblatt: minnesang, walther von der vogelweide
Material-Details
überblick über minnesang und kurze biographie von w.v.d.v.
Deutsch
Leseförderung / Literatur
11. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
110181
1711
11
17.01.2013
Autor/in
jessica fankhauser
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Minnesang Der Minnesang ist die repräsentative Kunstübung der Hofgesellschaft in der Zeit des Mittelalters und darin wohl die höfischste der Gattungen. Seit dem 8. Jh. gab es Texte, aber das Thema der Liebe spielte erst ab dem 12. Jh. eine Rolle und wurde dann sehr populär. Die mhd. Lyrik ist in rund 40 handschriftlichen Zeugnissen überliefert, von denen über die Hälfte nur fragmentarisch erhalten ist. Die Überlieferung setzt kurz vor 1300 ein, hört Ende des 15. Jh. jedoch schlagartig auf. Die französische Troubadorlyrik, die es schon seit 1100 gab, gilt als Vorbild der Minnelyrik. Die deutschen Minnesänger haben die Liebesdichtung der provenzalischen Trobadors und französischen Trouvères nicht einfach kopiert, sondern über die Sprachgrenze hinweg das Prinzip der Variation von Grundmotiven angewendet, das die Gattung ausmacht. Der Minnesang ist ein literarisches Phänomen mit weitgehender poetischer Autonomie, spezifischer Metaphorik und Topik. Er wurde oft nicht mit genug Aufmerksamkeit beachtet und nur als Widerspiegelung realhistorischer Zustände aufgefasst. Minnesang ist thematisch und formal Variationskunst mit einem relativ begrenzten Vorrat an Themen, Motiven und formalen Mitteln. Es handelt sich um irreale Dichtung, ist nicht Widerspiegelung einer historischen Realität! Stilistisch kommen immer dieselben Vergleiche, Metaphern und Bilder vor. Rhetorische Bilder werden als Schmuck verwendet. In der hohen Minne wird nicht nur über die Liebe gesungen, sondern über das SingenSelbstreflexiv. Minnesang steht in einer wechselseitigen höfischen Werbesituation: Die einseitige Werbung eines Mannes um eine als ethisch höher stehend eingeschätzte frouwe, wip oder um ein frouwelein, maget, mit gleichem Ritual wie in der Hohen Minne. Minne ist bestimmt durch die freie Wahl einer Partnerin, der sich der Partner dann aber für einen lebenslangen Dienst in triuwe und staete verpflichtet weiss. Die begehrte Frau wird direkt oder indirekt besungen. Die Beteuerung der absoluten Treue und Beteuerung dessen, dass er es, anders als angezweifelt, auch wirklich ernst meint, soll die Adressatin ihm wohlgesonnen stimmen. Die Begegnung mit einer Frau, deren Schönheit den Liebenden so oder so bis zum Schmerz anrührt, wird in lyrischer Form und Sprache verarbeitet und kommt darin zu allgemeineren, mitteilungswürdiger Bedeutung. Das Werben um die Frau wird als Dienst an der Herrin dargestellt. Es beinhaltet vor allem den ständigen huldigenden Preis der frouwe und die Ausrichtung des ganzen Lebens auf sie. Leid, als eine Klage vorgetragen und nur noch über deren Schönheit in Freude zu verwandeln, ist unabdingbare Konsequenz der Minne. Ein wichtiges Merkmal der Minne ist ihre Gegenseitigkeit. Die frouwe hat sich so zu verhalten, dass die Minnebeziehung Beglückung auch für den Mann bedeutet. Der Begriff der Minne bedeutet Liebe, wird meist nicht übersetzt um eine historische Distanz zu wahren. Sie ist auch Tugendlehre, eine anmutige Zeremonie zwischen den Geschlechtern (MannSelbstbeherrschung, FrauReinheit). Wenn die frouwe als Ideal gepriesen wurde, so waren in diesem Bild keineswegs nur spezifisch weibliche Eigenschaften verzeichnet, sondern die Grundwerte der höfischen Gesellschaft zusammengefasst. Der Minnesang ist Gesellschaftsdichtung, erscheint vordergründig als Stimmungsaussprache eines Ichs, das als Repräsentant der Gesellschaft agiert. Er ist zuerst und grundsätzlich Liebeslyrik, Werbelyrik und Klage (Leidsang). Er thematisiert erotische Beziehungen zwischen Mann und Frau, handelt vom Begehren, von Sehnsucht, Hoffnung und Erhörung, von Selbstzweifel, Eifersucht mit dem Ziel der Liebeserfüllung. Die Vorträge des Minnesangs waren ein Gesellschaftsereignis, sie wurden gesungen vorgetragen, zunächst wohl vom Autor selbst, später von anderen, manchmal mit eigener Begleitung (Fiedel, Harfe). Minnesang ist zu unterscheiden vom mündlichen Vortrag, denn er muss von allem Anfang an auf einer schriftlichen Notierung des Autors beruht haben. Bei vielen Textfassungen ist zwar sagen, rede, spreche als Verb gebraucht, dies könnte jedoch ehemals singen gewesen sein und von Übersetzern/Abschreibern umgeschrieben worden sein. Der Minnesang war oft nur unterhaltsames Zwischenprogramm. Die ständige Klagegebärde und masochistisch wirkende Selbstverleugnung in den Liedern forderten auch Überdruss und Spott heraus. In Schilderungen ist er oft nur kurz erwähnt, während dem Pferde, Ritter und Kleidungen ausführlich beschrieben wurden. Minnesang fand wohl oft im kleineren Kreis als Abendunterhaltung für Frauen statt. Die Minnedichter stammten aus allen sozialen Schichten stammen. Einige lassen sich bis heute nicht einordnen (Reinmar, Walther von der Vogelweide). Es sind jedoch keine Dichterinnen bekannt! Man geht von Berufssängern, Freizeitdichtern, Nachsängern und Sammlern aus, die Minnesang vortrugen. In der Minnelyrik selbst gibt es kaum Angaben, es gibt auch kaum Hinweise auf Mäzene oder Gönner. Aus der offenbaren Hochschätzung ihrer Kunst ist wohl das Selbstbewusstsein der Minnesänger zu erklären. Walther von der Vogelweide Walther von der Vogelweide hat den Minnesang und die Sangspruchdichtung gepflegt und entwickelt. Er hat um die 40 Jahre lang Minnesang verfasst; für die Zeit nach 1230 lässt sich keines seiner Werke mehr verlässlich datieren. Daraus errechnet sich grob eine Lebensspanne von ungefähr 1170 bis 1230. Die ältesten erhaltenen schriftlichen Aufzeichnungen der Minnelieder und Sangsprüche Walthers sind rund 100 Jahre nach deren Entstehung und ersten Aufführung angefertigt worden. Walther gehört zu den Zwölf alten Meistern, auf die nach den fahrenden dann auch die sesshaften, städtisch-zünftigen Meistersänger vom 15. bis 17. Jh. ihre Kunst gründeten. Walther erlernte das Minnesingen am Wiener Hof des Bamberger Herzogs Friedrich. Lehrmeister, bald aber Konkurrent und Fehdegegner war ihm der am Ort tätige Reinmar der Alte. Als Friedrich im April 1198 auf dem Kreuzzug Heinrichs VI. stab, beklagte Walther den Tod des Herzogs als seine eigene Lebenswende. Er musste unter dem Nachfolger den Wiener Hof verlassen und war fortan als fahrender Sänger und Dichter unterwegs. Er war mit seiner Situation unzufrieden, es liess sich aber nicht ändern. In seinem Minnesang, der bereits auf eine gefestigte Tradition aufbauen konnte, setzte Walther Konventionen voraus. Die Texte waren und sind nur verständlich, wenn man sie auf dem Hintergrund der Gattungstradition hört. Wie viel von Walthers tatsächlichem Werk überliefert ist und wie viel möglicherweise verloren ging, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Kennzeichnend für Walther ist, dass er Minne und Minnesang auf psychische, ethische und soziale Realitäten rückbezieht. Man wird nicht fehlgehen, wenn man darin den Sangspruchdichter Walther am Werk sieht, zu dessen Metier es gehört, lobend und scheltend Ideal und Wirklichkeit, Anspruch und Erfüllung zu messen, aber auch den fahrenden Sänger Walther in seiner gesellschaftlichen Ungesichertheit. Walther hat in seinem Minnesang das Thema des Frauendienstes nicht nur in die Perspektive des Dienstes an der Gesellschaft, sondern auch in die religiöse Dimension des Dienstes an Gott, der Verantwortung vor ihm gerückt. Anlass dafür war ihm dabei nicht wie anderen Minnesängern der Kreuzzug er hat kein Kreuzzugs-Minne-Lied geschrieben sondern das Motiv des gesellschaftlichen Niedergans und der Vergänglichkeit alles Irdischen, wie sie besonders dem Alternden sichtbar werden. Es gibt praktisch nur schriftliche Dokumente über Walther, die auch Literatur sind. Abgesehen von vielen lobenden, wenig tadelnden Bemerkungen dichtender Kollegen, ist die Forschung auf biographischen Selbstbezeugungen angewiesen. Die erhaltenen Texte von Walther tragen die Spuren handschriftlicher Überlieferung und eines fast hundertjährigen Überlieferungsganges, Abschreibfehler, Irrtümer und Scheinverbesserungen. Oftmals wurden die Texte an literarische und kulturelle Konventionen angepasst, das Wort minne gar mit Liebe ersetzt. Es bleibt auffällig, dass bestimmte Strophen in manchen Überlieferungssträngen fehlen oder aber, dass Strophenkombinationen auseinandergerissen werden können. Es muss also, mehrere Versionen nebeneinander gegeben haben.