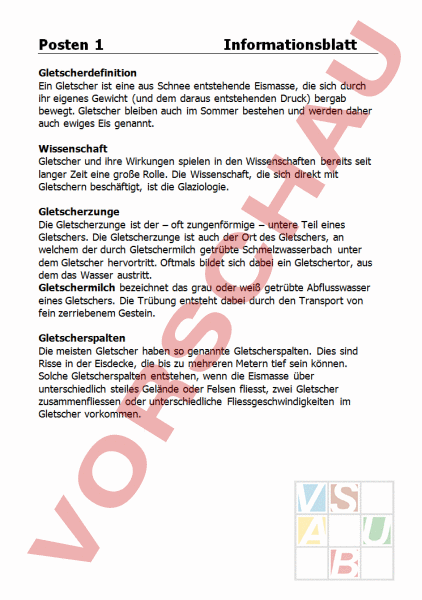Arbeitsblatt: Gletscher Werkstatt
Material-Details
geeignet für 4./5. Klasse
Geographie
Geologie / Tektonik / Vulkanismus
4. Schuljahr
10 Seiten
Statistik
11107
2691
196
25.10.2007
Autor/in
claudio nodari
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Posten 1 Informationsblatt Gletscherdefinition Ein Gletscher ist eine aus Schnee entstehende Eismasse, die sich durch ihr eigenes Gewicht (und dem daraus entstehenden Druck) bergab bewegt. Gletscher bleiben auch im Sommer bestehen und werden daher auch ewiges Eis genannt. Wissenschaft Gletscher und ihre Wirkungen spielen in den Wissenschaften bereits seit langer Zeit eine große Rolle. Die Wissenschaft, die sich direkt mit Gletschern beschäftigt, ist die Glaziologie. Gletscherzunge Die Gletscherzunge ist der – oft zungenförmige – untere Teil eines Gletschers. Die Gletscherzunge ist auch der Ort des Gletschers, an welchem der durch Gletschermilch getrübte Schmelzwasserbach unter dem Gletscher hervortritt. Oftmals bildet sich dabei ein Gletschertor, aus dem das Wasser austritt. Gletschermilch bezeichnet das grau oder weiß getrübte Abflusswasser eines Gletschers. Die Trübung entsteht dabei durch den Transport von fein zerriebenem Gestein. Gletscherspalten Die meisten Gletscher haben so genannte Gletscherspalten. Dies sind Risse in der Eisdecke, die bis zu mehreren Metern tief sein können. Solche Gletscherspalten entstehen, wenn die Eismasse über unterschiedlich steiles Gelände oder Felsen fliesst, zwei Gletscher zusammenfliessen oder unterschiedliche Fliessgeschwindigkeiten im Gletscher vorkommen. Posten 2 Informationsblatt Gletscherentstehung und Verwandlung des Schnees Gletscher entstehen in Gebieten, in denen im Durchschnitt mehr Schnee fällt, als abtauen kann. Auf diese Art und Weise kommt es zur Ansammlung von Schnee, der eine Verwandlung durchläuft. Frisch gefallener Neuschnee bildet eine Schicht aus kaum gepressten Schneekristallen, die dazwischen noch Hohlräume mit eingeschlossener Luft haben. Fällt erneut Schnee, so legt er sich über diese bereits vorhandene Schicht und drückt die mit Luft gefüllten Hohlräume so zusammen, dass sie kleiner werden. Schmelzwasser an warmen Tagen unterstützen diesen Vorgang. So entsteht im Laufe von etwa einem Jahr aus dem Schnee Firneis. Firneis hat keine Spalten und ist am Untergrund festgefroren. Die weitere Pressung des Firneises lässt schließlich Gletschereis entstehen. Im Laufe der Verwandlung sinkt der Luftgehalt immer mehr. Während Neuschnee noch zum grössten Teil aus Luft besteht, ist es beim Firneis noch etwa die Hälfte und bei Gletschereis nur noch ganz wenig. Es kommt also im Verlauf der Gletschereisbildung zu einer starken Verdichtung des Materials. Die Dauer der Verwandlung des Schnees hängt sehr stark von den herrschenden Klima ab. Bei vergleichsweise warmen Gletschern, wie in den Alpen, hat sich der Schnee in wenigen Jahren in Gletschereis umgewandelt. Bei ganz kalten Gletschern, zum Beispiel in der Antarktis, unterstützt kein Schmelzwasser die Eisbildung. So dauert dort die Umwandlung von Schnee in Eis mehrere Jahrzehnte. Ab einer Dicke von etwa 30 Meter fängt das Eis an, sich unter dem Einfluss seines Gewichts zu bewegen (zu fließen). Posten 3 Informationsblatt Nähr- und Zehrgebiet Fast jeder Gletscher besitzt ein Nähr- und ein Zehrgebiet. Im Nährgebiet bleibt zumindest ein Teil des Schnees auch während des Sommers erhalten (Ansammlungsgebiet), so dass er sich durch Druck und Wärmeschwankungen im Lauf mehrerer Jahre zu Gletschereis umformt. Dieses Gletschereis rutscht (fliesst) nun bergab. Unterhalb einer bestimmten Linie, der Gleichgewichtslinie, erreicht das Gletschereis Regionen, in denen das Abschmelzen des Eises gegenüber dem Nachschub durch das Nährgebiet überwiegt. Diese Region heißt Zehrgebiet. Die Größe des Nähr- und Zehrgebiets wechselt jedes Jahr je nach Schneemenge im Winter und Witterungsverlauf im Sommer. Dadurch wird über längere Zeiträume der Gesamthaushalt des Gletschers bestimmt, das heisst, ob er wächst oder schrumpft. Posten 4 Informationsblatt Gletscherarten Je nach Entstehungsweise und Entwicklungsstadium unterscheidet man die Gletscher. Hier sind die wichtigsten Gletscherarten kurz beschrieben. • Talgletscher: Eismassen, die ein deutlich begrenztes Nährgebiet besitzen und sich unter dem Einfluss der Schwerkraft in einem Tal abwärts bewegen. (z. B. Aletschgletscher). • Hängegletscher sind Gletscher, die aufgrund einer Felskante nicht fliessen können sondern immer wieder abbrechen. Sie haben deshalb kein Zehrgebiet. In vielen Fällen gehen diese Gletscher auf Talgletscher zurück, die in den heutigen eisschwachen Zeiten das Zehrgebiet unter der Kante nicht mehr halten können. • Kargletscher: Eismassen geringer Größe, die sich sonnengeschützt in einer Mulde, dem so genannten Kar, befinden. Kargletscher besitzen keine deutlich ausgebildete Gletscherzunge. Oft sind sie auch Hängegletscher. Durch die geschützte Mulde können sie in tiefer gelegenen Regionen auftreten als Talgletscher. • Eisstromnetz: Wachsen Talgletscher so stark an, dass sie mit Gletschern aus anderen Tälern zusammen wachsen, spricht man von einem Eisstromnetz. • Inlandeis oder Eisschild: Die größten Gletscher überhaupt. Eismassen, die so mächtig werden, dass sie die Landschaft fast vollständig überdecken und sich auch weitgehend unabhängig von ihm bewegen. Einige Wissenschaftler scheiden jedoch die großen Inlandeismassen von den kleineren Gletschern und bezeichnen sie deshalb nicht als Gletscher. Posten 5 Informationsblatt Gletscherspuren Gletscher sind bedeutende Landschaftsformer. Insbesondere während den Eiszeiten, als große Teile der Erde vergletschert waren, wurden sehr große Gebiete durch sie umgeformt. Die Wirkung der Gletscher beruht vor allem auf dem von ihnen mitgeführten Moränenmaterial. • Moränen: Als Moräne bezeichnet man alles Material das vom Gletscher transportiert wird. Gletscher können vom Sandkorn bis zum Felsblock alles verschieben, transportieren und wieder ablagern. Je nach der Lage zum Gletscher bezeichnet man sie als Ober-, Seiten-, Mittel-, Innen-, Unter- oder Endmoräne. Der Begriff „Moräne bezieht sich heut zu Tage eher auf die entsprechenden Landschaftsformen und nicht mehr auf das eigentliche Geröllmaterial. Arten von Moränen Das Geröllmaterial, das ein Geltscher mit sich führt heisst Moräne. Je nachdem wo und wie das Geröll mitgeführt wird, heisst es anders. • Obermoränen stammen von dem Material, das von den Felswänden auf den Gletscher stürzt und sich beim Schmelzen des Gletschers ablagert, sie kommen vornehmlich im Zehrgebiet vor. • Innenmoränen umfassen alles Material, das im inneren des Gletschers, also interglazial transportiert wird. • Untermoränen sind unter dem Eispanzer. Das Material der Untermoräne wird durch die Reibung mit dem Untergrund sehr stark geschliffen und zerkleinert. • Seitenmoränen bilden sich entlang der Ränder der Gletscherzunge. Ihr Material stammt einerseits von dem seitlich anstehenden Gestein, zum Großteil aber aus ehemaligen Untermoränen, die an die Seiten des Gletschers geführt worden sind. • Mittelmoränen entstehen aus den Seitenmoränen zweier Gletscher. Diese vereinen sich, wenn Gletscher zusammenfließen. • Endmoränen bilden sich als Geröllanhäufung am Gletscherende, wenn sich die Gletscherstirn für längere Zeit nicht bewegt. An ihnen kann man besonders gut die größte Ausdehnung des Gletschers erkennen. • Findlinge sind größere vom Eis mitgeführte und abgelagerte Gesteinsblöcke. Posten 1 Fragenblatt Lies den Informationstext zum Posten 1 und löse die Fragen auf diesem Blatt. Welche der folgenden Aussagen sind richtig, welche falsch? Kreuze an. Schreibe zu den falschen Aussagen hin, wie es richtig wäre. (auf die Linie) 1. Gletscher bestehen aus Schnee und Eis. stimmt stimmt nicht 2. Menschen die sich irgendwie mit Gletschern beschäftigen, nennt man Glaziologen. stimmt stimmt nicht 3. Gletscherzungen heissen so, weil sie oft wie eine Zunge aussehen. Sie befinden sich stets im oberen Teil des Gletschers. stimmt stimmt nicht 4. Milch von Kühen die auf Gletschern leben, nennt man Gletschermilch. stimmt stimmt nicht 5. Gletscherspalten sind Risse in der Gletscheroberfläche. stimmt stimmt nicht Posten 2 Fragenblatt Lies den Informationstext zum Posten 2 und löse die Fragen auf diesem Blatt. (Schreibe auf die Rückseite wenn du keinen Platz mehr hast.) 1. In welchen Gebieten entstehen Gletscher? 2. Beschreibe den Vorgang vom Schnee zum Gletschereis in eigenen Worten. 3. Wie heisst das Zwischenprodukt bei der Verwandlung vom Schnee zum Gletschereis. 4. Schreibe eine Vermutung auf, wieso Schmelzwasser die Eisbildung beschleunigt. (Du kannst auch eine Zeichnung auf die Rückseite machen.) 5. Ab einer Dicke von wie vielen Metern beginnt Gletschereis bergab zu fliessen? (Vorsicht!!! Diese Zahl gilt nur für Gletscher in den Alpen oder ähnlichen Gebieten.) Posten 3 Fragenblatt Lies den Informationstext zum Posten 3 und löse die Fragen auf diesem Blatt. (Schreibe auf die Rückseite wenn du keinen Platz mehr hast.) 1. Was ist das Nährgebiet eines Gletschers? 2. Was ist das Zehrgebiet eines Gletschers? 3. Wieso sind die Nähr- und Zehrgebiete von Gletschern jedes Jahr unterschiedlich gross? 4. Was bedeutet „Gesamthaushalt des Gletschers? Von was wird dieser Gesamthaushalt beeinflusst? Posten 4 Fragenblatt Lies den Informationstext zum Posten 4 und löse die Fragen auf diesem Blatt. (Schreibe auf die Rückseite wenn du keinen Platz mehr hast.) 1. Wieso werden Gletscher in unterschiedliche Gletscherarten unterteilt? 2. Kargletscher liegen in einem so genannten Kar. Was ist das? 3. Wieso können Kargletscher in tieferen Regionen als Talgletscher auftreten? 4. Wieso heissen Talgletscher so wie sie heissen? 5. Auf welche Gletscherart gehen die meisten Hängegletscher zurück? 6. Wie nennt man einen Gletscher der mit einem anderen zusammen gewachsen ist? 7. Was ist Inlandeis? Was denkst du, wo es heute solches Inlandeis gibt? Posten 5 Fragenblatt Lies den Informationstext zum Posten 5 und löse die Fragen auf diesem Blatt. Welche der folgenden Aussagen sind richtig, welche falsch? Kreuze an. Schreibe zu den falschen Aussagen hin, wie es richtig wäre. (auf die Linie) 1. Eine Obermoräne ist im Gletscher eingeschlossenes Geröllmaterial. stimmt stimmt nicht 2. Innenmoränen liegen gut ersichtlich auf der Gletscheroberfläche. stimmt stimmt nicht 3. Findlinge sind Kinder, die immer wieder etwas finden. stimmt stimmt nicht 4. Mittelmoränen entstehen, wenn zwei Gletscher zusammen fliessen. stimmt stimmt nicht 5. Untermoränen bestehen vor allem Grosse Steine und Felsbrocken. stimmt stimmt nicht Schreibe eine Vermutung auf die Rückseite, wieso an Endmoränen gut die grösste Ausdehnung eines Gletschers abgelesen werden kann.