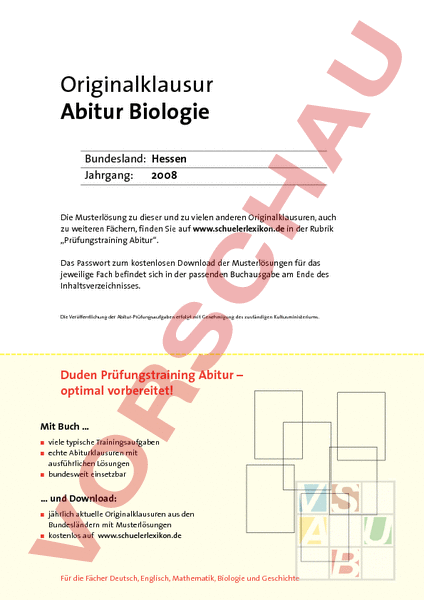Arbeitsblatt: Abitur Hessen 2008
Material-Details
Biologie Abitur
Biologie
Gemischte Themen
klassenübergreifend
33 Seiten
Statistik
113159
1656
13
11.03.2013
Autor/in
BenutzerInnen-Konto gelöscht (Spitzname)
Land:
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Originalklausur Abitur Biologie Bundesland: Hessen Jahrgang: 2008 Die Musterlösung zu dieser und zu vielen anderen Originalklausuren, auch zu weiteren Fächern, finden Sie auf www.schuelerlexikon.de in der Rubrik „Prüfungstraining Abitur. Das Passwort zum kostenlosen Download der Musterlösungen für das jeweilige Fach befindet sich in der passenden Buchausgabe am Ende des Inhaltsverzeichnisses. Die Veröffentlichung der Abitur-Prüfungsaufgaben erfolgt mit Genehmigung des zuständigen Kultusministeriums. Duden Prüfungstraining Abitur – optimal vorbereitet! Mit Buch viele typische Trainingsaufgaben echte Abiturklausuren mit ausführlichen Lösungen bundesweit einsetzbar und Download: jährlich aktuelle Originalklausuren aus den Bundesländern mit Musterlösungen kostenlos auf www.schuelerlexikon.de Für die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie und Geschichte Hessisches Kultusministerium Landesabitur 2008 Biologie Leistungskurs Thema und Aufgabenstellung Vorschlag A1 Aus urheberrechtlichen Gründen kann die Grafik hier nicht veröffentlicht werden. Eine „Codesonne findest du in deinem Schulbuch oder im Internet. Hinweise für den Prüfling Einlese- und Auswahlzeit (insgesamt): Bearbeitungszeit (insgesamt): 30 Minuten 240 Minuten Auswahlverfahren Es gibt drei Aufgabengruppen A, und C, aus denen insgesamt 2 Vorschläge zu bearbeiten sind. Aus einer der Gruppen hat Ihre Prüferin Ihr Prüfer einen Vorschlag für Sie ausgewählt. Aus den verbleibenden beiden Gruppen steht je ein Vorschlag zur Auswahl, einer dieser Vorschläge ist auszuwählen und zu bearbeiten. Der nicht ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehrkraft zurückgegeben werden. Erlaubte Hilfsmittel Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung Sonstige Hinweise keine In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen Name: Vorname: Prüferin Prüfer: Datum: Seite 1 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag A1 Genetik Knochenerkrankungen Aufgaben 1. Erklären Sie, was man unter Genexpression versteht und beschreiben Sie ausführlich den in Material 1 dargestellten Teilprozess der Genexpression bei Eukaryonten. (11 BE) 2. Ordnen Sie der in Material 2 angegebenen Aminosäuresequenz für normales Kollagen sowie den Aminosäuresequenzen, welche zur Glasknochenkrankheit Osteogenesis imperfecta (O.i.) und zum Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS) führen, jeweils einen möglichen codogenen DNA-Strang zu (Material 4). (9 BE) 3. Analysieren Sie a) den vorliegenden Stammbaum zur Glasknochenkrankheit hinsichtlich des zugrunde liegenden Erbganges und b) den jeweiligen Genotyp der Familienmitglieder 1 bis 15 (Material 3). (12 BE) 4. Stellen Sie den möglichen Zusammenhang zwischen der Aminosäuresequenz und der Knochenfestigkeit sowie die mögliche genetische Ursache für die Entstehung von O.i. und EDS dar. Entwickeln Sie eine Hypothese, wie die unterschiedliche Ausprägungsstärke der Symptome von O.i. erklärt werden könnte (Material 2). (18 BE) Seite 2 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag A1 Material 1 P: Peptid-Bindungsstelle, Ausgang A: Aminosäure-Bindungsstelle, Eingang Transferase: katalysiert den Wechsel der Aminosäure von einer t-RNA an die wachsende Polypeptidkette verändert nach: Baron, D. et al., Materialien II – Biologie Genetik, Schroedel-Verlag, Braunschweig 2004, S. 73 Material 2 Deckknochen entstehen, indem sich zunächst unspezifische Zellen zu Knochenbildungszellen differenzieren, welche eine weiche Grundsubstanz aus Proteinen abgeben. In diese werden zunächst Kollagenfasern eingebaut. Erst später wird die Substanz durch Einlagerung von Calciumsalzen zu eigentlichen Knochen. Das im Gewebe wichtige Stützprotein Kollagen, welches für die Gewebsfestigkeit verantwortlich ist, besitzt eine -Helix-Struktur. Die Kollagenfasern bestehen aus Bündeln von solchen -Helices. In den Polypeptidketten der Kollagenfasern liegt in dauernder Wiederholung die folgende Aminosäuresequenz vor: 5-- [- Glycin (Gly) Alanin (Ala) – Prolin (Pro) -] n-- 3 Bei der Glasknochenkrankheit Osteogenesis imperfecta O.i.), einer erblichen Gewebserkrankung, findet man an Stelle des Glycins die Aminosäure Cystein im Kollagen-Polypeptid. Seite 3 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag A1 Die Aminosäure Cystein hat die Möglichkeit mit anderen Cystein-Molekülen Disulfidbrücken zu bilden. Die Symptome bei O.i. – wie z. B. die abnorme Knochenbrüchigkeit und -verformung – können bei Betroffenen verschieden stark ausgeprägt sein. Eine weitere erbliche Bindegewebsschwäche an Haut, Muskulatur, Gelenken und Gefäßen ist das Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS), bei welchem u. a. überstreckbare Gelenke auftreten. An Stelle des Glycins befindet sich beim EDS die Aminosäure Serin in den Polypeptidketten der Kollagenfasern. Die Aminosäuren Glycin, Serin und Cystein besitzen verschiedene „Reste: Glycin: H Serin: CH2OH Cystein: CH2SH verändert nach: Lehninger, Biochemie, Springer-Verlag, Heidelberg 2001; Mörike, Betz, Mergentaler (Hrsg.), Biologie des Menschen, Quelle Meyer-Verlag, Wiesbaden 1989 Material 3 Stammbaum einer Familie mit erblicher Glasknochenkrankheit, Osteogenesis imperfecta verändert nach: Baron, D. et al., Genetik, Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schönigh Winklers GmbH, Braunschweig 2004, S.165 Seite 4 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag A1 Material 4 Aus urheberrechtlichen Gründen kann die Grafik hier nicht veröffentlicht werden. Eine „Codesonne findest du in deinem Schulbuch oder im Internet. verändert nach: Bayrhuber, H., Kull, U.(Hrsg.), Linder Biologie Arbeitsbuch, Metzler-Verlag, 1983 Seite 5 von 5 Hessisches Kultusministerium Landesabitur 2008 Biologie Leistungskurs Thema und Aufgabenstellung Vorschlag A2 Hinweise für den Prüfling Einlese- und Auswahlzeit (insgesamt): Bearbeitungszeit (insgesamt): 30 Minuten 240 Minuten Auswahlverfahren Es gibt drei Aufgabengruppen A, und C, aus denen insgesamt 2 Vorschläge zu bearbeiten sind. Aus einer der Gruppen hat Ihre Prüferin Ihr Prüfer einen Vorschlag für Sie ausgewählt. Aus den verbleibenden beiden Gruppen steht je ein Vorschlag zur Auswahl, einer dieser Vorschläge ist auszuwählen und zu bearbeiten. Der nicht ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehrkraft zurückgegeben werden. Erlaubte Hilfsmittel Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung Sonstige Hinweise keine In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen Name: Vorname: Prüferin Prüfer: Datum: Seite 1 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag A2 Genetik Virustatika – Medikamente gegen Herpes Aufgaben 1. Beschreiben Sie den Ablauf der DNA-Replikation und die Funktion der daran beteiligten Enzyme. (12 BE) 2. Erklären Sie mit Hilfe des Textes, der Strukturformeln und der schematischen Darstellung aus Material 2, wie Aciclovir die virale DNA-Replikation unterbricht und damit ein wirksames Virustatikum (Medikament gegen Viren) darstellt (Material 1und 4). (18 BE) 3. Erläutern Sie anhand von Material 3 und 4 und mit Ihrem Wissen über die DNA Replikation (siehe Aufgabe 1), warum Ganciclovir in der Herpesviren-Bekämpfung nicht eingesetzt werden sollte. (6 BE) 4. Skizzieren und erklären Sie das Wirkungsprinzip des Wirkstoffs Fomivirsen (Material 5). (14 BE) Seite 2 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag A2 Material 1 Abbildung 1.1 Der Weg des Herpes-Virus 19 von 20 Mitteleuropäern haben mittlerweile Bekanntschaft mit dem Virus Herpes labialis geschlossen; einem Virus, das Lippenherpes und Lippenbläschen verursacht. Der erste Kontakt mit dem Virus erfolgt in der Regel als Kind bis zum Alter von 5 Jahren. Infektionsquellen hierfür sind andere infizierte Kinder oder Erwachsene. Das Immunsystem des Menschen bildet schnell Antikörper und „vertreibt die Viren aus den oberflächlichen Schleimhäuten. Leider sind die Viren damit nicht entfernt, das Virus wirft seine Hülle ab und überdauert als DNA für das Immunsystem unsichtbar in den Nervenknoten der sensorischen Nerven. Diese infizierten Zellen dienen als lebenslanges „Basislager der Viren. Auf bestimmte Reize hin (UV Strahlung mechanische Reizungen Stress usw.) kommt es zur erneuten Infektion. Die Entwicklung von Viren bekämpfenden Mitteln (Virustatika) ist deshalb so schwierig, weil Viren keinen eigenen Stoffwechsel haben, sondern den ihres Wirtes benutzen. verändert nach: www.medizin.de/gesundheit/deutsch/479htm Material 2 Infiziert ein Herpes labialis-Virus eine Wirtszelle, baut es seine Virus-DNA in die Zelle des betroffenen Wirtes ein und lässt diese dann replizieren. Für die Replikation sind energiereiche Nukleotide notwendig, die im Gegensatz zu einem einfachen Nukleotid noch zwei weitere Phosphatgruppen aufweisen, wie z. B. Desoxy-Guanosin-Triphosphat (dGTP). Das Herpes-Virus liefert zur bevorzugten Replikation der eigenen eingebauten DNAAbschnitte eine eigene virale DNA-Polymerase mit. Ebenso bewirkt das Herpes Virus in der infizierten Wirtszelle die Bildung des Enzyms Thymidinkinase, die nur in infizierten Zellen vorkommt. Seite 3 von 5 Hessisches Kultusministerium Landesabitur 2008 Biologie Leistungskurs Thema und Aufgabenstellung Vorschlag A2 Als geeignetes Medikament mit hoher Wirksamkeit gegen die beschriebenen Symptome hat sich Aciclovir bewährt. Ein anderer Wirkstoff, Ganciclovir, hingegen besitzt eine deutlich geringere Wirksamkeit und zeigt viele unerwünschte Nebenwirkungen. verändert nach: Zetler, G., So wirken Medikamente – Grundlagen, Mechanismen, Ausblicke, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, 2. Auflage, Stuttgart 2002 Abbildung 2.1 Wirkungsmechanismus von Aciclovir verändert nach: www.chups.jussieu.fr/polys/viro/poly/POLY.Chp.1.5html Material 3 Schematische Darstellung der Phosphorylierung von Aciclovir Thymidinkinase (Enzym) Aciclovir Kinase der menschlichen Zelle (Enzym) AciclovirMonophosphat AciclovirTriphosphat Seite 4 von 5 Hessisches Kultusministerium Landesabitur 2008 Biologie Leistungskurs Thema und Aufgabenstellung Vorschlag A2 Material 4 Vergleich von Aciclovir und Ganciclovir Wirkstoff Blockierung der viralen DNA-Polymerase Aciclovir Ganciclovir Blockierung der menschlichen DNA-Polymerase Material 5 Eine vollkommen neue Strategie beschreitet der Wirkstoff Fomivirsen, der speziell der Bekämpfung von Zytomegalie-Viren dient. Dieses mit dem Herpes-Virus verwandte Virus ruft beim Menschen Entzündungen u.a. in der Leber, Gehirn und Lunge hervor. Ausschnitt aus dem nicht-codogenen Strang eines Gens aus dem Zytomegalie-Virus-Genom: 5 3 Fomivirsen besteht aus einer kurzen Nukleotidsequenz mit folgender Basenabfolge: Seite 5 von 5 Hessisches Kultusministerium Landesabitur 2008 Biologie Leistungskurs Thema und Aufgabenstellung Vorschlag B1 Hinweise für den Prüfling Einlese- und Auswahlzeit (insgesamt): Bearbeitungszeit (insgesamt): 30 Minuten 240 Minuten Auswahlverfahren Es gibt drei Aufgabengruppen A, und C, aus denen insgesamt 2 Vorschläge zu bearbeiten sind. Aus einer der Gruppen hat Ihre Prüferin Ihr Prüfer einen Vorschlag für Sie ausgewählt. Aus den verbleibenden beiden Gruppen steht je ein Vorschlag zur Auswahl, einer dieser Vorschläge ist auszuwählen und zu bearbeiten. Der nicht ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehrkraft zurückgegeben werden. Erlaubte Hilfsmittel Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung Sonstige Hinweise keine In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen Name: Vorname: Prüferin Prüfer: Datum: Seite 1 von 6 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag B1 Ökologie und Stoffwechselphysiologie Guam – eine Insel im Pazifik Aufgaben 1. Benennen Sie die typischen Nahrungsbeziehungen innerhalb eines Ökosystems und erläutern Sie die Gesetzmäßigkeiten der Selbstregulation eines Ökosystems nach den Volterra-Regeln und II. (10 BE) 2. Beschreiben und analysieren Sie die in den Materialien 1 bis 4 dargestellten Populationsentwicklungen und Vorgänge bei den betroffenen Tieren und Tiergruppen Guams. (15 BE) 3. Entwickeln Sie unter Berücksichtigung der Materialien 1 bis 4 zunächst a) eine Hypothese, wie sich die Schlangenpopulation ohne regulierende Maßnahmen des Menschen weiter entwickeln könnte, sowie b) ein Programm zum Schutz der verbliebenen Tierarten und zur Rekultivierung des ursprünglichen Ökosystems. (15 BE) 4. Diskutieren Sie die Auswirkungen einer Invasion durch neu eingeführte Pflanzen (Neophyten) und Tiere (Neozoen) auf ein Festland-gestütztes Ökosystem gegenüber einem Insel-gestützten Ökosystem und stellen Sie die Rolle des Menschen im Rahmen dieser Problematik dar. (10 BE) Seite 2 von 6 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag B1 Material 1 Der verstummte Regenwald – Invasion im Tropenparadies Die Insel Guam liegt ca. 2000 km östlich der Philippinen im Pazifischen Ozean. (s. Karte, Material 2). Politisch ist sie seit dem 2. Weltkrieg den USA zugeordnet, die sie seitdem als Truppenstützpunkt der Pazifik-Flotte nutzen. Guam ist die größte der Marianen-Inseln und zeigt bei einer nördlichen Breite von 15 tropisches Klima und eine entsprechende Vegetation. Mit nur 550 km2 Fläche ist die als Ferienparadies beliebte Insel allerdings recht klein. Neben dem beherrschenden Regenwald gibt es noch einige landwirtschaftliche Anbauflächen und Grasländer. Die 163 000 Einwohner verteilen sich auf die Hauptstadt Agana und kleinere, meist an der Küste gelegene Städte und Siedlungen. Vermutlich im Jahre 1949 wurden durch einen Militärtransport unbemerkt Exemplare der im nördlichen Australien beheimateten braunen Baumschlange (Boiga irregularis) auf die bis dahin schlangenfreie Insel verschleppt. Heute leben etwa 1 Million Schlangen auf der Insel (über 5000 Exemplare pro km2), was bedeutet, dass man durchschnittlich alle 20 auf eine Schlange trifft. Aus genetischen Untersuchungen weiß man, dass alle Schlangen Nachkommen eines trächtigen Weibchens sind. Das Ökosystem der Insel wurde durch die Baumschlangenbesiedlung nachhaltig verändert, in Guams Regenwäldern ist es seitdem still geworden. Die zuständigen US-Behörden versuchen seit Jahren den Schaden in Grenzen zu halten. Doch die Schlange wurde sehr spät, erst Anfang der achtziger Jahre als Verursacher der ökologischen Veränderungen identifiziert; ein Vorsprung, der schwer einzuholen ist. Ein weiteres Problem: Etliche andere Fremdarten wurden seitdem auf der Insel eingeführt, u.a. Eidechsen. Neben den ökologischen Veränderungen kommt es durch die Schlangenbesiedlung auch zu wirtschaftlichen Schäden: Stromausfälle, verursacht durch Schlangen, die mit ihren Körpern Hochspannungsleitungen kurzschließen, sind an der Tagesordnung und behindern Wirtschaft und Tourismus. Quelle: s.u. Seite 3 von 6 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag B1 Material 2 Natürliches Verbreitungsgebiet der Braunen Baumschlange Landmassen im Bereich der Markierung) Quelle: s.u. Material 3 Quelle: s.u. Seite 4 von 6 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag B1 Material 4 Wichtige Daten zu einigen ausgewählten Wirbeltieren Guams (GL Gesamtlänge; KRL Kopf-Rumpf-Länge) Braune Baumschlange (Boiga irregularis) Gehört zur Familie der Nattern. GL 180 300 cm; ca. 16 Eier pro Gelege, 90 Tage Entwicklungszeit. Weibchen können Spermien mehrere Jahre lang aufbewahren. Nachtaktiver, aggressiver Jäger. Exzellenter Kletterer, der sich vorwiegend (aber nicht nur) in den Bäumen aufhält und tagsüber auch dort ruht. Beute: Eier und Nachwuchs von Wirbeltieren aller Art sowie die Wirbeltiere selbst. Tötet durch Giftbiss (für Menschen allerdings nicht lebensbedrohlich). Vier-Finger-Eidechse (Carlia fusca) KRL ca. 30 cm, Körper braun-dunkelbraun (Unterseite grau oder beige). Ca. 1960 in Guam eingeschleppt. Auf anderen Pazifischen Inseln weit verbreitet. Unterscheidet sich von allen anderen Eidechsenarten durch nur vier Finger an den Extremitäten. Bodenbewohner, der auch in niedere Gehölze klettert. Eher tagaktiv, flink, sehr aggressiv. Nahrung: Insekten und Eier anderer Tiere. Dringt auch in menschliche Siedlungen vor. Von 37 endemischen Vogel- Reptilien- und Säugetierarten sind hier nur einige exemplarisch ausgewählt (endemisch: „nur auf diesem Gebiet vorkommend): Marianen-Brillenvogel (Zosterops conspicillatus saypani Status: Auf Guam ausgerottet. Kleiner hellgelb-hellgrüner Vogel (GL bis 10 cm), der seinen Namen durch die auffälligen weißen Ringe um die Augen bekam. Endemisch auf den Marianen. Lebt in Scharen in den obersten Baumwipfeln und befestigt seine aus Gras und Wurzeln bestehenden Nester mit einer Hakenkonstruktion an den Ästen. Das Weibchen legt 1-3 kleine, blaue Eier. Tagaktiv, frisst Insekten, Früchte, Samen. Guam-Ralle (Rallus owstoni) Status: Auf Guam ausgerottet. Exemplare nur noch in zoologischen Gärten. GL 11-24 cm. Flugunfähiger Vogel; braune Färbung. Nahrung: Insekten, kleine Schlangen, Früchte, Samen. 3-6 Eier pro Gelege. Kann 2-3 mal pro Jahr brüten. Bevorzugter Lebensraum: Grasland, Getreidefelder, Heimat: Guam. Marianen-Krähe (Corvus kubaryi) Status: Ein Dutzend Exemplare haben überlebt. Endemischer, schwarz gefärbter Vogel, der recht alt werden kann. Bis zu 38 cm Länge und 250 Gewicht. Waldbewohner, breites Nahrungsspektrum von Früchten, Samen und Blüten bis zu Eidechsen, Insekten, Würmern und Mäusen. Nester in Astgabeln. Meist zwei Jungtiere, die bis zu einem Jahr im Nest bleiben. Mantel-Fledermaus (Emballonura semicaudata) Status: Auf Guam ausgerottet. Kleine braune Fledermaus mit bis zu 50 Gewicht. Spannweite bis 15 cm. Erwachsene Tiere sind kleiner als die Jungtiere des Marianen-Flughundes. Nachtaktiv, ernährt sich von allerlei fliegenden Insekten. Jagt in Wäldern, offene Felder werden gemieden. Ein Jungtier pro Jahr. Die Jungtiere werden mehrere Monate gesäugt und in Gruppen von mehreren Weibchen umSeite 5 von 6 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag B1 sorgt, die zur Nahrungssuche nachts die Höhlen verlassen. Die Männchen leben getrennt von Müttern und Jungtieren. Marianen-Flughund (Pteropus mariannus) Status: Bestände stark dezimiert und vom Aussterben bedroht. Spannweite bis zu 100 cm. Gewicht bis 500 g. Tragzeit: 7 Monate, ein Junges pro Wurf. Endemisch auf den Marianen-Inseln und dem Ulithi Atoll. Die Flughunde ruhen tagsüber in ihren mehrere hundert Tiere umfassenden Kolonien. Bei Sonnenuntergang verlassen sie ihre Nester zur Nahrungssuche und kehren gegen Sonnenaufgang zurück. Sie ernähren sich von Früchten und Blütennektar vieler verschiedener Bäume und Pflanzen. Wichtiger Bestäuber Blauschwanz-Eidechse (Emoia caeruleocauda) Status: Auf Guam stark dezimiert. KRL bis 15 cm; kleine Eidechse mit charakteristischem blauen Schwanz, die Weibchen legen mehrfach pro Jahr 1-2 Eier und verstecken diese in der Laubstreu. Tagaktiver Bodenbewohner, der nicht sehr hoch klettert. Insektenfresser. Material 1, 2, 3, 4: verändert nach: Müller, Ole, Ökologie, Stark Verlag o.J. (Angaben zu den Tieren Guams u. d. Marianen) (An integrated management plan for Boiga irregularis) (Allgemeine Informationen zur braunen Baumschlange) (Allgemeine Informationen auf Deutsch) Seite 6 von 6 Hessisches Kultusministerium Landesabitur 2008 Biologie Leistungskurs Thema und Aufgabenstellung Vorschlag B2 Hinweise für den Prüfling Einlese- und Auswahlzeit (insgesamt): Bearbeitungszeit (insgesamt): 30 Minuten 240 Minuten Auswahlverfahren Es gibt drei Aufgabengruppen A, und C, aus denen insgesamt 2 Vorschläge zu bearbeiten sind. Aus einer der Gruppen hat Ihre Prüferin Ihr Prüfer einen Vorschlag für Sie ausgewählt. Aus den verbleibenden beiden Gruppen steht je ein Vorschlag zur Auswahl, einer dieser Vorschläge ist auszuwählen und zu bearbeiten. Der nicht ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehrkraft zurückgegeben werden. Erlaubte Hilfsmittel Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung Sonstige Hinweise keine In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen Name: Vorname: Prüferin Prüfer: Datum: Seite 1 von 6 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag B2 Ökologie und Stoffwechselphysiologie Welwitschia mirabilis, eine der eigenartigsten Wüstenpflanzen der Welt Aufgaben 1. Beschreiben und erläutern Sie die morphologischen Anpassungen der Pflanze an die abiotischen Faktoren ihres Standortes (Material 1). (16 BE) 2. Beschreiben Sie die Messergebnisse zum Gaswechsel eines Welwitschiablattes (Material 2) und geben Sie die vollständige Summengleichung der Fotosynthese an. (15 BE) 3. Analysieren Sie anhand von Material 3 die Anpassungen einer CAM-Pflanze an trockene heiße Standorte. (11 BE) 4. Begründen Sie anhand von Material 2 und 3, ob man Welwitschia mirabilis zu den CAM-Pflanzen zählen kann. (8 BE) Seite 2 von 6 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag B2 Material 1 An dieser Pflanze ist alles ein wenig merkwürdig. Die Verwandte des „Tannenbaums hat einen unterirdischen Stamm und nur zwei „Nadeln, die dafür aber bis zu 2,5 Meter lang werden können. Die Rede ist von Welwitschia mirabilis (Abb. 1.1) Entdeckt wurde dieses „lebende Fossil vom österreichischen Forscher Welwitsch im Jahre 1850. Das Verbreitungsgebiet der Pflanze ist die Namib-Wüste im südwestlichen Afrika. Die Namib ist eine Küstenwüste von ca. 200 km Breite und erstreckt sich vom südlichen Wendekreis nordwärts bis nach Angola. An den Standorten von Welwitschia spielt der in Wüsten normalerweise bedeutsame Niederschlag in Form von Nebeln keine Rolle. Es treten seltene Regenfälle auf. Die Welwitschia -Vorkommen stellen an ihrem Standort z. T. die Grundlagen für kleine, eigene lokale Ökosysteme dar. Die Pflanzen können über 1.000 Jahre alt werden; selbst ein Alter von ca. 2.000 Jahren erscheint – nach jüngsten Forschungen nicht ausgeschlossen. W. mirabilis bildet lediglich zwei ca. 30 cm breite Blätter aus, eigentlich Nadeln, die immer weiter wachsen und an den Enden verwittern. Die Wachstumsgeschwindigkeit der Blätter, die vielfach auch der Länge nach aufreißen und damit Vielblättrigkeit vortäuschen, hängt stark von der Wasserversorgung der Pflanzen ab. Bei extremer Dürre können sich die Blätter von den Spitzen her soweit mechanisch abnutzen, dass nur ein kleiner Teil mit teilungsfähigem Gewebe verbleibt. Die Blätter weisen typische Anpassungen an den heißen und trockenen Standort auf (Abb. 1.1. und 1.3). Der oberirdische, zum Teil verholzte Teil von Welwitschia kann bis zu 1,5 Meter hoch werden. Der Stamm ist zum Teil in den Boden verlagert und speichert große Mengen Wasser (Abb. 1.2). Welwitschia verfügt über ein geschichtetes und tief greifendes Wurzelsystem. Die Einzigartigkeit dieser Pflanzenart, ihr extremer Standort und das stammesgeschichtlich vermutlich hohe Alter wecken seit vielen Jahren das Interesse von Pflanzenphysiologen. Zur Messung der Fotosyntheseaktivität am natürlichen Standort wurden Blattabschnitte mit Messkammern umschlossen und der Gaswechsel genauer untersucht (Material 2). Abbildung 1.1 verändert nach: Walter, H., Breckle, W., Ökologie der Erde Band 3, Spektrum Akademischer Verlag, München 2004 Seite 3 von 6 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag B2 Abbildung 1.2 Das Wurzelsystem von Welwitschia Es wurde eine Welwitschia-Pflanze untersucht, die an einem leicht ansteigenden Hang steht, an dem sich zu Zeiten von Niederschlägen kleine Rinnsale bilden können. Die Seitenwurzeln in 10 cm Tiefe wurden bis 1,2 Meter seitwärts verfolgt, sie können mehrere Meter erreichen. Die Hauptwurzelverzweigung ist in 25 cm Bodentiefe. Zwischen 25 cm und 80 cm Tiefe wird im Boden reichlich Wasser kapillar gespeichert. (Grus: kleine, durch Verwitterung entstandene Gesteinsbrocken Calcit: Kalkspat, ein Mineral) Abbildung 1.3 Schematischer Querschnitt durch den oberen Blattbereich von Welwitschia; (Kutinisierung: Veränderungen von Zellwänden, um sie wasserundurchlässiger zu machen). Seite 4 von 6 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag B2 Material 2 Obere Abbildung: Tagesgang der CO2 Assimilation eines Welwitschia-Blattes. Zur Messung wurde das Blatt in eine Messkammer eingeschlossen. Mittlere und untere Abbildung: Tagesgang der Messung unterschiedlicher Faktoren (Globalstrahlung: Die auf einen Ort an der Erdoberfläche eintreffende solare Strahlung; gemessen in Watt/m) Material 3 Die Grafiken geben die Fotosynthesevorgänge einer CAM-Pflanze wieder. (CAM: Crassulacaeen Acid Metabolism). CAM-Pflanzen zählen zu den C4-Pflanzen. Diese haben ihren Namen deswegen erhalten, weil bei ihnen C4-Moleküle wie zum Beispiel Malat (Äpfelsäure) eine bedeutende Rolle im Fotosyntheseprozess spielen. CAM-Pflanzen sind in der Regel dickblättrige Pflanzen, die heiße Standorte besiedeln können. Seite 5 von 6 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag B2 Abbildung 3.1 Fotosyntheseprozesse in einer CAM-Pflanze PEP: Phosphenolbrenztraubensäure (C3-Molekül) verändert nach: Scharf, K. H., Weber, W., Stoffwechselphysiologie, Materialien für den Sekundarbereich II, SchroedelVerlag, Hannover 1999, S.120, Abbildung 120.1 Abbildung 3.2 Tages- und Nachtgänge des Äpfelsäure- (Malat- und Stärkegehaltes einer CAMPflanze Aus urheberrechtlichen Gründen kann das Diagramm (Abb. 3.2) hier nicht veröffentlicht werden. Sie finden es unter (untere Abbildung auf der Seite) Seite 6 von 6 Hessisches Kultusministerium Landesabitur 2008 Biologie Leistungskurs Thema und Aufgabenstellung Vorschlag C1 Hinweise für den Prüfling Einlese- und Auswahlzeit (insgesamt): Bearbeitungszeit (insgesamt): 30 Minuten 240 Minuten Auswahlverfahren Es gibt drei Aufgabengruppen A, und C, aus denen insgesamt 2 Vorschläge zu bearbeiten sind. Aus einer der Gruppen hat Ihre Prüferin Ihr Prüfer einen Vorschlag für Sie ausgewählt. Aus den verbleibenden beiden Gruppen steht je ein Vorschlag zur Auswahl, einer dieser Vorschläge ist auszuwählen und zu bearbeiten. Der nicht ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehrkraft zurückgegeben werden. Erlaubte Hilfsmittel Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung Sonstige Hinweise keine In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen Name: Vorname: Prüferin Prüfer: Datum: Seite 1 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag C1 Verhaltensbiologie Lerndispositionen bei Ratten Aufgaben 1. Beschreiben Sie die Grundformen der klassischen und der operanten Konditionierung. (8 BE) 2. Beschreiben und interpretieren Sie die Versuchsergebnisse aus Material 2 und übertragen Sie Ihre Erkenntnisse auf die notwendigen Eigenschaften eines Giftköders zur Rattenbekämpfung in Wohngebieten (Material 1 und 2). (18 BE) 3. Entwickeln Sie eine Fragestellung, die den Experimenten in Material 2 zugrunde liegt, und erläutern Sie die Details der Versuchsbedingungen im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Lernformen (Material 3 und 4). (16 BE) 4. Werten Sie die Versuchsergebnisse als Kosten-Nutzen-Analyse aus und diskutieren Sie mögliche ultimate Ursachen für die im Experiment beobachtete Lernfähigkeit. (8 BE) Seite 2 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag C1 Material 1 In der Verhaltensbiologie ist die Ratte ein beliebtes Untersuchungsobjekt. Mit ihr sind zahlreiche Lernexperimente durchgeführt worden. Ratten zeichnen sich durch recht einfache Haltungsbedingungen, schnelle Vermehrung und hohe Lernfähigkeit aus. Diese Lernfähigkeit kann man auch bei freilebenden Ratten beobachten: Ratten besiedeln fast alle Lebensräume der Erde, sie fressen fast alle Nahrung. Dabei sichern sie sich effektiv ab. In Rattenverbänden gibt es z.B. „Vorkoster. Das sind Tiere, an denen die Auswirkungen des Verzehrs unbekannter Nahrung von den übrigen Ratten des Verbandes beobachtet werden. Bis eine unbekannte Nahrung zum „allgemeinen Verzehr freigegeben wird, können mehrere Tage vergehen, in denen die Vorkoster beobachtet werden. Material 2 MILLER und DOMJAN führten 1981 aus heutiger Sicht problematische Experimente zum Lernverhalten von Ratten durch. Die Versuchstiere wurden in zwei Hauptgruppen eingeteilt, eine „Lichtgruppe (L-Gruppe) und eine „Süßstoffgruppe (S-Gruppe). Jede Hauptgruppe setzte sich aus drei Untergruppen von jeweils 5-7 Tieren zusammen. Alle Tiere wurden zunächst an die Versuchssituation gewöhnt und lernten z.B., in einer kleinen Kammer an zwei Trinknippeln zu trinken. Anschließend wurden sie während eines Trinkvorgangs folgendermaßen behandelt: 1. Die Lichtgruppen In einem einmaligen Versuch für alle Tiere der drei L-Untergruppen L-1 bis L-3 (für jedes Tier einzeln) löste das Lecken an beiden Saugnippeln jedes Mal ein kurzes Aufleuchten einer Glühlampe aus. Eine Minute nach dem ersten Wasserlecken erhielten die Tiere der L-1 Teilgruppe einen leichten elektrischen Schlag, die Tiere der L-2 Teilgruppe eine Injektion mit Lithiumchloridlösung (LiCl) und die Tiere der L-3 Teilgruppe die Injektion einer physiologischen Kochsalzlösung (NaCl). LiCl-Lösung führt nach der Injektion zu Übelkeit, die Kochsalzlösung-Injektion hat keine physiologischen Auswirkungen. – Material 3 zeigt die genaue Versuchsanordnung. Einige Tage nach dem – einmaligen – Versuch erhielten die Tiere der Lichtgruppen 10 Minuten lang die Möglichkeit, an zwei Saugnippeln Wasser zu trinken. Die Saugnippel waren in dieser Versuchsphase unterschiedlich ausgestattet: ein Nippel wurde beim Trinken mit dem schwachen Lichtreiz kombiniert, der andere bot nur Wasser, ohne Licht. Die Wassermengen, die in diesem 10-Minuten-Versuch an den jeweiligen Nippeln aufgenommen wurden, sind in einem Säulendiagramm dargestellt (Material 4: „Reiznippel gegen „Neutralnippel). 2. Die Süßstoffgruppen In einem einmaligen Versuch für alle Tiere der drei S-Untergruppen S-1 bis S-3 (für jedes Tier einzeln) erhielten die Versuchstiere an den Saugnippeln Wasser mit einem Zusatz von Süßstoff. Anschließend wurden sie den gleichen Bedingungen ausgesetzt wie die Tiere der Lichtgruppe. Das heißt, eine Minute nach dem ersten Wasserlecken erhielten die Tiere der S-1 Teilgruppe einen elektrischen Schlag, die Tiere der S-2 Teilgruppe eine Injektion mit Lithiumchloridlösung und die Tiere der S-3 Teilgruppe eine Injektion mit physiologischer Kochsalzlösung. – Material 3 zeigt auch für die S-Gruppen die genaue Versuchsanordnung. Seite 3 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag C1 Einige Tage nach dem einmaligen Versuch wurde das Trinkverhalten auch der Süßstoffgruppe (wiederum für jedes Tier einzeln) unter vergleichbaren Bedingungen getestet. Die Tiere der S-Gruppe bekamen 10 Minuten lang die Möglichkeit, an zwei Saugnippeln Wasser zu trinken. Auch in der S-Gruppe waren die Saugnippel in dieser Versuchsphase unterschiedlich ausgestattet: ein Nippel bot Süßstofflösung, der andere nur Wasser. Die Wassermengen, die in diesem 10-Minuten-Versuch an den jeweiligen Nippeln aufgenommen wurden, sind in einem Säulendiagramm dargestellt (Material 4: „Reiznippel gegen „Neutralnippel). verändert nach: Neumann, G. H., Scharf K. H.(Hrsg.), Verhaltensbiologie, Aulis-Verlag, Köln 1994, S. 113/114 Material 3 Versuchsanordnung Versuchs gruppe L1 L2 L3 S1 S2 S3 Reizsituation beim Trinken ab Trinkbeginn Nach 1 Minute Licht leichter elektrischer Schlag Licht Injektion von Lithiumchlorid-Lösung Licht Injektion von Kochsalz-Lösung Süßstoff leichter elektrischer Schlag Süßstoff Injektion von Lithiumchlorid-Lösung Süßstoff Injektion von Kochsalz-Lösung (Erläuterung: Eine Lithiumchloridlösung-Injektion führt zu Übelkeit, eine KochsalzlösungInjektion hat keine physiologische Wirkung) verändert nach: Neumann, G. H., Scharf K. H. (Hrsg.), Verhaltensbiologie, Aulis-Verlag, Köln 1994, S. 113/114 Seite 4 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag C1 Material 4 Flüssigkeitsaufnahme in 10 Minuten bei verschiedenen Angeboten bei den Süßstoffgruppen (S-Gruppen) und den Lichtgruppen (L-Gruppen) Die Säulen geben an, wie viel Flüssigkeit im „Test nach wenigen Tagen im Zeitraum von 10 Minuten in den einzelnen Versuchsgruppen L1 bis S3 getrunken wurde a) am „Reiznippel (jeweils linke Säule) bzw. b) am „Neutralnippel (jeweils rechte Säule). Die Mengenangaben 0 bis 100 sind relative Mengeneinheiten. Lichtreizgruppen Süßstoffgruppen verändert nach: Neumann, G. H., Scharf K. H. (Hrsg.), Verhaltensbiologie, Aulis-Verlag, Köln 1994, S. 113/114 Seite 5 von 5 Hessisches Kultusministerium Landesabitur 2008 Biologie Leistungskurs Thema und Aufgabenstellung Vorschlag C2 Hinweise für den Prüfling Einlese- und Auswahlzeit (insgesamt): Bearbeitungszeit (insgesamt): 30 Minuten 240 Minuten Auswahlverfahren Es gibt drei Aufgabengruppen A, und C, aus denen insgesamt 2 Vorschläge zu bearbeiten sind. Aus einer der Gruppen hat Ihre Prüferin Ihr Prüfer einen Vorschlag für Sie ausgewählt. Aus den verbleibenden beiden Gruppen steht je ein Vorschlag zur Auswahl, einer dieser Vorschläge ist auszuwählen und zu bearbeiten. Der nicht ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehrkraft zurückgegeben werden. Erlaubte Hilfsmittel Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung Sonstige Hinweise keine In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen Name: Vorname: Prüferin Prüfer: Datum: Seite 1 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag C2 Verhaltensbiologie „Schamhafte Mimose und Narkose Aufgaben 1. Beschreiben Sie die Entstehung und den Verlauf eines Aktionspotenzials an einem Neuron und vergleichen Sie den Graphen aus Material 1, Abbildung 1.2, zum Ruhe- und Aktionspotenzial einer pflanzlichen Zelle mit dem Ruhe- und Aktionspotenzial eines Neurons. (18 BE) 2. Erklären Sie anhand der Ionenwanderungen durch die Membran einer Pflanzenzelle die Auslösung und den Verlauf eines pflanzlichen Aktionspotenzials und entwickeln Sie eine Hypothese zur katalytischen Wirkung der daran beteiligten Calciumionen (Material 1). (18 BE) 3. Beschreiben Sie die narkotisierende Wirkung von Ether auf eine tierische Zelle und entwickeln Sie eine Hypothese zur narkotisierenden Wirkung von Ether auf erregbare pflanzliche Zellen (Material 2). (14 BE) Seite 2 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag C2 Material 1 Wenn man die Pflanze Mimosa pudica (Schamhafte Mimose) berührt, reagiert die Pflanze mit dem Einknicken der Blätter. Der Volksmund hat daraus das Sprichwort entwickelt, dass ein Mensch empfindlich wie eine Mimose sei. Das Einknicken der Mimosenblätter ist ein Beispiel für relativ schnell ablaufende Bewegungen bei Pflanzen. Die Abbildung 1.1 zeigt die Schamhafte Mimose im ungereizten und gereizten Zustand. Es handelt sich um einen etwa 30-50 cm hohen stacheligen Halbstrauch. Seine Blattbewegungen werden an seinem natürlichen Standort durch starke Winde oder heftige Regengüsse hervorgerufen. Die Bewegungsreaktion wird durch Aktionspotenziale ausgelöst, die ähnlich wie bei tierischen Zellen auch an Pflanzenzellen auftreten können. Diese Aktionspotenziale breiten sich bei der Pflanze über die Leitbündelstrukturen mit einer Geschwindigkeit von 2 10 cm pro Sekunde aus. Ein „pflanzliches Aktionspotenzial wird in der Abbildung 1.2 gezeigt. Calcium-Ionen sollen – nach neuesten Forschungen – in den ersten Sekunden der Depolarisation eine Art katalytischer Wirkung für Chloridionen-Kanäle haben; Calciumionenbewegungen sind in Abbildung 1.2 nicht aufgeführt. Unterhalb der Messkurve des pflanzlichen Aktionspotenzials (Abbildung 1.2) sind die aktiven und passiven Ionenbewegungen von Chlorid- und Kaliumionen während des Aktionspotenzials wiedergegeben. Abbildung 1.1 Schamhafte Mimose Jaenicke, J., Materialienhandbuch Kursunterricht Biologie, Aulis-Verlag, Köln 1999, S. 316 Seite 3 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag C2 Abbildung 1.2 Verlauf eines pflanzlichen Aktionspotenzials und zugehöriger Ionenbewegungen Geschlängelte Linie aktiver Transport Dicker Pfeil: Zeitpunkt der Reizung pl: Plasmalemma Zellmembran verändert nach: Nultsch W., Allgemeine Botanik, Thieme Verlag, Stuttgart 1996, Seite 523 Material 2 Mimosen lassen sich wie tierische Lebewesen narkotisieren. Wird eine Mimosenpflanze für etwa 10 Minuten in einer Kammer mit gesättigter Ether-Atmosphäre gehalten, führt eine Berührung der Blätter nicht mehr zu der typischen Blattbewegung. Nach etwa einer halben Stunde in normaler Atmosphäre ist die Mimose wieder wie gewohnt erregbar. Bei Ether handelt es sich um eine unpolare, fettlösliche, leicht flüchtige Substanz, die nachfolgend im Modell dargestellt wird. Abbildung 2.1 Kalottenmodell eines Ethers Seite 4 von 5 Hessisches Kultusministerium Biologie Leistungskurs Landesabitur 2008 Thema und Aufgabenstellung Vorschlag C2 Abbildung 2.2 Wirkung des Ethers auf die Membran einer erregbaren tierischen Zelle oben: erregte Membran im „Normalzustand unten: Membran nach Zugabe von Ether Seite 5 von 5