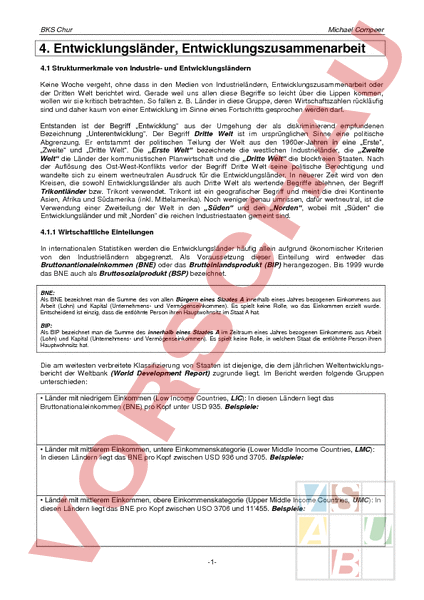Arbeitsblatt: Entwicklungsländer, Entwicklungszusammenarbeit
Material-Details
Grundlagen zu Entwicklungsländern und der Entwicklungszusammenarbeit
Geographie
Gemischte Themen
12. Schuljahr
27 Seiten
Statistik
115106
1551
35
17.04.2013
Autor/in
Michael Compeer
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
BKS Chur Michael Compeer 4. Entwicklungsländer, Entwicklungszusammenarbeit 4.1 Strukturmerkmale von Industrie- und Entwicklungsländern Keine Woche vergeht, ohne dass in den Medien von Industrieländern, Entwicklungszusammenarbeit oder der Dritten Welt berichtet wird. Gerade weil uns allen diese Begriffe so leicht über die Lippen kommen, wollen wir sie kritisch betrachten. So fallen z. B. Länder in diese Gruppe, deren Wirtschaftszahlen rückläufig sind und daher kaum von einer Entwicklung im Sinne eines Fortschritts gesprochen werden darf. Entstanden ist der Begriff „Entwicklung aus der Umgehung der als diskriminierend empfundenen Bezeichnung „Unterentwicklung. Der Begriff Dritte Welt ist im ursprünglichen Sinne eine politische Abgrenzung. Er entstammt der politischen Teilung der Welt aus den 1960er-Jahren in eine „Erste, „Zweite und „Dritte Welt. Die „Erste Welt bezeichnete die westlichen Industrieländer, die „Zweite Welt die Länder der kommunistischen Planwirtschaft und die „Dritte Welt die blockfreien Staaten. Nach der Auflösung des Ost-West-Konflikts verlor der Begriff Dritte Welt seine politische Berechtigung und wandelte sich zu einem wertneutralen Ausdruck für die Entwicklungsländer. In neuerer Zeit wird von den Kreisen, die sowohl Entwicklungsländer als auch Dritte Welt als wertende Begriffe ablehnen, der Begriff Trikontländer bzw. Trikont verwendet. Trikont ist ein geografischer Begriff und meint die drei Kontinente Asien, Afrika und Südamerika (inkl. Mittelamerika). Noch weniger genau umrissen, dafür wertneutral, ist die Verwendung einer Zweiteilung der Welt in den „Süden und den „Norden, wobei mit „Süden die Entwicklungsländer und mit „Norden die reichen Industriestaaten gemeint sind. 4.1.1 Wirtschaftliche Einteilungen In internationalen Statistiken werden die Entwicklungsländer häufig allein aufgrund ökonomischer Kriterien von den Industrieländern abgegrenzt. Als Voraussetzung dieser Einteilung wird entweder das Bruttonantionaleinkommen (BNE) oder das Bruttoinlandsprodukt (BIP) herangezogen. Bis 1999 wurde das BNE auch als Bruttosozialprodukt (BSP) bezeichnet. BNE: Als BNE bezeichnet man die Summe des von allen Bürgern eines Staates innerhalb eines Jahres bezogenen Einkommens aus Arbeit (Lohn) und Kapital (Unternehmens- und Vermögenseinkommen). Es spielt keine Rolle, wo das Einkommen erzielt wurde. Entscheidend ist einzig, dass die entlöhnte Person ihren Hauptwohnsitz im Staat hat. BIP: Als BIP bezeichnet man die Summe des innerhalb eines Staates im Zeitraum eines Jahres bezogenen Einkommens aus Arbeit (Lohn) und Kapital (Unternehmens- und Vermögenseinkommen). Es spielt keine Rolle, in welchem Staat die entlöhnte Person ihren Hauptwohnsitz hat. Die am weitesten verbreitete Klassifizierung von Staaten ist diejenige, die dem jährlichen Weltentwicklungsbericht der Weltbank (World Development Report) zugrunde liegt. Im Bericht werden folgende Gruppen unterschieden: • Länder mit niedrigem Einkommen (Low Income Countries, LlC): In diesen Ländern liegt das Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf unter USD 935. Beispiele: • Länder mit mittlerem Einkommen, untere Einkommenskategorie (Lower Middle Income Countries, LMC): In diesen Ländern liegt das BNE pro Kopf zwischen USD 936 und 3705. Beispiele: • Länder mit mittlerem Einkommen, obere Einkommenskategorie (Upper Middle lncome Countries, UMC): In diesen Ländern liegt das BNE pro Kopf zwischen USO 3706 und 11‘455. Beispiele: -1- BKS Chur Michael Compeer • Länder mit hohem Einkommen (High Income Countries. HIC): In diesen Ländern liegt das BNE pro Kopf über USD 11‘455. Beispiele: Als Reaktion auf die grossen Unterschiede innerhalb der Entwicklungsländer (Developing Countries) hat die UNO zwei besondere Gruppen ausgeschieden. Dabei werden neben dem Einkommen sowohl weitere wirtschaftliche als auch soziale Kriterien berücksichtigt. Die beiden Ländergruppen sind: Am wenigsten entwickelte Länder (Least Developed Countries, LDC). Als LDC gelten momentan rund 50 Länder. Beispiele: Bangladesch, Madagaskar, Mauretanien, Sudan Kriterien: a) Bruttonationaleinkommen pro Kopf im Dreijahres-Durchschnitt von weniger als 905 USD b) soziale Merkmale wie Gesundheit und Bildung c) Verwundbarkeit von Gesellschaften sie orientiert sich an den Exporten, der Instabilität der Exporterlöse, der Agrarproduktion und dem Anteil von verarbeitender Industrie und Dienstleistungen am BIP. Schwellenländer (Newly Industrialized Countries, NIC). Am bekanntesten ist dabei die Liste der Weltbank und des internationalen Währungsfonds, die jeweils zehn Länder als Schwellenländer bezeichnen. Aktuell sind dies: Brasilien, China, Indien, Malaysia, Mexiko, Philippinen, Russland, Südafrika. Thailand und die Türkei Kriterien: a) überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum b) starke und leistungsfähige Industrie c) hohe Produktivität bei relativ tiefem Lohnniveau d) Nutzung von Nischen des Weltmarktes, Export von Fertigwaren e) das Pro-Kopf-Einkommen liegt bei über 700 USD Kritikpunkte an der Aufteilung aufgrund des BNE: Eine weitere häufig verwendete Einteilung basiert auf der Kaufkraft. Die Kaufkraftparität bringt das durchschnittliche Einkommen in Beziehung zu den Preisen der Güter, d.h., wie viel kann man sich für sein Geld leisten. Obwohl die Löhne, z.B. in Oman, viel tiefer sind als in der Schweiz, kann man sich in etwa die gleiche Menge Waren und Dienstleistungen kaufen, denn die Preise sind entsprechend tiefer. -2- BKS Chur Michael Compeer Abbildung 1: Kaupkraftparität pro Kopf (2006) 4.1.2 Index des menschlichen Entwicklungsstandes Seit 1990 propagiert die UNO die Verwendung des Indexes des menschlichen Entwicklungsstands (Human Development Index, HDI) zur Messung von Entwicklung. Dieser gibt verlässlichere und aufschlussreichere Hinweise zur Lebenssituation der Bevölkerung eines Landes als ein einzelner Indikator wie jener des BNE. Der Index beinhaltet drei Komponenten der menschlichen Entwicklung: • Lebenserwartung: ein langes und gesundes Leben, gemessen an der Lebenserwartung bei der Geburt • Bildung: gemessen an der Alphabetisierungsrate der Erwachsenen (Gewichtung 2/3) und dem Anteil der Einschulung in allen drei Stufen der Bildung (Gewichtung 1/3) • Lebensstandard: gemessen an der Kaufkraftparität pro Kopf in USD Die Methode besteht darin, die Variable, z.B. Lebenserwartung x in einen Wert ohne Masseinheit zwischen 0 und 1 zu überführen. Der Durchschnitt der drei Teilindices ergibt dann den HDl. Dafür wird folgende Formel verwendet: Dabei sind der Minimalwert und der Maximalwert die von der UNO festgelegten tiefsten bzw. die höchsten Werte, welche erreicht werden können. Tabelle 1: Höchst- und Tiefstwerte zur Berechnung des HDl -3- BKS Chur Michael Compeer Abbildung 2: HDI-Weltkarte mit Daten von 2011 Ein Wert unter 0.5 zeichnet einen tiefen Entwicklungsstand aus. Zahlreiche Länder dieser Gruppe liegen in Afrika, mit der Ausnahme von Afghanistan, Nepal, Haiti und dem Jemen. (Quelle: Wikipedia) Kritik am Konzept des HDI Aufgabe 1: Berechnen Sie den HDI-Wert für die vier unten angefügten Staaten auf drei Kommastellen genau. Land LE [Jahre] Alphabet [%] Schule [%] LS [USD] Japan 82.70 99.00 99.91 34278.00 Marokko 71.20 61.50 86.05 4986.00 Madagaskar 59.40 70.70 49.60 972.00 Sierra Leone 42.60 40.90 43.28 877.00 Index LE Index Alphabet Index Schule Index Index LS HDI 4.1.3 Vergleich von Industrie- und Entwicklungsländern Meist stehen bei Vergleichen von Industrie- und Entwicklungsländern die wirtschaftlichen Aspekte im Vordergrund. Dies bringt die Lebenswirklichkeit der Menschen aber nur sehr schlecht zum Ausdruck und ist sehr selektiv. Soll eine umfassendere Sicht erfolgen, müssen auch naturgeografische, politische, kulturelle und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt werden. Aber auch dann kann es nur eine Annäherung bleiben, denn die Unterschiede innerhalb der Ländergruppen sind sehr gross. Folgende Merkmale können als Richtschnur gelten. -4- BKS Chur Michael Compeer Die wichtigsten Merkmale von Entwicklungsländern Eine detailliertere Liste -5- BKS Chur Michael Compeer 4.2 Entwicklungstheorien- und Strategien Im Zusammenhang mit dem Begriff „Entwicklung lassen sich zwei Hauptfragen stellen: 1.) Was sind die Ursachen für die Unterentwicklung? 2.) Wie können Entwicklungsdefizite beseitigt werden? 4.2.1 Endogene oder exogene Ursachen Die Entwicklungstheorien untersuchen die Ursachen für die heutige wirtschaftliche schlechte Lage und geringe Entwicklung der Entwicklungsländer. Die Vielzahl von Theorien lässt sich im Wesentlichen einteilen in endogene und exogene. • Die endogenen Theorien vertreten die Ansicht, dass die heutige Lage der Länder hauptsächlich durch innere Gegebenheiten (wie Korruption und veraltete Strukturen) bedingt ist. • Die exogenen Theorien hingegen gehen davon aus, dass die Gründe ausserhalb der Länder zu suchen sind, konkret in der Ausbeutung durch die Industrieländer. Aufgabe 2: Lesen Sie die Texte zu den verschiedenen Theorien aufmerksam durch. Die Begriffsliste unten hilft für das Verständnis der Texte. endogen exogen geodeterministisch Dependenz Subsistenz Tribalismus Dollarimperialismus Feudalismus Rentenkapitalismus Dualismus Disparität peripher peripherer Beharrungsraum von innen kommend von aussen kommend vom Naturraum der Erde bestimmt „geo Erde; „determinieren bestimmen Abhängigkeit Selbstversorgung Stammesbewusstsein Nordamerikanisch Konzerne gewinnen als Geldgeber von industriellen Projekten wirtschaftlichen und politischen Einfluss, auch beim Abbau von Bodenschätzen oder der Vermarktung agrarischer Produkte. System, bei welchem Bauer, Pächter und Landarbeiter wirtschaftlich und persönlich vom Grossgrundbesitzer abhängig sind. Kapitalistische Wirtschaftsform, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Besitzer von Produktionsmitteln diese verpachtet und einen übergrossen Anteil des Gewinnes abschöpft, ohne wieder in den Betrieb zu investieren. Oft stellt der Grossgrundbesitzer Grund, Wasser, Geräte, Saatgut und Dünger zur Verfügung und kassiert dafür vier Fünftel der Ernte vom Pächter, dem nur ein Fünftel für den Einsatz seiner Arbeitskraft bleibt. Gegensätzlichkeit Ungleichheit am Rande Abgelegenes Gebiet, in dem alte, traditionelle Wirtschaftsformen erhalten geblieben sind; in Europa z.B. Formen der Bergbauern A) Die geodeterministische Theorie der Unterentwicklung (endogen): Dieser Ansatz geht davon aus, dass bereits das naturräumliche Potential eines Landes für dessen geringen Entwicklungsstand verantwortlich sein kann. Folgende Beispiele sollen dies zeigen: Eine Binnenlage erzeugt Abhängigkeit und hohe Transportkosten, behindert also den Aussenhandel eines Staates erheblich. • Beispiel Sambia: Kupferexport über Tansania oder Südafrika. • Beispiel Niger, Tschad: Teure Transporte der agrarischen Exportprodukte. Fehlende Ressourcen, also Rohstoffe oder Energieträger machen Länder von teuren Importen abhängig. Zudem fehlt auch weitgehend die Möglichkeit, durch Exporte Kapital zu erwerben. Staaten der Sahelzone sowie Kenia oder Tansania besitzen praktisch keine vermarktbaren Bodenschätze. Klimatische Ursachen, Dürren, schwankende Niederschlagsmengen, aber auch ständige Überschwemmungen verringern das agrarische Potential erheblich. Betroffen sind die Staaten der Sahelzone von der Trockenheit oder Bangladesch von regelmässigen katastrophalen Überschwemmungen während der Zeit des Sommermonsuns. Die nährstoffarmen tropischen Böden mindern die Möglichkeit der Landwirtschaft in Zentralafrika oder in den Regenwaldregionen des Amazonasbeckens. -6- BKS Chur Michael Compeer B) Die Modernisierungstheorie (endogen): Die Modernisierungstheorie versteht die Unterentwicklung eines Landes als Ergebnis endogener Ursachen, also im Lande selbst begründet. Die Rückständigkeit basiert in erster Linie auf traditionellen Verhaltensweisen der Bevölkerung oder auf traditionsverhafteten Gesellschafts- oder Wirtschaftsformen. Eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung kann nach dieser Auffassung nur stattfinden, wenn sich das Land und seine Menschen von den eigenen Traditionen und Strukturen lösen und sich wirtschaftlichen, sozialen und zivilisatorischen Vorbildern der westlichen Welt anpassen. Modernisierung bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich „Verwestlichung. Folgende Beispiele lassen sich für diese Theorie anführen: Das Paradebeispiel ist sicherlich Indien mit seinem berüchtigten „Kastenwesen, das die Mobilität und damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft erheblich beeinträchtigt. Nach traditioneller hinduistischer Auffassung legt die Geburt die Zugehörigkeit zu einer Kaste fest und damit ist die Position des Menschen für die Zeit dieses Lebens in der Gesellschaft festgelegt. Erst in einem „späteren Leben kann er kastenmässig auf- oder absteigen. Die indische Realität zeigt aber, dass sich das Kastenwesen unter wirtschaftlichem Druck auflöst, d.h., wirtschaftlich erfolgreiche Kasten können Angehörige höherer Kasten als Arbeiter oder Angestellte beschäftigen. C) Die Dependenztheorie (exogen): Die Dependenztheorie sieht im Gegensatz zur Modernisierungstheorie die Unterentwicklung als von aussen fehlgeleitete Entwicklung, also das Ergebnis exogener Prozesse. Diese Fehlentwicklung beginnt in den meisten Fällen mit der Kolonialzeit und setzt sich in Form verschiedener Abhängigkeiten der Entwicklungsländer von Industrieländern bis in die Gegenwart fort. Entwicklungsländer sind durch verschiedene Formen der Ausbeutung erst unterentwickelt worden. Die Dependenztheorie kann selbstverständlich auf alle ehemaligen Kolonien angewendet werden, da in den meisten dieser Gebiete kolonialzeitlich bedingte Strukturen erkennbar sind. Geldwirtschaft und Tauschhandel, exportorientierte und subsistenzorientierte Landwirtschaft existieren seit der Kolonialzeit oft nebeneinander und verhindern eine homogene wirtschaftliche Entwicklung. Entwicklungsländer werden oft von machtbewussten Gruppen beherrscht, die ihre Vormachtstellung der Zusammenarbeit mit der ehemaligen Kolonialmacht verdanken. Viele tribalistische, also stammesbedingte Auseinandersetzungen, sind das Ergebnis kolonialer Grenzziehungen, die auf Stammesräume keine Rücksicht nahmen. Die Ausbeutung der Bodenschätze und der Bevölkerung in den Kolonien ohne wirtschaftlichen Aufbau ist eine typische Erscheinung dieser Phase. Aber auch moderne Abhängigkeiten der Entwicklungsländer von privaten oder staatlichen Geldgebern erfasst die Dependenztheorie, z.B. die Formen des „Dollarimperialismus in den Staaten Süd- und Mittelamerikas. Bedeutend besonders im agrarischen Bereich sind die feudalistischen und rentenkapitalistischen Strukturen im islamischen Raum. Grossgrundbesitzer und Besitzer von Produktionsanlagen schöpfen die Gewinne ab, ohne produktiv zu investieren. Die ausgebeuteten Pächter haben kein Interesse an wirtschaftlicher Leistung. D) Die Dualismustheorie (endogen und exogen): Dualismustheorien sind eigentlich keine eigenständigen Theorien, weil die dualistischen und disparitätischen Strukturen im Raum, in Gesellschaft und Wirtschaft unterentwickelter Länder meistens nicht die Ursachen, sondern das Ergebnis vor allem exogener Vorgänge sind. Vielmehr sind sie auf die Modernisierungs- oder die Dependenztheorie zurückzuführen. Dualismen und Disparitäten sind fast schon typische Erscheinungen in den Ländern der dritten Welt. Folgende Beispiele belegen diese Aussage: • Der Gegensatz zwischen hochentwickelten Städten und unterentwickelten ländlichen Gebieten. • Wirtschaftlich starke Küstenregionen und unterentwickelte Hinterländer im Inneren. • Agrarische Gunstgebiete mit moderner, exportorientierter Landwirtschaft auf Grossplantagen und subsistenzorientierte Kleinstbetriebe innerhalb eines Staates. • Touristische Wachstumsräume und periphere Beharrungsräume in unmittelbarer Nachbarschaft. -7- BKS Chur Michael Compeer Aufgabe 3: Mali ist einer der ärmsten Staaten der Erde. Versuchen Sie, die Unterentwicklung dieses Landes mittels der verschiedenen Theorien stichwortartig zu erklären. a) Geodeterminismustheorie Hilfsmittel: Atlas (S. 97, 98, 100, 101): Lage des Staates, Krankheiten, Klima, Rohstoffe, usw. b) Moderniserungstheorie Hilfsmittel: Atlas (S. 101), Bilder und Fakten zu Mali, Zeitungsartikel 1 c) Dependenztheorie Hilfsmittel: Atlas (S. 96, 101), Zeitungsartikel 1, Zeitungsartikel 2 d) Dualismustheorie Hilfsmittel: Bilder und Fakten zu Mali, Atlas (S. 97, 100, 101) -8- BKS Chur Michael Compeer Abbildung 3: Bilder und Fakten zu Mali Landwirtschaft im Norden von Mali Landwirtschaft im Süden von Mali The capital Bamako Bank Markt in Bamako Monument de la Paix, Bamako Grosse Moschee von Djenné Gesundheit Mehr als ein Drittel der Bevölkerung hat keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 48,1 Jahren. Es gibt Mangelernährung sowie gravierende Probleme bei der Hygiene. Infektionskrankheiten wie Cholera und Tuberkulose können regelmässig auftreten. Bildung 47 der Kinder im schulpflichtigen Alter (7 bis 15 Jahre) besuchten im Jahre 2003 tatsächlich die Schule. 74 aller mindestens 15 Jahre alten Personen sind Analphabeten. Religion 80% Muslime 18% Naturreligionen 2% Christen Politik Mali galt bis zu einem Militärputsch im März 2012 als mehr oder weniger gelungenes Beispiel einer Demokratisierung in Afrika, ist aber eines der ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Die Staatsform des Landes ist eine semipräsidiale Republik, es hat ein semipräsidentielles Regierungssystem als Regierungsform. Die alle fünf Jahre gewählte Nationalversammlung umfasst 147 Abgeordnete und befindet sich in der Hauptstadt Bamako. Parlamentspräsident ist seit 2007 Dioncounda Traoré. Von mehr als 100 Oppositionsparteien sind 14 im Parlament vertreten. Handwerk und Industrie Mali verfügt nur in geringem Maße über Industrie. Während unmittelbar nach der Unabhängigkeit einige größere staatliche Unternehmen zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte aufgebaut wurden (Textilien, Zigaretten, Gemüsekonserven), gibt es heute nur noch kleine und einige mittelgrosse Verarbeitungsbetriebe. -9- BKS Chur Artikel 1 Michael Compeer Warum Afrika nicht Tritt fasst Die ärmsten Länder vermögen ihre Produkte Handelsschranken sind der Grund. TA (18.05.01) auf dem Weltmarkt schlecht abzusetzen. Von Peter Baumgartner, Nairobi Er lese die Kaffeebohnen noch ab, jammert der tansanische Kleinbauer Josua Mboketu in der Zeitung Daily News: Ich möchte nicht mit ansehen, wie sie an den grünen Büschen verfaulen. Josua stammt aus dem reizvollen und fruchtbaren Landstrich am Fusse des Kilimandscharo, wo Kaffee in hervorragender Qualität gedeiht. In den letzten drei Jahren ist der Kaffeepreis aber um 60 Prozent gefallen, und noch nie, seit Josua seine halbe Hektare bebaut, das sind immerhin drei Jahrzehnte, hat er so wenig Geld für ein Kilogramm Kaffeebohnen erhalten. Abschottung gegen die Armenhäuser Josuas Klage erinnert an Dieu-Donné, dem wir zur Zeit der Orangenernte in der Zentralafrikanischen Republik begegnet sind. Von den Früchten könnten wir ganz gut leben, sagte Dieu-Donné, aber der Transport ist wegen der lausigen Strassen teuer. Und selbst wenn es anders wäre: Die Früchte können nur auf den lokalen Märkten abgesetzt werden, weil es in unserem Land keine Infrastruktur zur Verarbeitung gibt. Das drückt die Preise. Josua und Dieu-Donné gehören zu jenen 630 Millionen Menschen, die in den 49 ärmsten Ländern der Welt leben, und von denen die meisten im letzten Jahrzehnt noch ärmer geworden sind. Die Konferenz von Paris hat der Armut 1990 den Kampf angesagt. Auch die ärmsten Länder, von denen 33 in Afrika liegen, sollten in den aufblühenden Welthandel einbezogen und so in der Entwicklung gefördert werden. Das Gegenteil war der Fall: Der Anteil der so genannten Least Developed Countries an den gesamten Weltexporten sank in den letzten zehn Jahren von 0,48 auf 0,4 Prozent. Auf Grund einer Studie der britischen Entwicklungsorganisation Oxfam entgingen diesen 49 Ländern pro Jahr gegen 4,7 Milliarden Franken an ausländischen Devisen: wegen der Handelsschranken der Industrieländer. Was 1990 als bevorzugte Behandlung mit allerlei Zollvorteilen deklariert wurde, beurteilt Oxfam als organisierte Räuberei. Uno, Weltbank, Welthandelsorganisation und viele andere drücken sich etwas diplomatischer aus, aber in der Grundaussage sind sich alle einig: Die reichen Länder haben sich gegen die Armenhäuser abgeschottet. Auch finanziell. Seit 1990 sind die Ausgaben für Entwicklungshilfe und zusammenarbeit um rund 5 Milliarden Franken gesunken. Die Aufwendungen pro Kopf der Bevölkerung liegen heute wieder auf dem Stand der frühen 70er-Jahre. Dabei haben die meisten der ärmsten Länder auf Druck von Weltbank und Internationalem Währungsfonds Handel und Währungspolitik liberalisiert, Zölle abgebaut und Einfuhrbestimmungen vereinfacht weit stärker als andere Entwicklungsländer. Es zahlte sich nicht aus, wie selbst Weltbank-Präsident James Wolfensohn in Brüssel einräumte. Afrika ist, trotz seiner enormen Bodenschätze, ein Agrarkontinent, da liegen seine Stärken. Aber die Preise für die wichtigsten Exportgüter Kaffee, Tee, Kakao, Baumwolle werden in den Industrieländern festgelegt. Während Bauer Josua nur noch ein Almosen für ein Kilogramm Kaffee erhält, vermelden die Handelskonzerne prächtige Gewinne. Auf dem Markt in Nairobi sind Peperoni aus Spanien zu kaufen, in Abidjan Zwiebeln aus Frankreich, ein Teil der Tomaten in senegalesischen Konserven stammt aus Italien, Getreide aus den USA hilft den amerikanischen Bauern und drückt die Preise in Kenya, und Fleisch aus Europa ist in ganz Westafrika zu finden. Die ungleichen Ellen Für das Phänomen sind die riesigen Subventionen verantwortlich, welche die Industrieländer in die Landwirtschaft pumpen. Sie belaufen sich auf rund 500 Milliarden Franken pro Jahr. Das ist laut WeltbankPräsident Wolfensohn das Fünffache des Geldstroms, der vom Norden in die Entwicklungsländer fliesst, und entspricht dem Bruttosozialprodukt aller afrikanischen Länder südlich der Sahara zusammen-genommen. Die Ausfuhren aus den Industrieländern profitieren zudem von Exportsubventionen: Das Resultat sind Niedrigpreise. Dritt-Welt-Produkte können da nicht mithalten. Darüber hinaus schützen die Industrieländer ihre Bauern vor unerwünschter Konkurrenz aus dem Süden durch zum Teil prohibitive Importzölle. Wenn die USA, die Europäische Union, Kanada und Japan ihre -10- BKS Chur Michael Compeer Handelsschranken aufheben würden, erklärte Wolfensohn, könnte der Handel aus den 49 ärmsten Ländern um zwölf Prozent ansteigen. Die Industriestaaten fördern auch die Wertschöpfung im eigenen Land: So dürfen die meisten landwirtschaftliche Produkte nur in Rohform eingeführt werden, verarbeitet werden sie im Norden. Europäische Reinheitsvorschriften, etwa beim Kakao, sind oft nichts anderes als verkappte Handelsschranken. Das führt dazu, dass die weltweit vertriebenen Endprodukte wiederum aus den Industriestaaten stammen und diese daran verdienen: in der Zentralafrikanischen Republik beispielsweise am Orangensaft. Dieu-Donnés Vater würde seine Orangen noch so gerne an eine Fruchtsaftfabrik liefern, wenn es eine gäbe. Doch neun Zehntel aller Investitionen in Schwarzafrika fliessen in die Erdölförderung und den Bergbau dorthin also, wo die unmittelbaren Interessen der Industriestaaten liegen. Eine kleine, aber gute Geste Die wachsende Armut ist freilich nicht nur dem ungleichen Handel anzulasten. Vielerorts erschwert eine schlechte oder inexistente Infrastruktur den Handel: Der Zustand so mancher Strasse verteuert den Transport, etwa der Orangen von Dieu-Donnés Vater. Eine Reihe der ärmsten afrikanischen Länder wird von Bürgerkriegen erschüttert. In vielen anderen verhindern Misswirtschaft, fehlende Planung und eine fast durchwegs diebische Elite, dass die breite Bevölkerung der Armutsfalle entkäme. Auch ist das Klima in weiten Teilen Afrikas eine wahre Geissel. Die Aufhebung aller Zollschranken für Exporte aus den 49 ärmsten Ländern ist zweifellos zu begrüssen. Freilich darf nicht übersehen werden, dass sie kaum mehr als eine schöne Geste ist, die wenig kostet (weniger jedenfalls als ein Schuldenerlass). Nach Berechnungen der Weltbank würde die völlige Aufhebung aller Handelsschranken die Industriestaaten rund 315 Millionen Franken jährlich kosten, das ist gut ein Fünftel dessen, was sie Tag für Tag an Subventionen in die eigene Landwirtschaft pumpen. Artikel 2 Eine Existenz nur dank Bundeshilfe Schweizer Zuckerproduzenten sind vor Importen geschützt. Dies schadet den Staaten, denen die Schweiz helfen will. Die Schweizer Zuckerproduzenten werden mit staatlicher Hilfe vom Weltmarkt abgeschottet. Bis vor wenigen Jahren wurden die zwei hiesigen Zuckerfabriken mit 45 Mio. Fr. jährlich subventioniert. Die wichtigste Handelsbarriere war ein Importzoll von 61 Rappen pro Kilo Zucker, wovon den Entwicklungsländern allerdings ein Teil erlassen wurde. Im Zuge der Liberalisierung des Welthandels sind diese staatlichen Subventionen ab 2011 zwar verboten. Weil die Preise des Schweizer Zuckers auf Weltmarktniveau gesenkt werden, musste der Bund sich etwas Neues einfallen lassen, um die einheimische Produktion aufrecht zu erhalten: Als Ersatz gibt es für die hiesigen Zuckerbauern jetzt 1900 Franken Direktzahlungen pro ha Zuckeranbau (Agrarreform AP 2011). Damit kann ein Teil des Preisrückgangs aufgefangen werden, zu welchem die Schweiz gemäss EUZuckermarktordnung verpflichtet ist. Die Schweizer Zuckerindustrie existiert nur dank der Hilfe vom Bund. Nur deshalb können die Schweizer Hersteller mit der ausländischen Konkurrenz mithalten. Auch in der EU werden die Zuckerbauern infolge des Preisrückgangs mit Flächenbeiträgen entschädigt. Die Hersteller im Norden freut es, die in der Dritten Welt hingegen leiden. Denn die Politik der Schweiz oder auch der EU blockiert ihnen den Zugang zu lukrativen Märkten. Moçambique zum Beispiel entgingen durch die staatliche Unterstützung der Industrieländer laut einer Studie der Hilfsorganisation Oxfam bis 2004 150 Millionen Franken an Einnahmen. Das sind drei Viertel des Betrages, den die EU jährlich als Entwicklungshilfe an das arme Land schickt, in dem 75% der ländlichen Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Die EU blockiert aber nicht nur den Import. Sie setzte bis vor kurzem auch ihre überschüssige Produktion billig im Ausland ab und verdrängte so die Exporte der Entwicklungsländer. 2001 exportierte die Union beispielsweise 150 000 Tonnen Zucker nach Nigeria und 120 000 nach Mauretanien. Die gesamten Exporte der EU in arme Länder waren dazumal zwölfmal grösser als die Importe aus diesen Staaten. Gegen diesen exportsubventionierten Zucker klagten nun Länder wie Brasilien Australien und Thailand bei der -11- BKS Chur Michael Compeer Welthandelsorganisation (WTO) und bekamen Recht. Die Folge ist eine massive Reduktion der EUProduktion. Damit hätte es laut Experten eigentlich zu einer Verknappung des Zuckerangebots auf dem Weltmarkt und einer entsprechenden Erhöhung der Weltmarktpreise kommen müssen. Davon hätten ärmere Entwicklungsländer wie Moçambique profitiert. Allerdings liess sich bislang kein signifikanter Anstieg der Weltmarktpreise für Zucker beobachten. Nutzniesser sind Länder wie Australien, Brasilien oder Thailand, die ihre Ausfuhren in den letzten Jahren deutlich steigern konnten – nicht gerade „klassische Entwicklungsländer. Allgemein gestattet die EU auch nur die Einfuhr von Rohzucker. Das verhindert in den Entwicklungsländern den Aufbau einer verarbeitenden Industrie mit qualifizierten Arbeitsplätzen. 2009 Aufgabe 4a: Die Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG ist ein Schweizer Zuckerproduzent. Erklären Sie am Beispiel des Zuckers, warum die Entwicklungsländer im Weltmarkt in den vergangenen Jahrzehnten benachteiligt waren. Aufgabe 4b: Erklären Sie am Beispiel des Zuckers, warum die Entwicklungsländer im Weltmarkt auch heute immer noch benachteiligt sind. 4.2.2 Strategien zur Förderung der Entwicklung A) Wachstumsstrategie: 1960er Jahre Die erste Phase der Entwicklungspolitik nach dem 2. Weltkrieg und der Zeit der Entkolonisierung ist mit der so genannten Wachstumsstrategie verknüpft. Sie geht davon aus, dass in erster Linie der Geldmangel der Entwicklungsländer die Industrialisierung verhindert. Entwicklungshilfe wurde deshalb als massive Kapitalzufuhr geleistet, auch in der Hoffnung, dass dieses Kapital nicht bei den oberen Schichten hängen bleibt, sondern zu den unteren Bevölkerungsteilen „durchsickert (Trickle Down- Effekt). Man glaubte, dass sich die Dritte Welt in einer Übergangsphase von der traditionellen zur Industriegesellschaft befände und ein -12- BKS Chur Michael Compeer starkes Wirtschaftswachstum auch die Gesellschaft modernisieren würde. In der Praxis förderte man vor allem die Industrie (sekundärer Sektor) mit kapitalintensiven industriellen Prestigeprojekten und vernachlässigte im Gegenzug Handwerk und Mittelstandsentwicklung und besonders die lebenswichtige Landwirtschaft (primärer Sektor). Die Hoffnung auf einen breit gefächerten Wachstumsprozess durch Kapital- und Know-How-Transfer erfüllte sich in den meisten Fällen nicht. Die vielen Beispiele von unausgelasteten, defekten der funktions-unfähigen Produktionsanlagen sprechen eine deutliche Sprache. Ein grosser Teil des Geldes kam nie dort an, wofür es bestimmt war. 1961 bestimmten die Vereinten Nationen, dass in diesem Jahrzehnt mit der Wachstumsstrategie folgende Entwicklungsziele erreicht werden sollen: Jährliches Wachstum des BSP um 5%, jährliches Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens um 3%, Steigerung der Industrieproduktion um 8%, Steigerung der Agrarproduktion um 4%, Verbesserung der Terms of Trade um 10%. B) Die Autozentrierte Entwicklung: 1970er Jahre Als eine alternative Entwicklungsstrategie wird von manchen Fachleuten auch die Möglichkeit einer Abkoppelung der Entwicklungsländer vom Weltmarkt und damit eine eigenständige, auf das jeweilige Land ausgerichtete Entwicklung vorgeschlagen. Notwendiger Preis ist dabei die Entwicklung eigener Produkte anstatt des Kaufs billiger Weltmarktprodukten. Die Abkoppelung soll dabei auf den Zeitraum begrenzt werden, der von der Dritten Welt benötigt wird, um einen gleichgewichtigen Warenaustausch mit den Industrieländern zu erreichen. Abkoppelung ist nicht als Autarkie ( Eigenständigkeit) zu verstehen, die ohnehin bei der Globalisierung unrealistisch ist und wenn überhaupt bestenfalls von Staaten mit extrem grossen Binnenmärkten wie China oder Indien erreichbar erscheint. Verstärkt soll die Zusammenarbeit zwischen Ländern gleichen Entwicklungsstands gefördert werden als Element kollektiver Eigenständigkeit (collective self-reliance). Das Konzept einer autozentrierten Entwicklung stösst bei den meisten betroffenen Ländern auf Ablehnung. Kritisch zu bewerten ist dabei auch die Tatsache, dass sich die Orientierung letztlich doch wieder auf den Weltmarkt und sein Niveau richtet, denn wenn dieses nicht erreicht werden kann, droht eine wirklich dauerhafte Abkoppelung oder eine erneute Abhängigkeit der Entwicklungsländer untereinander. C) Die neue Weltwirtschaftsordnung (NWWO): 1970er Jahre Die Zeit nach der grossen Ölkrise 1973 war geprägt von dem Schlagwort einer neuen Weltwirtschaftsordnung, NWWO. 1974 wurde von den Vereinten Nationen (UNO) diese Erklärung veröffentlicht: „Wir, die Mitglieder der Vereinten Nationen, verkünden feierlich unsere gemeinsame Entschlossenheit, nachdrücklich auf die Entwicklung einer neuen Weltwirtschaftsordnung hinzuwirken, die auf Gerechtigkeit, souveräner Gleichheit, gegenseitiger Abhängigkeit, gemeinsamem Interesse und der Zusammenarbeit aller Staaten ungeachtet ihres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systems beruht, die Ungleichheiten behebt und bestehende Ungerechtigkeiten beseitigt (). Hinter der NWWO steht die Forderung des Ausgleichs der Benachteiligungen der Dritten Welt als Ergebnis der kolonialen Ausbeutung und der postkolonialen Wirtschaftsstrukturen (vgl. Dependenztheorie). Die angestrebte Gleichheit kann aber nur durch eine zeitweise Vorzugsbehandlung der Entwicklungsländer erreicht werden. Als Ansatzpunkt für die Umsetzung der NWWO wurde das Rohstoffproblem gewählt. Zielsetzungen waren gerechtere und stabile Rohstoffpreise, die vermehrt in den Entwicklungsländern selbst verarbeitet werden und damit den Aufbau eigener Exportindustrien bewirken sollten. Zudem sollte der Marktzugang für Entwicklungsländerprodukte in den Industrieländern verbessert und die Behinderung der Fertigwarenexporte der Entwicklungsländer vermindert werden. Bei wachsendem Widerstand der Industrieländer gelang nur eine teilweise Verwirklichung der Ziele, insgesamt muss die NWWO als gescheitert betrachtet werden. D) Schuldenkrise/Schuldenerlass: Ab 1980er Jahre In den Achtziger Jahren wurden nicht nur ökonomische Grössen vorgegeben zur Förderung der Entwicklung, sondern auch sozial bezogene Ziele wie Verringerung der Kindersterblichkeit oder Verbesserung der Trinkwasserversorgung. Dieses Jahrzehnt begann aber mit einem globalen Wirtschaftsabschwung, so dass die Ziele vielfach unerreicht blieben und ein möglicher Zusammenbruch der Weltwirtschaft die Entwicklungspolitik beeinflusste. Das beherrschende Thema der Folgejahre war die Schuldenkrise. Die faktische Zahlungsunfähigkeit von Teilen der Dritten Welt gefährdete viele Banken und bedrohte das -13- BKS Chur Michael Compeer gesamte internationale Finanzsystem. Mit einzelbezogenen Umschuldungsaktionen und kleinen Schuldenerlassen gelang es, die Finanzkatastrophe abzuwenden, ohne das Grundproblem zu beseitigen. So ist die extrem hohe Auslandverschuldung vieler Entwicklungsländer noch heute ein wesentlicher Hemmschuh der Entwicklung, weil zu viel Geld in Zinsen (für die Rückzahlung von Darlehen) abfliesst, und die Schulden so nie zurückbezahlt werden können. Im Zuge des Jahrtausendwechsels wurde das Ziel eines Schuldenerlasses wieder aufgenommen und dann im Jahre 2005 in einem historischen Durchbruch für die ärmsten Entwicklungsländer beschlossen. An der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds wurden 18, v.a. afrikanischen Entwicklungsländern mit stabiler Wirtschaft und demokratischen Verhältnissen die Schulden (bei IWF, Weltbank, afrikanischer Entwicklungsbank etc.) erlassen. 20 weiteren Ländern werden in einer zweiten Runde die Schulden erlassen. E) Grundbedürfnisstrategie: Ab 1990er Jahre Spätestens in den Neunziger Jahren setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Entwicklungskonzepte sich vorrangig an den menschlichen Grundbedürfnissen orientieren sollen. Das Leitbild der Entwicklung ist die Verringerung der absoluten Armut und die Erfüllung der Grundbedürfnisse der Menschen. Massnahmen sind: • Erfüllung der Minimalbedürfnisse des persönlichen Konsums wie Ernährung, Wohnung, Kleidung, Heizung • Zugang zu wesentlichen Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen wie Trinkwasser, sanitäre Anlagen, Transporteinrichtungen, Gesundheitsversorgung, Ausbildungseinrichtungen • Befriedigung qualitativer Bedürfnisse wie Leben in einer gesunden Umwelt, Rechtssicherheit, Garantie der Menschenrechte • Entwicklung des landwirtschaftlichen Sektors • Förderung arbeitsintensiver Industrien • Binnenorientierte Entwicklung Die Erfüllung der menschlichen Grundbedürfnisse ist nicht nur aus humanitären Gründen unabdingbar, sondern auch Voraussetzung für die eigene wirtschaftliche Entwicklung. Dabei setzt man Eigeninitiative, Mitbestimmung und Mitverantwortung der Armen voraus, damit sie sich aus ihrer Abhängigkeit befreien und aus eigener Kraft helfen können („Hilfe zur Selbst-hilfe). 4.2.3 Eigene Zusammenfassung der Entwicklungsstrategien Strategien Kurzbeschreibung der Strategie Begründung der Strategie Vorteile Wachstumsstrategie Autozentrierte Entwicklung -14- Nachteile der Strategie Gründe für das Scheitern BKS Chur Strategien Michael Compeer Kurzbeschreibung der Strategie Begründung der Strategie Vorteile Nachteile der Strategie Gründe für das Scheitern Neue Weltwirtschaftsordnung (NWWO) Schuldenkrise/ Schuldenerlass Grundbedürfnisstrategie 4.3 Die Entwicklungszusammenarbeit als Umsetzung der Entwicklungsstrategien Als Entwicklungszusammenarbeit (früher auch Entwicklungshilfe genannt) bezeichnet man die gemeinsamen Bemühungen von IL und EL, die globalen Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung und den allgemeinen Lebensbedingungen abzubauen. Die Bedingungen sollen dabei dauerhaft und nachhaltig verbessert werden. Der bis in die 1990er-Jahre hinein verwendete Begriff der Entwicklungshilfe geht auf das Jahr 1961 zurück, als die Organisation für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gegründet wurde. Sie machte es sich zu ihrer Aufgabe, die Entwicklungshilfe international zu koordinieren und unter den Mitgliedsländern besser abzustimmen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es nur die finanzielle Hilfe an ehemalige Kolonien gegeben, welche in die Unabhängigkeit entlassen worden waren. Die frühe Entwicklungshilfe der 1960er- bis 1980er-Jahre war nicht von Partnerschaftlichkeit geprägt, sondern widerspiegelte die dominierende Rolle der IL in Know-how und finanzieller Kraft. Seit den 1990erJahren hat sich die Hilfe zur Entwicklungszusammenarbeit gewandelt, bei der der Meinung der Vertreter der EL bedeutend mehr Gehör geschenkt wird. Ein Zeichen dieser Entwicklung ist, dass z.B. die DEZA (Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit) den Begriff „Entwicklungsland ganz vermeidet zugunsten des Begriffs „Partnerland. -15- BKS Chur Michael Compeer Aufgabe 5: Überlegen Sie sich je eine Begründung der Entwicklungszusammenarbeit aus den folgenden vier Perspektiven: historisch ethisch demografisch wirtschaftlich 4.3.1 Formen und Arten der Entwicklungszusammenarbeit Generell unterscheidet man drei Formen der Entwicklungszusammenarbeit: A) Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit: Dabei unterstützt eine Gruppe von Ländern mehrere EL. B) Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit: Dabei unterstützt ein Land ein anderes Land ganz gezielt. C) Private Entwicklungszusammenarbeit: Hierbei unterstützen private Organisationen Projekte in EL. Sie arbeiten unabhängig von Regierungsstellen und werden deshalb nichtstaatliche Organisationen genannt. Bei der Art der Entwicklungszusammenarbeit geht es um die Art der Unterstützung. Dabei ist die Entwicklungszusammenarbeit, die eine längerfristige Aufbauarbeit verfolgt, klar von der kurzfristigen humanitären Hilfe zu unterscheiden, die bei Naturkatastrophen und Kriegen zum Zuge kommt, wenn z.B. Hunger droht. Die wichtigsten Arten der Entwicklungszusammenarbeit sind: • Medizinische Hilfe und Gesundheitsvorsorge • Schul- und Berufsbildung • Wasserversorgung • Abwasserentsorgung • Entwicklung der Landwirtschaft A) Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit Bei der multilateralen Entwicklungszusammenarbeit leisten die IL Zahlungen an überstaatliche internationale Organisationen, die diese Gelder verwalten und dann an verschiedene EL für eine Vielzahl von Projekten auszahlen. Beispiele solcher Organisationen sind verschiedene Sonderorganisationen der UNO wie das UNDP (UN-Entwicklungsprogramm). das UNEP (UN-Umweltprogramm), die WHO (UN-Weltgesundheitsorganisation). der UNFPA (UN-Bevölkerungsfonds) und das WFP (UN-Welternährungsprogramm). Weitere Organisationen, die sich in der multilateralen Entwicklungszusammenarbeit engagieren, sind die Weltbankgruppe (UN-Sonderorganisation) und der GFATM (Organisation zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria). B) Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit am Beispiel der Schweiz Die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz ist international abgestützt, indem die Schweiz als eines von 24 Geberländern im Komitee für Entwicklungszusammenarbeit (Development Assistance -16- BKS Chur Michael Compeer Committee, CAD) der OECD vertreten ist und dort alle drei Jahre einen Bericht über ihre öffentliche Entwicklungszusammenarbeit abgibt. Zuständig für die staatliche Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz ist die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), die Teil des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ist. Die DEZA ist neben der Entwicklungszusammenarbeit auch in der humanitären Hilfe (Katastrophenhilfe) und der Zusammenarbeit mit Osteuropa (Transitionshilfe) tätig. Die DEZA arbeitet mit rund 600 Mitarbeitenden im In- und Ausland sowie 1000 lokalen Angestellten und einem Jahresbudget von 1.4 Milliarden Franken (2008). Sie arbeitet in eigenen direkten Aktionen, unterstützt Programme multilateraler Organisationen und finanziert Programme schweizerischer und internationaler privater Hilfswerke mit. Der Bereich wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist im Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) angesiedelt, das zum Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement (EVD) gehört. 65 Personen mit einem Jahresbudget von ca. 200 Millionen Franken (2007) sind damit beschäftigt, den Einbezug der Partnerländer in die Weltwirtschaft und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern. Das Hauptziel der DEZA ist die Armutsreduktion in ihren Partnerländern im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. Dies tut sie durch: • Förderung der wirtschaftlichen und staatlichen Eigenständigkeit • Beitrag zur Verbesserung der Produktionsbedingungen • Hilfe bei der Bewältigung von Umweltproblemen • Verbesserung des Zugangs zu Bildung und Grundversorgung für die am meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen Um seine Mittel gezielter einsetzen zu können, arbeitet die DEZA in 17 Schwerpunktländern. Abbildung 4: Schwerpunktländer der DEZA Bis 2012 reduziert die DEZA die Zahl der Schwerpunktländer auf 12, um noch gezielter helfen zu können. Betroffen vom Ausstieg sind: Bhutan, Ecuador, Indien, Pakistan und Peru. In diesen Ländern werden die laufenden Programme bis dann abgeschlossen. Zurzeit sind bei der DEZA etwa 800 Projekte und Programme in Arbeit. Sie werden im Rahmen mehrjähriger Programme zusammen mit lokalen Partnern geplant und umgesetzt. Dies sind neben staatlichen Stellen in der Regel auch Verbände, nichtstaatliche Organisationen, die Privatwirtschaft und lokale Basisgruppen. Die Durchführung der Projekte obliegt je nach Verfügbarkeit der erforderlichen Fachkompetenz entweder der DEZA selbst, schweizerischen und internationalen bzw. lokalen Hilfswerken, beauftragten Firmen oder internationalen Organisationen. -17- BKS Chur Michael Compeer Projektbeispiel Peru In Peru sind zwei Drittel der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter entweder arbeitslos oder unterbeschäftigt. Einer der Gründe hierfür ist mangelnde Berufsbildung. Ein Berufsbildungsprogramm der DEZA hat in Zusammenarbeit mit dem peruanischen Arbeits- und Bildungsministerium Ausbildungszentren und privaten Betrieben ein Berufsbildungsmodell für sozial benachteiligte Jugendliche und Frauen entwickelt. Dieses auf die Bedürfnisse des Markts ausgerichtete Projekt bietet den Absolventen gute Chancen, danach eine Anstellung zu finden. Die heutige weltweite Entwicklungszusammenarbeit basiert auf den vier Grundpfeilern der menschlichen Entwicklung: A. Produktivität (Productivity) Die Menschen müssen in die Lage versetzt werden, ihre Produktivität zu erhöhen und an der Erzielung von Einkommen und der Ausübung einer bezahlten Beschäftigung voll mitzuwirken. Wirtschaftswachstum ist aber nur dann ein tragender Bestandteil menschlicher Entwicklung, wenn Wohlstand nicht ausschliesslich in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht vermehrt wird. B. Gleichberechtigung (Equal Rights) Ein umfassendes Ziel ist die umfassende Chancengleichheit für alle Menschen. Sämtliche Hindernisse für den Zugang zu ökonomischen und politischen Prozessen müssen beseitigt werden, damit die Menschen an ihnen teilhaben und von ihnen profitieren können. Dazu zählt der Abbau der ungleichen Verteilung lebenswichtiger Güter wie Land, Einkommen, Gesundheit, Sicherheit etc. C. Nachhaltigkeit (Sustainability) Der Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen muss nicht nur für die heutigen, sondern auch für die zukünftigen Generationen gesichert werden. D. Ermächtigung (Empowerment) Entwicklung muss auch durch die betroffenen Menschen selbst erfolgen. Die Menschen müssen voll und ganz an den Entscheidungen und Prozessen mitwirken, die ihr Leben bestimmen. Aufgabe 6: In jüngster Zeit häufen sich in unterschiedlichsten Medien kritische Äusserungen gegenüber der finanziellen Unterstützung von Entwicklungsprojekten. Studieren Sie dazu den Artikel 3 „Schulbrunnen – Wasser zum Leben und überlegen Sie grundsätzliche Kritikpunkte an diesem Projekt. -18- BKS Chur Artikel 3 Michael Compeer Schulbrunnen Wasser zum Leben Die Stiftung JAM Schweiz ist eine Entwicklungsorganisation, welche Menschen in Afrika stärkt, sich selbst ein besseres Leben aufzubauen. Ziel des Projekts Durch das Bohren von Schulbrunnen will JAM langfristig für sauberes Trinkwasser in den Dorfgemeinschaften in Afrika sorgen. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist zwar als Menschenrecht verankert und doch schöpfen laut UNO 884 Millionen Menschen ihr Trinkwasser noch immer aus unsicheren Quellen. Jährlich sterben zwei Millionen Personen – davon 1,5 Millionen Kinder unter 5 Jahren – an Krankheiten, die durch schmutziges Trinkwasser übertragen werden. Alleine im Jahre 2010 hat JAM in Angola, Mozambique und Südafrika 205 Brunnen gebohrt. Helfen Sie uns, den Kampf weiter zu kämpfen, um den Menschen in Afrika das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser zuzugestehen. Umsetzung JAM sucht weitere Sponsoren, um an stark frequentierten Standorten (Schulen, Spitäler sowie Gemeinschaftszentren) Brunnen zu bohren. Ein Brunnen hat die Kapazität, 3‘000 bis 5‘000 Menschen mit Wasser zu versorgen. Das Projekt umfasst folgende Hilfeleistungen: • Abklärung des Bedarfes, fachmännische Vermessungen, geologische Untersuchungen • Die Erschliessung der Tiefenwasser-Quelle mittels Bohrung (100-150 Meter tief) • Auskleidung und Sicherung des Bohrloches • Installation einer einfachen mechanischen Pumpe • Training der Dorfbevölkerung – ein Wasser-Komitee, zusammengesetzt aus Dorfbewohnern und Regierungsvertretern, überwacht die Handhabung des Brunnens sowie den Umgang mit dem Wasser • 3-jähriges Follow-up durch JAM (regelmässige Überprüfung) Kosten Die Versorgung von bis zu 5‘000 Menschen mit sauberem Wasser mittels Brunnenbau kostet 10‘000 Franken. Ebenso viel würde eine einmalige Verteilaktion von 1.5 Liter Mineralwasserflaschen an alle Begünstigten kosten. Der Brunnen versorgt die Menschen über Jahre mit Wasser und hilft beim Sparen. Laut Untersuchungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stehen einem Franken, der in die Wasserund Sanitärversorgung investiert wird, Einsparungen beispielsweise bei der Behandlung von Krankheiten in Höhe von rund neun Franken gegenüber. Langfristige Wirkung Durch den Brunnenbau sorgt JAM für sauberes Trinkwasser in Afrika. Von den verbesserten Hygienebedingungen profitiert die ganze Dorfgemeinschaft nachhaltig. Der Brunnen verändert besonders das Leben der Frauen und Mädchen: Normalerweise investieren diese täglich zusammengerechnet rund 100 Mio. Stunden, um Wasser von fernen Wasserstation zu schöpfen. Die freien Kapazitäten können Mädchen für den Erwerb von Bildung einsetzen. Frauen können diese Zeit für ihre Familien oder für die Produktion von Gütern und den Anbau von Nahrung einsetzen. Langfristig wird damit die Produktivität der ganzen Region gestärkt und für eine bessere Zukunft gesorgt. Quelle: Zugriff 08.10.12 -19- BKS Chur Michael Compeer 4.3.2 Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit Aus ganz unterschiedlichen Richtungen wird die Entwicklungszusammenarbeit kritisiert: • Linke Kritiker bemängeln, dass sich die Entwicklungshilfe der IL an der kapitalistischen Produktionsweise orientiere und dadurch die politische Souveränität der Empfängerländer durch Vorgaben der Geberländer untergraben würde. Dem wird (auch von Seiten regierungsunabhängiger Fachleute aus EL wie z.B. dem ghanaischen Ökonomen George Ayittey) entgegengehalten, dass in vielen EL korrupte Eliten an der Macht seien, die kaum im Interesse der breiten Bevölkerung handeln. • Globalisierungskritikerinnen und auch einige Ökonomen (wie z.B. der oben schon erwähnte George Ayittey) kritisieren, dass bei der Entwicklungszusammenarbeit ein zu grosser Fokus auf die industrielle und urbane Entwicklung gelegt würde und die agrarische Entwicklung und der ländliche Raum zu wenig Beachtung finden würden. • Im Weiteren wird immer wieder geäussert, dass die EL netto gar keine Entwicklungshilfe erhalten würden, weil die Schuldentilgungen grösser wären als die Hilfe. Das dies nicht der Fall ist, belegen sowohl Zahlen der OECD und der UNO, also auch Untersuchungen unabhängiger Wissenschaftlerinnen. • Zudem wird manchmal argumentiert, dass Entwicklungshilfe oft nur eine Hilfe für die eigene Wirtschaft sei. Dies hat insofern etwas für sich, da in einigen Ländern (z.B. Deutschland) tatsächlich mit dem Argument für die Entwicklungszusammenarbeit geworben wird, dass sie die deutsche Wirtschaft mit ankurbeln würde. • Aus liberaler Sicht gibt es eine radikale Kritik an der Entwicklungshilfe, die v.a. vom britischen Ökonomen Peter Bauer und seinem kenianischen Kollegen James Shikwati geäussert wird: Sie sind der Ansicht, dass die heutigen Probleme Afrikas durch die Entwicklungshilfe der letzten Jahrzehnte noch verstärkt wurden, und fordern eine völlige Einstellung der Entwicklungshilfe. Sie sind der Meinung, dass die Entwicklungshilfe den Warenaustausch zwischen den EL und die Entstehung einer privaten Wirtschaft in diesen Ländern behindert hat. James Shikwati kritisiert die Entwicklungshilfe als ein Mittel, um afrikanische Länder an westliche Kapitalgeber zu binden und somit eine einseitige wirtschaftliche und politische Abhängigkeit zu erzeugen. • Eine politische Kritik will die Entwicklungszusammenarbeit mit der Frage nach demokratischen Strukturen in den Empfängerländern und ihrem für das Gemeinwohl sinnvollen Einsatz des Staatshaushalts verknüpft sehen. In beiden Punkten haben die meisten Länder Afrikas Defizite. George Ayittey kritisiert z.B., dass ein grosser Teil der Entwicklungshilfe, die über die Jahrzehnte in afrikanische Länder floss, von den korrupten Eliten missbraucht wurde und dazu diente, diese an der Macht zu halten. • 1970 formulierte die UNO das Ziel, dass die IL 0.7 ihres BNE für öffentliche Entwicklungshilfe aufwenden sollten. Nur wenige Länder erfüllen diese Vorgabe (Zahlen 2007): Norwegen (0.95 %), Schweden (0.93 %), Luxemburg (0.91 %), Niederlande (0.81 %) und Dänemark (0.81 %). Der Durchschnitt der OECDGeberländer liegt bei 0.45 %. Die Schweiz erreichte 2007 einen Wert von 0.37 (gleich wie Deutschland). Am Ende der Tabelle stehen die USA mit 0.16 %. -20- BKS Chur Michael Compeer Aufgabe 7: Sie haben sich den Filmausschnitt „Entwicklungspolitik bleibt erfolglos angesehen. Dabei ist es um die Kritik der Entwicklungshilfe gegangen. Lesen Sie dazu auch das Interview mit der Ökonomin aus Sambia, Dambisa Moyo. Tragen Sie die Hauptkritikpunkte der Entwicklungshilfe aus beiden Quellen stichwortartig zusammen. Artikel 4 „Entwicklungshilfe ist tödlich Die Erfolgsautorin Dambisa Moyo erklärt, weshalb Afrika aufgrund der Entwicklungshilfe heute ärmer ist als noch vor fünfzig Jahren. Von Carmen Gasser Sie haben Ihren Job [in der Finanzbranche] gekündigt und treten derzeit weltweit in Vorträgen und Seminaren gegen die Entwicklungshilfe auf. Hat Sie Ihr Kreuzzug verändert? Ich habe viele Freunde aus der NGO -Gemeinschaft verloren. Das war eine bittere Enttäuschung für mich. Wenn es eine Lektion gibt, dann jene, dass es viele Leute gibt, die versuchen, den Status quo in Afrika beizubehalten, da sie sonst ihre Daseinsberechtigung verlieren. -21- BKS Chur Michael Compeer Sie kritisieren in Ihrem Buch, dass Entwicklungshilfe ein Teil der Unterhaltungsindustrie geworden ist. Was ist falsch, wenn sich Rockstars wie Bono oder Bob Geldof für Afrika einsetzen? Wie würden sich beispielsweise die Amerikaner fühlen, wenn sie angesichts der Kreditkrise nichts von Obama hören würden, aber die ganze Zeit von Michael Jackson? Wir wollen Antworten von afrikanischen Leadern hören, nicht von Prominenten. Eine Milliarde Afrikaner will nicht fürs Entertainment verwendet werden. Wir wollen zur globalen Wirtschaft gehören. Wie waren die Reaktionen auf Ihr Buch? Ich habe viel Unterstützung von afrikanischen Präsidenten bekommen, die allesamt sagten, dass das, was ich behaupte, richtig ist. Erst kürzlich traf ich die Präsidenten von Ruanda und Senegal und deren Minister zu einem Gespräch. Ebenso Kofi Annan, Mitarbeiter des IWF und der Weltbank, und viele Parlamentsmitglieder, beispielsweise aus Schweden und Norwegen. Die extremsten Reaktionen kamen von der NGO-Gemeinschaft. Die Leute sind sehr aggressiv mir gegenüber und verärgert. Sie sagten doch tatsächlich, dass Babys sterben würden wegen dem, was ich sage. Die afrikanischen Regierungen haben Sie eingeladen, obwohl Sie diesen den Geldhahn zudrehen wollen mit dem Stopp der Entwicklungshilfegelder? Sprechen Sie mit irgendeiner afrikanischen Regierung. Alle sind total genervt von diesen NGOs, die ständig vorbeikommen, ihnen ihre Agenda aufdrücken, mit ihren Plänen und Vorstellungen. Es ist ein Alptraum für die meisten Politiker. Was ist falsch an der Entwicklungshilfe? Als Anfang der sechziger Jahre die Entwicklungshilfe startete, waren ihre Ziele, das Wirtschaftswachstum zu steigern und die Armut zu reduzieren. Doch alle Programme haben hinsichtlich dieser Messgrössen versagt. In den vergangenen fünfzig Jahren sind mehr als zwei Billionen Dollar Hilfe von den reichen an die armen Länder geflossen. Dennoch steht Afrika heute schlechter da als vor fünfzig Jahren. Lebten damals nur 10 Prozent der Einwohner unter der Einkommensgrenze von zwei Dollar, so sind es heute 70 Prozent. Während der letzten dreissig Jahre sank das Wirtschaftswachstum jährlich um 0.2 Prozent. Entwicklungshilfe wirkt also so, wie es einst Karl Kraus über die Psychoanalyse sagte: Sie ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält? Exakt. Die Frage ist nicht, warum diese Länder nicht weiter sind, trotz der jahrzehntelangen Entwicklungshilfe. Die Antwort ist: wegen ihr. Das fundamentale Problem ist, dass die Entwicklungshilfe keine Jobs geschaffen hat, sondern das Gegenteil bewirkte, sie zerstörte. Entwicklungshilfe produziert Inflation, Schulden, Bürokratie und Korruption. In ein solches Land wollen Unternehmer nicht investieren und dort Jobs schaffen. Machen Sie ein Land abhängig von Hilfe, dann nehmen Sie die Karotte weg und den Prügel: Niemand wird bestraft, wenn er nicht innovativ ist, denn die Hilfe fliesst trotzdem. Und niemand wird belohnt, wenn er sich anstrengt. Geografische Gründe, ethnische Probleme oder den Kolonialismus als Grund für die Armut Afrikas lassen Sie nicht gelten? All diese Probleme bestehen in Afrika, ja. Aber sie rechtfertigen nicht, dass es einem ganzen Kontinent schlecht geht. Es gibt viele Länder, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben wie Afrika. Indien war eine Kolonie und hat ein Wirtschaftswachstum von 10 Prozent pro Jahr. In vielen Ländern werden wie in Afrika auch ethnische Konflikte ausgetragen. Sie plädieren für Radikalmassnahmen? Entwicklungshilfe ist tödlich. Sie gehört innert einer Übergangsphase von fünf Jahren abgeschafft. Ich bin offen für eine Diskussion, wie lange diese Übergangsphase sein soll. Wichtig ist jedoch, dass die Politiker wissen, dass es kein Geld mehr gibt. Es ist nicht wünschenswert, dass sich die afrikanischen Regierungen zurücklehnen und auf Entwicklungshilfegelder warten. Schlimmstenfalls kann dieses Vorgehen zu mehr Armut, Genozid oder Krieg führen. Ich kann Ihnen garantieren, wenn es mit der Entwicklungshilfe so weitergeht, werden sich die Bedingungen drastisch verschlechtern in Afrika. Wohin hat die Entwicklungshilfe geführt? In den Neunzigern gab es in -22- BKS Chur Michael Compeer Afrika mehr Kriege als auf der ganzen Welt zusammen. In den letzten sechs Monaten allein sind vier weitere Kriege ausgebrochen. Es gibt Millionen von Menschen in Afrika, die heute ärmer sind als noch vor fünfzehn Jahren. Über 60 Prozent der Bevölkerung sind unter 24 Jahre alt. Diese Leute wollen arbeiten. Sie haben aber keine Möglichkeiten, da Entwicklungshilfe verhindert, dass Jobs geschaffen werden. Wenn keine Entwicklungshilfe, was dann? Die Kräfte des freien Marktes reichen kaum. Die guten Nachrichten sind, dass afrikanische Politiker sehr viel tun können. Und diese Vorschläge entstammen nicht meinem Gehirn, sondern sie wurden bereits teilweise umgesetzt und funktionieren. Der Fokus sollte auf dem Handel liegen. Ich empfehle, die Zeit nicht mehr damit zu verschwenden, dass Afrika an WTO-Verhandlungen geht, denn Faktum ist, dass Europa seine Märkte für afrikanische Produkte nicht öffnen wird. Afrika verliert jedes Jahr 500 Milliarden durch Handelsembargos. Die EU schützt ihre Märkte am meisten. Jede Kuh aus der EU wird pro Tag mit 2,5 Dollar gesponsert. Das ist mehr, als über eine Milliarde Menschen jeden Tag zum Leben hat. Also sollte sich Afrika auf jene Länder konzentrieren, von denen wir wissen, dass es eine Nachfrage nach unseren Produkten gibt. Wie China beispielsweise. Können wir als Private denn etwas tun, um Afrika zu unterstützen? Die Leute glauben, dass Afrika anders funktioniert als der Rest der Welt. Dabei gilt für Afrika wie für alle anderen Länder, dass die Leute Arbeit wollen, Infrastruktur, Gesundheitsvorsorge. Sie als Schweizer können diesen Menschen Geld leihen, damit sie sich ein Geschäft aufbauen können. 25 Dollar reichen schon, die dann allerdings zurückbezahlt werden müssen. Die Grameen Bank in Bangladesch hat enorm gute Resultate erzielt und das Leben vieler verändert. Doch die Initiative zu diesem Projekt hätte nicht ein Mann aus Bangladesch ergreifen sollen, sondern die Weltbank. Zum Schluss: Glauben Sie daran, dass sich in Afrika etwas zum Besseren ändern wird? Ich bin besorgt darüber, dass der Veränderungsprozess nicht schnell genug geht, um den Kontinent zu verändern. Aber immerhin gibt es Anzeichen, die positiv sind, da Länder wie Südafrika, Botswana oder Ghana wirtschaftlich grosse Fortschritte gemacht haben, aufgrund ihrer Orientierung hin zu den Kapitalmärkten. Erschienen in der Weltwoche, Ausgabe 24/2009 -23- „Ich habe die durchschnittliche Lebenserwartung Sambias bereits überschritten: Entwicklungshilfe-Kritikerin Moyo. Bild: Bohdan Cap BKS Chur Michael Compeer 4.4 Von der Grameen-Bank zur Eigeninitiative: Mikrokredite als moderne Eza Mikrokredite sind ein Instrument der Entwicklungspolitik. Sie sind jedoch keine neue Erfindung. Schon das vor 150 Jahren von Friedrich Wilhelm Raiffeisen entwickelte Genossenschaftsmodell im damaligen Preussen basiert auf dem Selbsthilfe- und Solidaritätsprinzip, nach dem heute viele Mikrofinanzinstitute in den Entwicklungsländern arbeiten. Seit 1976 gibt es in Bangladesch ein derartiges Programm, das von Muhammad Yunus initiiert wurde, und aus dem 1983 die Grameen Bank hervorging. Im Jahr 2006 erhielten Yunus und die Grameen Bank für diese Bemühungen um die „wirtschaftliche und soziale Entwicklung von unten den Friedensnobelpreis. Weltweit wird die Zahl der Mikrofinanz-Institute (MFI) auf über 70‘000 geschätzt. Der Markt für Mikrokredite hat bis April 2010 ein Volumen von 60 Mrd. US-Dollar erreicht. 4.4.1 Wie funktioniert das System der Mikrofinanzierung? Drei Milliarden Menschen haben weniger als zwei Dollar am Tag, um zu überleben. Dürre, Überschwemmungen, Unfälle oder Krankheit bedrohen täglich ihre Existenz und bergen die Gefahr das Wenige, was sie haben, auch noch zu verlieren. Um sich aus der Armut zu befreien und ihre Familien abzusichern, brauchen sie Geld, um zu investieren. Wer aber nur wenige Dollar am Tag verdient, bekommt üblicherweise keinen Kredit von einer Bank. Denn selbst wenn ihre Einkommen ausreichend wären oder sie angemessene Sicherheiten bieten könnten, sind Kreditbeträge zwischen fünf und wenigen hundert Dollar für traditionelle Banken nicht attraktiv genug. Als einziger Ausweg bleiben häufig nur die örtlichen Geldverleiher mit ihren Wucherzinsen. Der Kreislauf aus Armut, Verschuldung und noch mehr Armut kann somit kaum durchbrochen werden. Mikrofinanzierung ermöglicht denjenigen Kredite, die vom traditionellen Bankensektor vernachlässigt werden. Dazu zählt etwa die Schneiderin in Thailand, die sich nun eine eigene Nähmaschine kaufen kann, der Bauer in Mali, der den Kredit in eine Wasserzisterne investiert oder die Gemüseverkäuferin in Indien, die jetzt beim Grosshändler eine grössere Menge zu einem günstigeren Preis erwerben kann. Somit ist es diesen Menschen möglich, sich eine neue Existenz aufzubauen. Dadurch werden mehr Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen, zusätzliches Einkommen erzielt und eine breitenwirksame wirtschaftliche Entwicklung gefördert. Diese Mikrokredite werden von Institutionen, wie z.B. der Grameen- Bank, und von Privatpersonen ausschliesslich an Mitglieder von Kleingruppen vergeben und haben, im Gegensatz zu herkömmlichen Krediten, meist eine Laufzeit von weniger als 24 Monaten. Die Höhe der Kredite beträgt umgerechnet zwischen 10 bis 1000 Dollar. Die Grameen Bank ist dazu übergegangen, drei Arten von Krediten zu vergeben: Unternehmens-Darlehen zu einem Zinssatz von 20 %, Baudarlehen zu 8 Zinsen und Bildungskredite für die Hochschulausbildung der Kinder von Grameen-Familien zum Zinssatz von 5 %. Bei der Vergabe solcher Kredite besucht der Leiter solcher Institutionen mit seinen Mitarbeitern zuerst die Dörfer, um sich mit den lokalen Begebenheiten vertraut zu machen. Pro Bankfiliale werden etwa 15 bis 22 Dörfer betreut. Bei den Besuchen werden voraussichtliche Kreditnehmerinnen identifiziert und der Bevölkerung wird das Ziel, die Funktionen und die Arbeitsweise der Institutionen erklärt. Aus potentiellen Kreditnehmerinnen werden Gruppen zu je 5 Personen gebildet. Nun werden sie über einige Monate hinweg beobachtet. In diesem Zeitraum müssen sie beweisen, dass sie sparen und somit auch mit ihrem Geld wirtschaften können. Nach diesem Zeitraum erhalten nun zwei von ihnen einen Kredit. Während des ersten Monats wird die gesamte Gruppe aufmerksam beobachtet und darauf geachtet, ob alle Mitglieder die Regeln der Bank einhalten. Erst wenn die ersten zwei Kreditnehmerinnen den Kredit plus Zinsen zurückzahlen, haben die anderen Mitglieder der Gruppe selbst Anspruch auf einen Kredit. Dadurch entsteht ein gewaltiger Gruppendruck und die gemeinsame Verantwortung dient so als Sicherheit für den Kredit. Die Rückzahlungsquote liegt bei ca. 98 %. Viele Mikrofinanzorganisationen vergeben Kredite allerdings nur an Frauen, da diese als kreditwürdiger und verlässlicher empfunden werden. Mikrofinanzierung kann aber noch mehr leisten. Durch einen einfacheren Zugang zu Bank- und Finanzdienstleistungen können Arme erwirtschaftete kleine Beträge besser sparen, ihre Familien gegen Risiken versichern oder Geldüberweisungen von im Ausland lebenden Verwandten erhalten. -24- BKS Chur Michael Compeer Das System der Mikrofinanzierung im Überblick Aufgabe 7: Ergänzen Sie die untenstehende Tabelle. Kredit Kreditgeber Banken Kreditnehmer Privatpersonen, Unternehmen Voraussetzungen um einen Kredit zu bekommen Kreditwürdigkeit, sicheres Einkommen, Ersparnisse Grund, einen Kredit aufzunehmen Grossanschaffungen (Haus, Eigentumswohnung, Maschinen,) Kredithöhe ab 1000 Dollar Laufzeit Langfristig, mindestens 24 Monate Zinssatz ca. 6% Mikrokredit -25- BKS Chur Michael Compeer 4.4.2 Kritik am Konzept der Mikrokredite Die Ärmsten der Armen kommen als Kreditnehmer oft nicht mehr in Frage, da es ihnen an Möglichkeiten mangelt, Einkommen zu erzielen und Kredite zurückzuzahlen. Die Fokussierung auf die reine Kreditvergabe ohne Ergänzung einer Spar-Möglichkeit führt häufig auch zu einer Schuldenfalle, aus der gerade die weibliche Hauptzielgruppe nur schwer herauskommt. Überdies verändert die Vergabe von Mikrokrediten die wirtschaftlichen Makrostrukturen eines Entwicklungslandes nicht wesentlich. Auch Muhammad Yunus selbst, der Gründer der Grameen Bank, befürchtet eine zunehmende Verarmung und Verschuldung von Kreditnehmern,