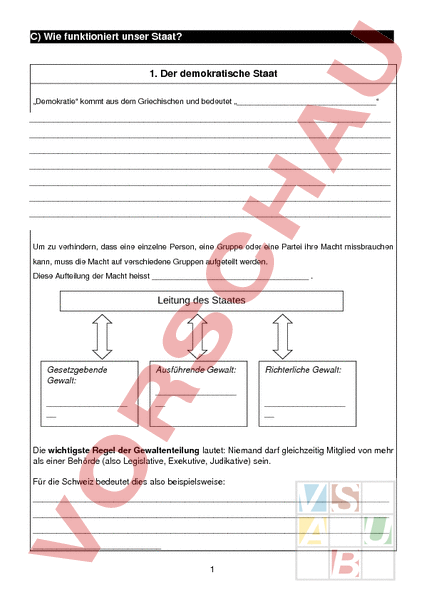Arbeitsblatt: Dossier Staatskunde Schweiz
Material-Details
Dossier zur Staatskunde Schweiz
Geschichte
Anderes Thema
8. Schuljahr
15 Seiten
Statistik
116338
1897
69
15.05.2013
Autor/in
Lucienne Emmenegger
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
C) Wie funktioniert unser Staat? 1. Der demokratische Staat „Demokratie kommt aus dem Griechischen und bedeutet „ Um zu verhindern, dass eine einzelne Person, eine Gruppe oder eine Partei ihre Macht missbrauchen kann, muss die Macht auf verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. Diese Aufteilung der Macht heisst Leitung des Staates Gesetzgebende Gewalt: Ausführende Gewalt: Richterliche Gewalt: Die wichtigste Regel der Gewaltenteilung lautet: Niemand darf gleichzeitig Mitglied von mehr als einer Behörde (also Legislative, Exekutive, Judikative) sein. Für die Schweiz bedeutet dies also beispielsweise: 1 2 2. Die politischen Ebenen der Schweiz Es ist nicht so, dass jede politische Entscheidung der Schweiz in Bern getroffen wird – das wäre auch gar nicht möglich. So ist es klar aufgeteilt, welche politische Ebene worüber bestimmen kann. Es wäre zum Beispiel sicherlich nicht sinnvoll, wenn in Bern entschieden würde, ob in Kriens eine neue Turnhalle gebaut wird. Die politischen Entscheide fallen in der Schweiz auf drei Ebenen: Bundes ebene Kantons ebene Gemeinde ebene Weitere Bezeichnungen: Zuständig für: Weitere Bezeichnungen: Zuständig für: Zuständig für: 3 Auf allen drei politischen Ebenen wird die Gewaltenteilung durchgezogen. Die Namen sind nicht in jedem Kanton und schon gar nicht in jeder Gemeinde dieselben. Hier heisst es also aufpassen! Legislative Exekutive Judikative Bund Kanton Nidwalden Gemeinde () () 4 3. Die politische Organisation der Schweiz auf Bundesebene 5 Die Legislative Auf Bundesebene bildet das sogenannte, Bundesversammlung genannt, die gesetzgebende Gewalt. Das Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Nationalrat und dem Ständerat. auch die Parlament Nationalrat: Ständerat: Wie man sieht, können die Kantone ganz schön unterschiedlich viele Nationalräte rätinnen nach Bern schicken. Das kommt daher, dass der Nationalrat die Gesamtbevölkerung vertreten soll. Der Ständerat dagegen soll die einzelnen Kantone vertreten. Das Parlament kommt viermal im Jahr für jeweils drei Wochen im Bundeshaus in Bern zusammen. (Parlamentarier zu sein gilt in der Schweiz – ganz im Gegensatz zum Ausland! – nicht als Vollberuf.) Diese Zusammenkünfte werden genannt. Entsprechend der jeweiligen Jahreszeit, in der sie stattfinden, nennt man sie die Frühlingssession, Sommersession, usw. Aufgaben des Parlamentes: Im Fall militärischer Bedrohung: Wahl des 6 7 Die Exekutive Auf Bundesebene bilden momentan 4 Bundesräte und 3 Bundesrätinnen mit ihren jeweiligen Departementen ( Zuständigkeitsbereiche) die Exekutive. Die Amtsdauer eines Bundesrats einer Bundesrätin beträgt regulär Jahre. Hinzu kommt die Bundeskanzlerin Corina Casanova. Sie leitet die Verwaltung, hat aber kein Stimmrecht innerhalb des Bundesrates. Die Zusammensetzung des Bundesrates im Jahr 2013: Name: Partei: Departement: im Amt seit: 8 Jedes Jahr kann man im Internet auf www.admin.ch eine Postkarte des Bundesrats bestellen. Die diesjährige Postkarte sieht so aus: 9 Die Judikative Das ist das höchste Gericht der Schweiz. Ein Kläger kann mit seiner Klage nicht direkt vor das Bundesgericht gelangen, sondern muss den sogenannten Weg „über die Instanzen nehmen. Das heisst, er muss beim kleinsten Gericht vorsprechen, meist das Amts oder Bezirksgericht. Ist er mit dem Urteil nicht einverstanden, kann er den Fall vor die nächste Instanz bringen, meist das Kantonsgericht. Erst nach diesem Urteil kann ein Kläger an das Bundesgericht gelangen. (Ausnahmen hierzu sind ausserordentliche Fälle.) Die Amtsdauer eines Bundesrichters einer Bundesrichterin beträgt regulär Jahre. Die BundesrichterInnen werden vom ernannt. Das Bundesgericht: Bundesrichterinnen und Bundesrichter nebenamtliche sowie Richterinnen und Richter arbeiten in den 7 Das Bundesversicherungs gericht: Abteilungen des Bundesgerichts in Lausanne und Luzern. Sie werden dabei von rund Angestellten unterstützt. Zwei neue erstinstanzliche Gerichte auf Bundesebene entlasten das Bundesgericht: Das Bundesstrafgericht in Bellinzona (seit 2004) und das Bundesverwaltungsgericht (ab 2007). Es hat provisorisch Sitz in Bern und zieht voraussichtlich 2012 nach St. Gallen um. le ler 10 11 wähl wä 4J 6 wähl 4J Das Volk der Souverän): Das Parlament(Legislative): 1 Bundespräsident (in) 1 Vizepräsident (in) Regierung (Exekutive): Oberstes Gericht (Judikative): 4. Wer wählt wen in der Schweiz? 5. Verschiedene Arten von „Mehr und Wahlverfahren Mehrheitsverhältnisse: Mehr: Mindestens aller gültig abgegebenen Stimmen 1. Mehr: Wer erhält, ist gewählt. mehr: der gültig stimmenden Personen. Das ist zur Annahme eines Gesetzes erforderlich. mehr: Die Mehrheit der ). Damit das erreicht wird, müssen mindestens 12 Stände die Vorlage bejahen. Die Kantone AR, AI, BS, BL, OW und NW zählt man als halbe Stimme. Ein Unentschieden bei den Ständen bedeutet bereits Ablehnung der Vorlage. Es gibt keine Abstimmung, bei der nur das Ständemehr allein erforderlich wäre. Mehr: . Bei Änderungen der Bundesverfassung und für den Beitritt zu gewissen internationalen Organisationen ist das Mehr erforderlich. Zwei unterschiedliche Wahlverfahren: Majorz und Proporz: Majorz: Wahlverfahren, bei dem die entscheidet, wer gewählt ist, während die nicht berücksichtigt wird. 12 Anwendung: Das Majorzverfahren muss angewendet werden, wenn nur zu vergeben ist. Beispiele: in Halbkantonen: in bevölkerungsarmen Kantonen: Vor und Nachteile des Majorzverfahrens: (Bewerte mit oder ) Es ist ein sehr einfaches Wahlverfahren. Wenig bekannte Personen haben praktisch keine Aussicht auf eine Wahl. Starke Parteien werden bevorzugt, Minderheiten gehen leer aus. Es haben auch Leute eine Chance, die keiner Partei angehören, da es sich um „Persönlichkeitswahlen handelt. Proporz: Wahlverfahren, bei dem die Sitze annähernd zu den erzielten auf die verteilt werden. Anwendung: Das Proporzverfahren kommt vor allem dann zur Anwendung, wenn das Volk seine Vertreterinnen und Vertreter ins Parlament wählt. Beispiele: (Ausnahmen: UR, GL, OW, NW, AI; haben nur 1 Mitglied im NR Majorz) Vor und Nachteile des Proporzverfahrens: (Bewerte mit oder ) 13 6. Wer darf in der Schweiz was? Die Volksrechte auf Bundesebene 14 In kaum einem Staat der Welt kann das Volk die Politik seines Landes so direkt mitbestimmen wie in der Schweiz. Dieses intensive Mitwirken ist nur möglich, weil die Schweiz relativ klein ist und ein sehr hoher Anteil der Bevölkerung alphabetisiert ist (das heisst: lesen und schreiben kann). • Aktives Wahlrecht: • Passives Wahlrecht: • Stimmen: • Wählen: Das Wahlrecht Alle mündigen Schweizerinnen und Schweizer ab besitzen das aktive und das passive Wahlrecht. Wer wählen darf, der darf auch abstimmen. Das Stimmrecht Abgestimmt werden muss regelmässig aus verschiedenen Gründen: Bei über den Beitritt zu bestimmten internationalen Organisationen, über und. Das Initiativrecht Wenn Bürgerinnen und Bürger eine Änderung der Verfassung wünschen, können sie dafür Unterschriften zu sammeln beginnen. Man nennt dies: Sie starten eine . Benötigt werden Unterschriften. Unterschreiben darf jedoch nur, wer ist. Kommen die nötigen Unterschriften in zusammen, wird die den Behörden übergeben und das Volk MUSS anschliessend darüber abstimmen können. Wenn eine Gruppe von Bürgern mit einem Beschluss des Parlaments nicht Das Referendums recht einverstanden ist, sammelt sie Unterschriften dagegen. Benötigt werden Unterschriften von stimmberechtigten Personen. Die Zeit, die dafür zur Verfügung steht, beträgt Man nennt diese Aktion: Das ergreifen. Kommt das 15 Referendum zu Stande, muss das Volk anschliessend darüber abstimmen Das Petitionsrecht Jeder, der eine , ein Anliegen oder eine Idee hat, kann sie den Behörden mitteilen. Um den Behörden zu zeigen, dass er mit seinem Anliegen nicht alleine ist, kann er natürlich auch sammeln. Je mehr er sammelt, umso mehr Eindruck wird sein Anliegen machen. Die Behörden müssen NICHT auf die eingehen, tun es aber meistens. Zusammenfassung: Jemand ist mit einem Beschluss des Parlamentes nicht einverstanden. Schafft er es innerhalb von 100 Tagen, genügend Unterschriften gegen den Beschluss zu sammeln, so müssen die Behörden eine Volksabstimmung über den Beschluss organisieren. Jemand hat eine Idee, ein Vorschlag oder eine Anfrage. Jemand möchte, dass das Parlament die Verfassung ändern muss. Die Behörden müssen nicht darauf eingehen, antworten aber eigentlich immer Die Person sucht Gleichgesinnte und startet eine Unterschriftensammlung. Die Unterschriftensammlung ist erfolgreich. Die Behörden müssen nun eine Volksabstimmung organisieren. Diese Begriffe sind gesucht. Setze sie an die richtige Stelle! Petition Referendum Unterschriften Bitte Referendum 50�00 100 Tage 18 7. Die Parteien Referenden Initiativen Verfassungsänderungen 16 Initiative 100�00 stimmberechtigt Initiative 18 Monate Referendum Initiative Petition Steckbriefe der vier wählerstärksten Parteien: SVP: Bundesräte: Parteipräsident: Ziele, u.a.: Wo ist die Partei politisch angesiedelt? SP: Bundesräte: Parteipräsident: Ziele, u.a.: Wo ist die Partei politisch angesiedelt? FDP: Bundesräte: Parteipräsident: Ziele, u.a.: Wo ist die Partei politisch angesiedelt? CVP: 17 Die acht weiteren Parteien im Parlament: Parteikürzel Die Grünen Partei Präsident/in Grüne Partei der Schweiz Grünliberale Partei Schweiz BürgerlichDemokratische Partei Evangelische Volkspartei der Schweiz Christlichsoziale Partei EidgenössischDemokratische Union Lega die Ticinesi Partei der Arbeit Was heisst links, was heisst rechts? 18