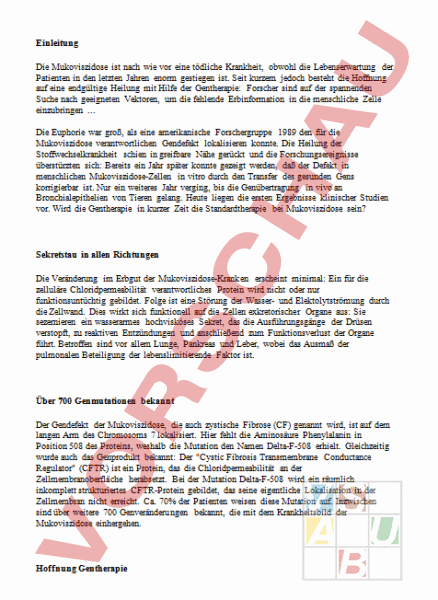Arbeitsblatt: Mukoviszidose
Material-Details
Information für die Lehrperson, kann aber auch an S. abgegeben werden
Biologie
Anatomie / Physiologie
9. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
11696
2137
10
10.11.2007
Autor/in
Roly Roland Stübi
Schönweidstrasse 16
Emmenbrücke
Emmenbrücke
041 281 27 67
079 408 54 21
079 408 54 21
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Einleitung Die Mukoviszidose ist nach wie vor eine tödliche Krankheit, obwohl die Lebenserwartung der Patienten in den letzten Jahren enorm gestiegen ist. Seit kurzem jedoch besteht die Hoffnung auf eine endgültige Heilung mit Hilfe der Gentherapie: Forscher sind auf der spannenden Suche nach geeigneten Vektoren, um die fehlende Erbinformation in die menschliche Zelle einzubringen . Die Euphorie war groß, als eine amerikanische Forschergruppe 1989 den für die Mukoviszidose verantwortlichen Gendefekt lokalisieren konnte. Die Heilung der Stoffwechselkrankheit schien in greifbare Nähe gerückt und die Forschungsereignisse überstürzten sich: Bereits ein Jahr später konnte gezeigt werden, daß der Defekt in menschlichen Mukoviszidose-Zellen in vitro durch den Transfer des gesunden Gens korrigierbar ist. Nur ein weiteres Jahr verging, bis die Genübertragung in vivo an Bronchialepithelien von Tieren gelang. Heute liegen die ersten Ergebnisse klinischer Studien vor. Wird die Gentherapie in kurzer Zeit die Standardtherapie bei Mukoviszidose sein? Sekretstau in allen Richtungen Die Veränderung im Erbgut der Mukoviszidose-Kranken erscheint minimal: Ein für die zelluläre Chloridpermeabilität verantwortliches Protein wird nicht oder nur funktionsuntüchtig gebildet. Folge ist eine Störung der Wasser- und Elektolytströmung durch die Zellwand. Dies wirkt sich funktionell auf die Zellen exkretorischer Organe aus: Sie sezernieren ein wasserarmes hochvisköses Sekret, das die Ausführungsgänge der Drüsen verstopft, zu reaktiven Entzündungen und anschließend zum Funktionsverlust der Organe führt. Betroffen sind vor allem Lunge, Pankreas und Leber, wobei das Ausmaß der pulmonalen Beteiligung der lebenslimitierende Faktor ist. Über 700 Genmutationen bekannt Der Gendefekt der Mukoviszidose, die auch zystische Fibrose (CF) genannt wird, ist auf dem langen Arm des Chromosoms 7 lokalisiert. Hier fehlt die Aminosäure Phenylalanin in Position 508 des Proteins, weshalb die Mutation den Namen Delta-F-508 erhielt. Gleichzeitig wurde auch das Genprodukt bekannt: Der Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) ist ein Protein, das die Chloridpermeabilität an der Zellmembranoberfläche herabsetzt. Bei der Mutation Delta-F-508 wird ein räumlich inkomplett strukturiertes CFTR-Protein gebildet, das seine eigentliche Lokalisation in der Zellmembran nicht erreicht. Ca. 70% der Patienten weisen diese Mutation auf. Inzwischen sind über weitere 700 Genveränderungen bekannt, die mit dem Krankheitsbild der Mukoviszidose einhergehen. Hoffnung Gentherapie Moderne medizinische Verfahren auf dem Gebiet der Früherkennung und der Therapie konnten die Lebenserwartung der Mukoviszidose-Patienten in den letzten Jahren enorm verbessern. Während die Betroffenen früher meist nicht älter als fünf Jahre wurden, erreichen sie heute in der Regel das Erwachsenenalter. Ein in den 90er Jahren geborenes Kind mit Mukoviszidose hat eine Chance von über 90%, das Erwachsenenalter zu erreichen – entsprechend nimmt auch die Prävalenz der Erkrankung zu. Eine endgültige Heilung gibt es bisher noch nicht. Es bestehen aber berechtigte Hoffnungen, daß die Gentherapie in absehbarer Zeit eine Behandlungsmöglichkeit für die Mukoviszidose wird: Die fehlende Erbinformation in die menschliche Zelle zu bringen ist das Ziel neuer gentherapeutischer Ansätze. Man sucht zur Zeit nach geeigneten Vektoren, um das Gen optimal zu übertragen, berichtet Dr. Heike Diekmann, Medienreferentin des Deutschen Mukoviszidose e.V., von der 21. European Cystic Fibrosis Conference, die im Juni diesen Jahres in Davos stattfand. Intrauterine Therapie: erfolgreich – aber umstritten Neuester Traum der Forscher ist eine intrauterine Therapie, bei der das fehlende Gen direkt in die Keimbahn eingebracht wird. Zumindest im Tierversuch ist dies keine Zukunftsmusik mehr: Im März 1997 berichtete der Lancet (The Lancet 1997; 349: 619–620) über die erste erfolgreiche intrauterine Gentherapie bei Mukoviszidose. Die Wissenschaftler aus New Orleans behandelten hierzu Feten von sog. S489X-Knock-out-Mäusen. Diese Mäuse weisen einen CFTR-Gendefekt auf, der zur gastrointestinalen Symptomatik der Mukoviszidose führt. Den Mäusefeten wurde mittels Amniozentese ein Gen injiziert, das die korrekte Aminosäurensequenz zur Ausbildung von CFTR enthielt. Es konnte so in das Erbgut der Mäuse eingeschleust werden. Während in der Kontrollgruppe alle Tiere noch vor dem 50. Lebenstag verstarben, waren die gentherapierten Mäuse 250 Tage nach der Geburt gesund und zeigten keine Anzeichen einer Pankreas-Symptomatik. In Deutschland sind diese Eingriffe in die Keimbahn aus ethischen Gründen sehr umstritten: Die intrauterine Gentherapie ist sicher keine Therapie-Option für die Mukoviszidose. Ich sehe einen besseren Ansatz in der somatischen Gentherapie, bei der nur einzelne Körperzellen verändert werden. Da das Erbgut unangeastet bleibt, kann man sie praktisch mit einer Organtransplantation vergleichen, meint Dr. med. Joachim Bargon von der Universitätsklinik in Frankfurt. Die Vektor-Frage Auch auf dem Gebiet der somatischen Gentherapie ist in den letzten Jahren viel geforscht worden. Eine Frage, die die Wissenschaftler zur Zeit beschäftigte, ist die Wahl des geeigneten Vektors: Um eine In-vivo-Gentherapie der Lunge durchzuführen, benötigt man ein Medium, das als Überträger und Protektor der korrekten DNA-Version dient und die Zielzelle mit dem Ort der CFTR-Exprimierung erreicht. Ist dies gelungen, muß das intrazellulär abgelesene, funktionsfähige Membranprotein (CFTR) immunhistochemisch und elektrophysiologisch nachzuweisen sein. Adenoviren mit Expressionskassetten Als möglicher Genüberträger steht das Adenovirus mit seiner Fähigkeit, spezifisch Atemwegsepithelien zu infizieren, zur Debatte. Das Virus wird durch das Entfernen einer bestimmten Region seiner DNA replikationsunfähig gemacht. An dieser Stelle wird eine Expressionskassette eingebaut, in der ein Promotor die eingesetzte CFTR-DNA antreibt. Das Virus bindet zunächst an spezifische Rezeptoren der Epithelzellen, die sog. Coated pits, über die es endozytotisch in die Zelle gelangt. Intrazellulär wird es als fremd erkannt und zum Endosom verpackt. Als solches kommt es in den Zellkern hinein und streift dort seine Proteinhülle ab. Auf diese Weise konnte sowohl in vitro als auch in vivo an Ratten die fehlende CFTR-DNA in Bronchialepithelien übertragen werden. Die virale DNA mit dem CFTR-Promotor liegt im Zellkern neben den Chromosomen und wird dort exprimiert.In klinischen Studien an CF-Patienten stellte sich der Erfolg leider noch nicht ein. Für ein effizientes Transferergebnis mußte man bisher das Virus mehrmals applizieren (a Abb. 6) und brauchte zu hohe Dosen mit der Folge, daß diese schlecht vertragen wurden: Entzündungsreaktionen, Bildung neuer Genkombinationen aus Virus- und Wirtszellgenom (Rekombination) und zelluläre sowie humorale Immunantworten stellten sich ein. Da manche Adenoviren in vitro Tumoren induzieren können, bleibt auch dies ein Unsicherheitsfaktor für die Anwendung am Menschen. Nun arbeitet man an der Herstellung einer neuen Generation von Adenoviren, die weniger adenovirales Genom aufweisen und so eine geringere Immunantwort auslösen. Des weiteren versucht man die initiale Immunantwort des Patienten medikamentös zu blockieren. Adenoassoziierte Viren – zuwenig erforscht Ein weiterer Kandidat für die Gentherapie ist der nicht humanpathogene adenoassoziierte Virus (AAV). Seine Vorteile bestehen einerseits in seiner geringen Toxizität und andererseits darin, daß die DNA gut ins Zellgenom integriert wird. Mit diesem Vektor konnte eine Korrektur des Chloriddefektes und eine Transgenexpression über mehrere Monate nachgewiesen werden. Allerdings wagte man sich noch nicht daran, den Vektor breit anzuwenden: Die Auswirkungen der Integration ins Genom des Wirtes sind noch zu wenig erforscht, und es gibt Probleme bei seiner Herstellung. Mit Liposomen zum Erfolg? Einige Wissenschaftler setzen derzeit auf Liposomen als geeignete Vektoren. Im Gegensatz zu den viralen Kandidaten haben diese weniger antigene Wirkungen auf den Organismus. Zudem besteht bei der virusfreien Übertragung keine Gefahr einer Rekombination. Die mizellenartigen Fettemulsionen sind positiv geladen und verbinden sich mit der negativ geladenen DNA zu einem zellmembrangängigen Komplex. Helferlipide, z.B. Dioleoylphosphatidylethanolamine (DOPE), erleichtern das Eindringen der DNA in die Zielzelle durch Membranfusion oder Endozytose. Intrazellulär verfügen die Liposomen nicht wie die Viren über einen Mechanismus, der sie in den Zellkern bringt: Ein großer Teil der DNA wird im Zytoplasma der Zelle noch vor dem Erreichen des Zellkernes durch lysosomale Enzyme zerstört. Es müssen also große Mengen von Liposomen-DNA-Komplexen eingesetzt werden, um eine effiziente Korrektur in vivo zu erreichen. Eine klinische Liposomen-Studie in England zeigte bereits erste Erfolge: Bei 15 Mukoviszidose-Patienten wurden Komplexe aus Liposomen und CFTR-DNA in die Nasenhöhle appliziert. Die Ergebnisse deuten auf eine partielle Normalisierung der Chloridsekretion in der Nasenschleimhaut hin. Der Beweis, mit den Liposomen eine CFTR-Expression in der Lunge zu erreichen, steht derzeit noch aus. Da aber auch bei Liposomen die Behandlung regelmäßig wiederholt werden muß, bleibt bislang offen, wie die Patienten auf eine häufige Applikation der hohen Menge DNA und Liposomen reagieren. Einen Schritt weiter – aber noch immer ungelöste Fragen Die Zukunft wird zeigen, welcher Vektor für die Therapie der Mukoviszidose am besten geeignet ist. Das Problem der kurzen Wirkdauer der Gentherapie ist ebenfalls noch nicht gelöst. Schließlich sind mit der somatischen wie mit der intauterinen Gentherapie zahlreiche Risiken verbunden. Erst wenn alle Fragen beantwortet sind und die Risiken der Gentherapie minimiert wurden, kann der große Durchbruch in der Mukoviszidose-Therapie gelingen. Optimistische Forscher sind davon überzeugt, daß die entscheidenden Schritte noch vor der Jahrtausendwende erfolgen werden.