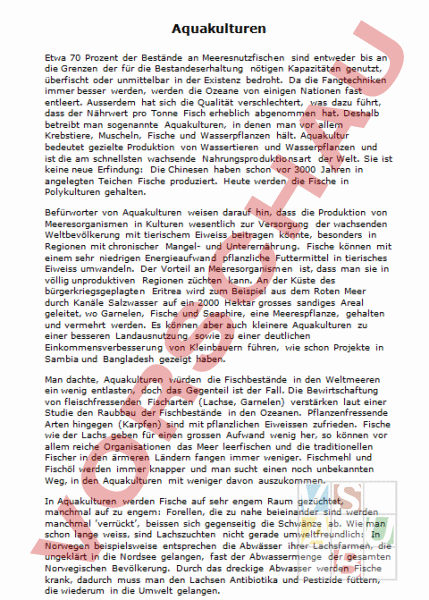Arbeitsblatt: Aquakulturen, Zusammenfassung
Material-Details
Text über Aquakulturen.
Word.
Geographie
Gemischte Themen
klassenübergreifend
2 Seiten
Statistik
11750
1596
6
11.11.2007
Autor/in
mister teacher (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Aquakulturen Etwa 70 Prozent der Bestände an Meeresnutzfischen sind entweder bis an die Grenzen der für die Bestandeserhaltung nötigen Kapazitäten genutzt, überfischt oder unmittelbar in der Existenz bedroht. Da die Fangtechniken immer besser werden, werden die Ozeane von einigen Nationen fast entleert. Ausserdem hat sich die Qualität verschlechtert, was dazu führt, dass der Nährwert pro Tonne Fisch erheblich abgenommen hat. Deshalb betreibt man sogenannte Aquakulturen, in denen man vor allem Krebstiere, Muscheln, Fische und Wasserpflanzen hält. Aquakultur bedeutet gezielte Produktion von Wassertieren und Wasserpflanzen und ist die am schnellsten wachsende Nahrungsproduktionsart der Welt. Sie ist keine neue Erfindung: Die Chinesen haben schon vor 3000 Jahren in angelegten Teichen Fische produziert. Heute werden die Fische in Polykulturen gehalten. Befürworter von Aquakulturen weisen darauf hin, dass die Produktion von Meeresorganismen in Kulturen wesentlich zur Versorgung der wachsenden Weltbevölkerung mit tierischem Eiweiss beitragen könnte, besonders in Regionen mit chronischer Mangel- und Unterernährung. Fische können mit einem sehr niedrigen Energieaufwand pflanzliche Futtermittel in tierisches Eiweiss umwandeln. Der Vorteil an Meeresorganismen ist, dass man sie in völlig unproduktiven Regionen züchten kann. An der Küste des bürgerkriegsgeplagten Eritrea wird zum Beispiel aus dem Roten Meer durch Kanäle Salzwasser auf ein 2000 Hektar grosses sandiges Areal geleitet, wo Garnelen, Fische und Seaphire, eine Meerespflanze, gehalten und vermehrt werden. Es können aber auch kleinere Aquakulturen zu einer besseren Landausnutzung sowie zu einer deutlichen Einkommensverbesserung von Kleinbauern führen, wie schon Projekte in Sambia und Bangladesh gezeigt haben. Man dachte, Aquakulturen würden die Fischbestände in den Weltmeeren ein wenig entlasten, doch das Gegenteil ist der Fall. Die Bewirtschaftung von fleischfressenden Fischarten (Lachse, Garnelen) verstärken laut einer Studie den Raubbau der Fischbestände in den Ozeanen. Pflanzenfressende Arten hingegen (Karpfen) sind mit pflanzlichen Eiweissen zufrieden. Fische wie der Lachs geben für einen grossen Aufwand wenig her, so können vor allem reiche Organisationen das Meer leerfischen und die traditionellen Fischer in den ärmeren Ländern fangen immer weniger. Fischmehl und Fischöl werden immer knapper und man sucht einen noch unbekannten Weg, in den Aquakulturen mit weniger davon auszukommen. In Aquakulturen werden Fische auf sehr engem Raum gezüchtet, manchmal auf zu engem: Forellen, die zu nahe beieinander sind werden manchmal verrückt, beissen sich gegenseitig die Schwänze ab. Wie man schon lange weiss, sind Lachszuchten nicht gerade umweltfreundlich: In Norwegen beispielsweise entsprechen die Abwässer ihrer Lachsfarmen, die ungeklärt in die Nordsee gelangen, fast der Abwassermenge der gesamten Norwegischen Bevölkerung. Durch das dreckige Abwasser werden Fische krank, dadurch muss man den Lachsen Antibiotika und Pestizide füttern, die wiederum in die Umwelt gelangen. 11.11.2007 Seite 1 von 2 Aquakulturen Die Garnelenproduktion in Aquakulturen ist im Gegensatz zum Lachs lohnender. Doch auch die Garnelenproduktion führt zu Umweltproblemen, denn auch ihnen muss, wenn auch weniger als den Lachsen, Fischmehl und Fischöl verfüttert werden. Schätzungen zufolge sind bis zu 30 Prozent der Verluste an Mangrovenwäldern in Thailand auf Kosten der Garnelenzucht entstanden. So gehen auch Sumpfwälder und damit die Lebensräume für viele andere Fischarten verloren. Auch werden die Küsten immer instabiler und schütten immer mehr Sedimente ins offene Meer, die sich als ein für die Korallenbänke tödlicher Schleier auf diese legen. All dies führt zu einer Dezimierung der wildlebenden Fischbestände in den Weltmeeren. Ein weiteres Problem sind die Meerläuse; an ihnen sterben immer mehr Lachse. Meerläuse vermehren sich vor allem in Aquakulturen. Doch die Chefs der grossen Konzerne wollen nur ihr Geld und die Gefahren für die Umwelt nicht einsehen. Einzig in Norwegen achtet man bisher darauf; es werden regelmässige Kontrollen durchgeführt, in denen die Farmen einen Grenzwert an Meerläusen nicht übertreffen dürfen. Um die Läuse und Krankheiten zu bekämpfen wird viel Chemie und Antibiotika eingesetzt. Damit die Fische schneller wachsen werden ihnen natürlich Wachstumshormone verfüttert. Es entstehen immer wieder Epidemien, einige Farmlachse leiden gar an Erblindung oder Rückendeformationen, es wurden auch schon solche mit fehlender Nase gefunden. Diese Fische entkommen immer wieder aus den Farmen und vermischen sich mit dem Wildlachs. An vielen Orten gibt es schon mindestens so viele Farmlachse wie Wildlachse. Die Vermischung mit den Zuchtlachsen ist natürlich nicht gerade gesundheitsfördernd für die Wildlachse. Es gibt sogar genmanipulierte Lachse, die aus ihren Vermehrungsstätten entkommen und sich mit dem Wildfisch vermischen. Es wurde einmal ein Versuch gemacht indem alle Lachse in einem Bach markiert wurden. Im folgenden Jahr schaute man, wie viele Lachse zurückkehrten, es waren weniger und fast keine der Lachse, die das vorige Jahr dort gewesen waren. Dies hängt auch mit der Vermischung der Zucht- mit den Wildlachsen zusammen. Damit sie schneller wachsen, werden Farmlachse in warmem Gewässer gehalten, dieses wird ständig beleuchtet, auch in der Nacht. Durch den schnellen Wachstum haben sie natürlich einen erhöhten Nahrungsbedarf, so werden pro Kilo Zuchtlachs drei bis fünf Kilogramm Wildfisch (wie z.B. Lodde) gefischt. Dies hilft auch nicht weiter, die Wildfischbestände zu erhalten. Besonders kritisch ist die Garnelenproduktion in Thailand: Sie breitete sich in den letzten Jahren in über 100km von der Küste entfernt liegende Gebiete aus. Mit riesigen Tanklastwagen wird nun Salzwasser ins Hinterland transportiert um neue Teiche anzulegen und zu füllen, allein die Abgase, die dadurch entstehen sind umweltschädlich. Doch vor allem drohen nun grosse Gebiete, die für zukünftige landwirtschaftliche Zwecke noch zu gebrauchen gewesen wären, zu versalzen, da das Salzwasser in den Boden sickert. Daher wollen viele Forscher nun Aquakulturen im Innenland grundsätzlich verbieten. 11.11.2007 Seite 2 von 2