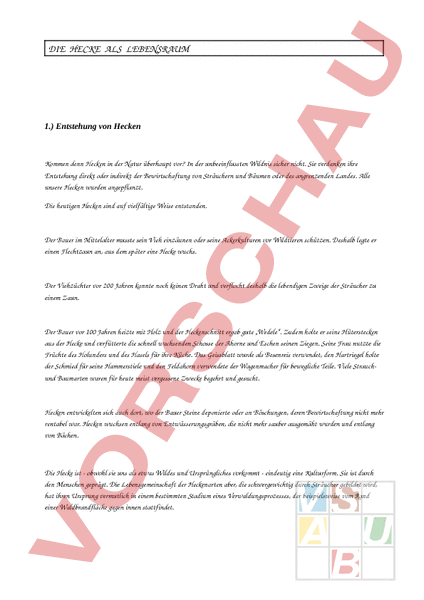Arbeitsblatt: Die Hecke als Lebensraum
Material-Details
Text über Entstehung und Kultur der Hecke (4 Seiten) sowie Arbeitsblatt mit Fragen und Aufgaben zum Text (2 Seiten)
Biologie
Pflanzen / Botanik
6. Schuljahr
6 Seiten
Statistik
117613
1217
2
13.06.2013
Autor/in
Nadja Küttel
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
DIE HECKE ALS LEBENSRAUM 1.) Entstehung von Hecken Kommen denn Hecken in der Natur überhaupt vor? In der unbeeinflussten Wildnis sicher nicht. Sie verdanken ihre Entstehung direkt oder indirekt der Bewirtschaftung von Sträuchern und Bäumen oder des angrenzenden Landes. Alle unsere Hecken wurden angepflanzt. Die heutigen Hecken sind auf vielfältige Weise entstanden. Der Bauer im Mittelalter musste sein Vieh einzäunen oder seine Ackerkulturen vor Wildtieren schützen. Deshalb legte er einen Flechtzaun an, aus dem später eine Hecke wuchs. Der Viehzüchter vor 200 Jahren kannte noch keinen Draht und verflocht deshalb die lebendigen Zweige der Sträucher zu einem Zaun. Der Bauer vor 100 Jahren heizte mit Holz und der Heckenschnitt ergab gute „Wedele. Zudem holte er seine Hüterstecken aus der Hecke und verfütterte die schnell wachsenden Schosse der Ahorne und Eschen seinen Ziegen. Seine Frau nutzte die Früchte des Holunders und des Hasels für ihre Küche. Das Geissblatt wurde als Besenreis verwendet, den Hartriegel holte der Schmied für seine Hammerstiele und den Feldahorn verwendete der Wagenmacher für bewegliche Teile. Viele Strauch und Baumarten waren für heute meist vergessene Zwecke begehrt und gesucht. Hecken entwickelten sich auch dort, wo der Bauer Steine deponierte oder an Böschungen, deren Bewirtschaftung nicht mehr rentabel war. Hecken wuchsen entlang von Entwässerungsgräben, die nicht mehr sauber ausgemäht wurden und entlang von Bächen. Die Hecke ist obwohl sie uns als etwas Wildes und Ursprüngliches vorkommt eindeutig eine Kulturform. Sie ist durch den Menschen geprägt. Die Lebensgemeinschaft der Heckenarten aber, die schwergewichtig durch Sträucher gebildet wird, hat ihren Ursprung vermutlich in einem bestimmten Stadium eines Verwaldungsprozesses, der beispielsweise vom Rand einer Waldbrandfläche gegen innen stattfindet. 2.) Entwicklung von Hecken Die Bewirtschaftung der Hecke begünstigte die ausschlagfähigen Arten und jene Arten, die auf irgendeine Weise genutzt werden konnten. Als Stufe im Verwaldungsprozess bleibt eine Hecke von Natur aus nicht so, wie sie ist. Ohne Pflege entwickelt sie sich praktisch immer zu Wald, das heisst die Sträucher werden an den Rand gedrängt, wo sie aber häufig aufgrund der Bewirtschaftung durch die Landwirtschaft verschwinden. 3.) Vorkommen von Hecken In der Zeitspanne vom 2. Weltkrieg (ca. 1945) bis vor etwa fünfundzwanzig Jahren (um 1990) waren in der Schweiz zwei verschiedene Tendenzen sichtbar: Einerseits wurden viele der einstmals fast unzähligen Hecken durch Rationalisierung der Landwirtschaft gerodet. Andererseits entwickelten sich viele Sträucherhecken durch Aufgabe der Bewirtschaftung und demnach auch der Pflege zu Baumgehölzen. Diese stellten mit ihrem Schattenwurf und der Wurzelkonkurrenz eine starke Beeinträchtigung der Landwirtschaft dar, was wiederum zur Entfernung dieser Gehölze führte. Seit rund 25 Jahren ist eine gegenläufige Tendenz erkennbar. Hecken entwickeln sich zu „Lieblingskindern der Naturschutzbewegungen. Mit deren Aufkommen wurden viele Hecken neu angepflanzt oder auch bestehende Hecken gepflegt. Leider kann aber eine gerodete Hecke nicht so einfach durch eine Neuanpflanzung ersetzt werden. Die meisten Strauch und Baumarten lassen sich zwar problemlos anpflanzen, bis sich aber die zu einer wertvollen Hecke gehörende Bodenvegetation (niedrige Pflanzen) und Kleinstfauna (kleine Tiere, z. B. Insekten) einstellen, können Jahrzehnte vergehen. 4.) Form- oder Schnitthecke Die Hecke, welche am wenigsten Platz beansprucht, ist die Form oder Schnitthecke. Sie setzt sich aus schnittverträglichen Sträuchern oder Bäumen zusammen und wird jedes Jahr oder jedes zweite Jahr wieder in ihre Form gebracht. Der Schnitt kann mit der Heckenschere oder Motorsäge erfolgen. Interessanter ist jedoch die Arbeit mit der Rebschere, da damit eine ganz bewusste Schnittführung mit dem Ziel einer hohen Anzahl von Verzweigungen innerhalb der Hecke möglich ist. Falls es der Platz erlaubt, sollte der Schnitt nicht auf einer Linie erfolgen, sondern er darf unregelmässig mit Buchten und verschiedenen Höhen sein. Geeignete Arten für eine Formhecke sind die meisten Straucharten (ohne Faulbaum) und ausschlagfähige Baumarten, wie Esche oder Ahornarten. 5.) Die Niederhecke Sie besteht aus niedrig wachsenden Sträuchern, erreicht etwa drei Meter Höhe und mindestens soviel Breite. Sie eignet sich für Standorte im Kulturland, wo Schattenwurf unerwünscht ist. Die Niederhecke sollte in den ersten fünf bis acht Jahren wie eine Formhecke häufig geschnitten werden, um möglichst viele Verzweigungen an den Ästen zu erhalten. Später genügt eine Pflege alle drei bis fünf Jahre. Passende Arten für die Niederhecke sind Berberitze, Rosenarten, Geissblatt, Liguster, Roter Holunder, Gemeiner Schneeball, Wolliger Schneeball. Auf magereren Böden eignen sich auch Schwarzdorn, Pfaffenhütchen und Kreuzdorn. Von Hasel, Hartriegel oder grossen Strauchweiden ist abzuraten, da diese zu hoch werden. Die Niederhecke sollte nämlich im Gegensatz zur Formhecke die Oberhöhe nicht durch den Schnitt, sondern durch das natürliche Höhenwachstum der Sträucher erreichen. 6.) Die Hochhecke Sie ist ebenfalls ein häufig angepflanzter Heckentyp. Sie beansprucht mindestens drei Meter Breite und wird bis zu sieben Meter hoch. Das Gerüst der Hochhecke bilden neben den Arten der Niederhecke im Saumbereich die grösseren Sträucher wie Weissdorn, Faulbaum, Hasel, Schwarzer Holunder, Kornelkirsche, Hartriegel sowie verschiedene Weidenarten. Die Pflege der Hochhecke ist anspruchsvoll, da die vielen vorkommenden Arten ganz unterschiedliche Charaktere haben. Wichtig für die Erhaltung der niederwachsenden Sträucher ist ein Rückschnitt der höheren Sträucher, und damit die Erhaltung der Stufigkeit. 7.) Die Baumhecke Hier finden wir die grösste Artenvielfalt an Pflanzen und demzufolge auch an Tieren. Baumhecken werden bis zu 30m hoch und können eine Breite von bis zu 20m erreichen. Wichtig beim Pflanzen und bei der Pflege ist ein stufiger Aufbau, der nicht mittels Schnitt, sondern mittels der Wahl der richtigen Art bei Pflanzung oder Pflege erreicht wird. Selbstverständlich ist die Stufigkeit nicht linear zu betrachten. Es dürfen ohne weiteres auch einzeln stehende Bäume im Strauchgürtel oder Sträuchergruppen im inneren Bereich vorkommen. Baumhecken können unterschiedlich dicht sein. Wenn sie eine Windschutzfunktion erfüllen müssen, sollten die Bäume sich zwar berühren, aber nicht zu eng nebeneinander stehen. Wenn die Hauptfunktion die Förderung der ökologischen Vielfalt ist, dürfen die Bäume eher einzeln oder in kleineren Gruppen beigemischt sein. Alle unsere einheimischen Strauch und Baumarten können in der Baumhecke vorkommen. Die Baumarten in einer natürlich entstandenen Baumhecke können sogar deren Alter anzeigen. Falls die Schattenbaumarten Weisstanne oder Buche vorkommen, handelt es sich um eine alte Hecke, deren Bodenbildungsprozess schon weit fortgeschritten ist. Die Baumarten sind meist konkurrenzstärker als die Sträucher. Es ist deshalb auch in der Baumhecke notwendig, die Artenvielfalt mittels gezielten Eingriffen zu erhalten. In der Baumschicht sollten nicht unbedingt Allerweltsarten wie Esche oder Fichte gefördert oder gepflanzt werden, sondern Arten, welche im Wald aufgrund ihres hohen Lichtbedarfs oder ihres langsamen Wachstums Mühe haben. Typische Vertreter dafür sind Wildobstarten, Feldahorn, Kirschbaum, Nussbaum, Linde, Salweide, Pappelarten, Traubenkirsche, Hagebuche, Eiche und weitere mehr. Kletterpflanzen wie Efeu, Waldrebe oder Windendes Geissblatt und klimmende Arten wie Hundsrose sorgen für eine vertikale Verbindung der Schichten. 8.) Ökologischer Wert Als Faustregel gilt: Pro Pflanzenart können zehn Tierarten vorkommen. Das heisst, je mehr Sträucher und Baumarten vorkommen, desto artenreicher wird auch die Fauna sein. Eine Hecke sollte wenn möglich beidseitig von einem Heckensaum begleitet sein. Dies ist ein Bereich, in dem verschiedene Krautpflanzen vorkommen, der nicht gedüngt wird und der lediglich ein bis zweimal pro Jahr, frühestens anfangs Juni, gemäht wird. Viele Insekten und Kleinvögel nutzen die Hecke als Rückzugsort oder Nistplatz und den Krautsaum zur Nahrungssuche. Eine wertvolle Hecke weist beidseitig angrenzend an den Heckensaum einen Bereich mit Hochstauden oder RubusArten* auf(*kletternde oder kriechende Stauden aus der Familie der Rosengewächse, z. B. Brombeere oder Himbeere). Hochstauden wie Brennesseln oder Mädesüss sind wertvolle Futterpflanzen für Schmetterlinge. Als nächster Bereich folgt ein Gürtel mit kleineren und grösseren Sträuchern in einer bunten Zusammensetzung und danach eine artenreiche Baumschicht (falls es sich um eine Baumhecke handelt). Eine wichtige Rolle in Bezug auf den Wert einer Hecke spielen auch die so genannten Kleinstrukturen. Damit werden Kleinlebensräume in oder neben der Hecke bezeichnet wie z. B. Asthaufen, Holzstapel, Steinhaufen, Feuchtstellen, Brombeerdickicht, vegetationslose Stellen und vieles mehr. Diese Elemente können im Rahmen einer Heckenpflege auch neu angelegt werden. Eine Hecke darf nicht isoliert von ihrem Umfeld betrachtet werden. Falls sie weit weg von der nächsten Magerwiese, dem nächsten Wald oder dem nächsten Hochstammobstbaum steht, ist ihr Wert sicher geringer als der einer gut vernetzten Hecke. 9.) Praktischer Wert von Hecken Die Rolle der Hecke als Lieferantin von Holz, Reisig, Viehfutter oder sogar Arzneimitteln ist heute nur noch gering. Wichtiger ist ihre Funktion als Herberge der Artenvielfalt auf kleinem Raum, als Element der Landschaftsgliederung, als optische Abgrenzung und vor allem als Vernetzung von Lebensräumen. Hecken sind Strassen für Gehölz bewohnende Tiere und Pflanzen! Zudem hausen viele Nützlinge in der Hecke, welche im angrenzenden Kulturland den Feldschädlingen nachstellen. Auf keinen Fall sollte die ganze Hecke im gleichen Jahr ausgelichtet, zurück geschnitten oder gar auf Stock gesetzt werden, da jede noch so fachgerechte Pflege eine momentan massive Störung der Lebensgemeinschaft verursacht. Bei den heutigen Ölpreisen finden sich für die Nutzung des Heckenschnitts in Form von Schnitzeln zwar vermehrt Abnehmer. Trotzdem ist es nicht sinnvoll, alles Material aus der Hecke abzuführen. Nach Möglichkeit sollten Äste und Holz in der Hecke drin oder angrenzend an sie aufgehäuft werden. Diese Haufen stellen Lebensräume für die verschiedensten Organismen dar, angefangen von Pilzen über Holz bewohnende Käfer bis zum Wiesel, das sich darunter verbirgt. DIE HECKE ALS LEBENSRAUM 1.) Entstehung von Hecken ARBEITSBLATT Bis vor etwa 50 Jahren wurde die Hecke vom Menschen noch intensiv genutzt. Notiere hier, wer welche Teile aus der Hecke wozu verwendet hat. WER WAS WOZU Bauer Heckenschnitt Wedele 2.) Entwicklung von Hecken Was passiert mit einer Hecke, die nicht mehr gepflegt wird? 3.) Vorkommen von Hecken Warum sind vor ca. 45 Jahren viele Hecken verschwunden? Wem haben wir es zu verdanken, dass in neuester Zeit wieder viele Hecken entstehen? 4. – 7.) Verschiedene Heckentypen Zähle ein paar Beispiele auf, welche Pflanze sich für welchen Heckentyp eignet. Schnitthecke Niederhecke Hochhecke Baumhecke 8.) Ökologischer Wert Es gibt eine Faustregel für den ökologischen Wert einer Hecke. Schreibe sie hier auf. 9.) Praktischer Wert von Hecken Hat die Hecke heutzutage noch einen wirtschaftlichen Wert? Erkläre. Warum sollte das Schnittgut nach dem Schneiden der Hecke nicht weggeführt werden?