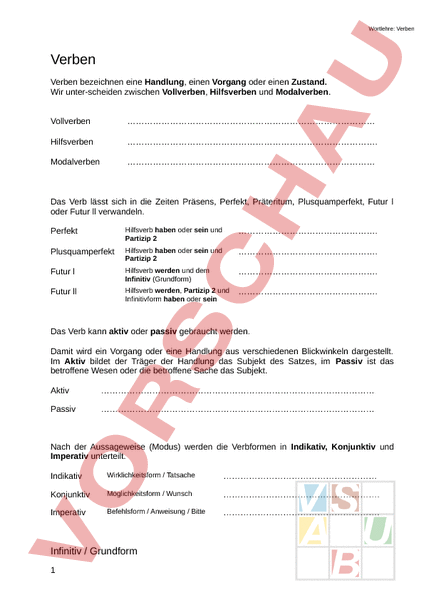Arbeitsblatt: Wortlehre/Verben
Material-Details
Repetition Verben
Deutsch
Grammatik
9. Schuljahr
9 Seiten
Statistik
118622
1196
16
12.07.2013
Autor/in
Pius Tschopp
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Wortlehre: Verben Verben Verben bezeichnen eine Handlung, einen Vorgang oder einen Zustand. Wir unter-scheiden zwischen Vollverben, Hilfsverben und Modalverben. Vollverben Hilfsverben . Modalverben Das Verb lässt sich in die Zeiten Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur oder Futur ll verwandeln. Perfekt Hilfsverb haben oder sein und Partizip 2 . Plusquamperfekt Hilfsverb haben oder sein und Partizip 2 . Futur Hilfsverb werden und dem Infinitiv (Grundform) . Futur ll Hilfsverb werden, Partizip 2 und Infinitivform haben oder sein . Das Verb kann aktiv oder passiv gebraucht werden. Damit wird ein Vorgang oder eine Handlung aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt. Im Aktiv bildet der Träger der Handlung das Subjekt des Satzes, im Passiv ist das betroffene Wesen oder die betroffene Sache das Subjekt. Aktiv Passiv Nach der Aussageweise (Modus) werden die Verbformen in Indikativ, Konjunktiv und Imperativ unterteilt. Indikativ Wirklichkeitsform Tatsache Konjunktiv Möglichkeitsform Wunsch . Imperativ Befehlsform Anweisung Bitte . Infinitiv Grundform 1 Wortlehre: Verben Im Infinitiv stehen alle Verbformen, die nicht nach Person und Zahl bestimmt sind. Wir unterscheiden drei infinite Verbformen. der Infinitiv das Partizip 2 das Partizip 1 singen gesungen singend dürfen dürfend halten haltend kaufen . . vergeben . einschlafen . einschlafend sein seiend haben gehabt . werden . Hilfsverben Konjugation Beim Konjugieren wird das Verb in eine Personalform oder in den Imperativ gesetzt. Personalform: Das Verb richtet sich in der Einzahl oder Mehrzahl nach der Person einer Handlung. Singular Einzahl Plural Mehrzahl 1. Person 2. Person 3. Person Modalverben: Modalverben werden meistens mit einem anderen Verb eingesetzt. Sie sollen den Inhalt des andern Verbs verändern (modifizieren) können dürfen wollen mögen müssen sollen Ich lese den Text. . Du tust es. Er geht. 2 Wortlehre: Verben Wir tragen es. Ihr redet darüber. Sie schweigen. Stammformen INFINITIV, PRÄTERITUM und PARTIZIP2 werden „Stammformen genannt, weil sich von ihnen andere Verbformen ableiten lassen. Stammformen INFINITIV PRÄTERITUM PARTIZIP 2 Grundform Vergangenheitsform Mittelwort der Vergangenheit Konjugation schwach suchen suchte gesucht legen . klagen trennen kochen . finden fand gefunden liegen . laufen tragen . triefen brennen brannte gebrannt bringen mögen . dürfen . sein . stehen . ziehen . kein Vokalwechsel nur t-Endungen Konjugation stark Vokalwechsel keine t-Endungen Konjugation Beachte die Vokalwechsel. Bei vielen Verben schwankt der starke und schwache Gebrauch. Oft haben die starken Formen eine andere Bedeutung als die schwachen. 3 Wortlehre: Verben INFINITIV PRÄTERITUM PARTIZIP 2 Grundform Vergangenheitsform Mittelwort 2 1. Stammform 2. Stammform 3. Stammform Beispielsätze bewegen bewog bewogen Was bewog dich, auf die Ferien zu verzichten? bewegte bewegt Sein Tod hat mich sehr bewegt. erschrecken erschrak erschrocken Er war fürchterlich erschrocken. erschreckte erschreckt schaffen schuf geschaffen Er hatte ein beachtliches Werk geschaffen. . schaffte geschafft Sie hatte den Abfall weggeschafft. hängen hing gehangen Der Ballon hat an einem Ast gehangen. hängte gehängt Der Gast hängte den Kittel auf quellen quoll gequollen quellte gequellt Die Nässe hatte den Karton aufgequellt. Konjunktiv Konjunktiv 1: Der Konjunktiv wird vom Infinitiv abgeleitet. Der konjunktiv 1 dient zur Bildung der indirekten Rede: Sie sagt, er arbeite 4 Wortlehre: Verben in der Stadt. Infinitiv Konjunktiv 1 Infinitiv Konjunktiv arbeiten er arbeite mögen er brennen er nehmen er bringen er schliessen er denken er stehen er haben er tun er kommen er werde er legen er ziehen er Direkte indirekte Rede Direkte Rede: In der direkten Rede wird eine Äusserung so genau wörtlich aufgeführt, wie sie tatsächlich gemacht wird. Rahel sagt leise: „Das habe ich ihr nicht gesagt. Melanie stellt fest: „Die Fenster sind nicht mehr dicht. Erika meint: „Wenn du die Einkäufe besorgt hast, hole ich dich ab. Gabriel fragt: „Hast du meine Uhr gefunden? Peter verspricht: „Diese Woche helfe ich dem Nachbarn beim Mähen. Ich befahl ihm: „Füttere die hungrigen Vögel. Indirekte Rede: In der indirekten Rede wird über eine Äusserung berichtet. Der Hörer der direkten Botschaft oder ein Dritter gibt als Sprecher eine bereits gemachte Aussage berichtend weiter. Die indirekte Rede wird niemals mit Anführungs- und Schlusszeichen angezeigt. Gib die oben aufgeführten Sätze berichtend in der indirekten Rede weiter. Beachte, dass der Übergang von der direkten zur indirekten Rede einen Personenwechsel bringt. Zum Bilden der indirekten Rede braucht man den Konjunktiv 1 Rahel sagt leise, Melanie stellt fest, Erika meint, Gabriel fragt, 5 Wortlehre: Verben Peter verspricht, Ich befahl ihm, Varianten mit „dass Rahel sagt leise, dass sie ihr das nicht gesagt habe. Melanie stellt fest, dass Erika meint, dass Gabriel fragt, dass Peter verspricht, dass Ich befahl ihm, dass direkte Rede Du sagtest: „Ich bin neugierig: indirekte Rede indirekte Formulierung Du sagtest, du seist neugierig. Du sagtest, dass du neugierig seist. Du sagtest mir: „Du bist neugierig. Du sagtest ihm: „Du bist neugierig. Er sagte: „Ich bin neugierig. Er sagte: „Es war lustig. . . . . . . . Aktiv- und Passivform Passivform: Mit der Passivform wird die Ursache oder der Verursacher einer Handlung bewusst in den Hintergrund gerückt. Die Passivform wird auch „Leideform genannt. Im Gegensatz zur Aktivform stimmt beim Passiv das Subjekt nicht mit dem Handelnden überein Der Bus wird von einem erfahrenen Chauffeur gesteuert. 6 Passivform. Nicht der Bus, der Chauffeur ist der „Handelnde. Wortlehre: Verben Ein erfahrener Chauffeur steuert den Bus. Aktivform. Der Chauffeur, nicht der Bus ist der „Handelnde. Aktivform Der Blitz trifft die Kirchturmspitze. Passivform Die Kirchturmspitze wird vom Blitz getroffen. Aktivform Passivform . . Aktivform . . Passivform . . Aktivform . . Passivform . Personalformen 1 5 9 13 17 21 25 duzen gehören können müssen geben sein helfen 2 6 10 14 18 22 26 sein ansprechen stehen werden sein sagen aufstehen 3 7 11 15 19 23 27 sein werden können mögen gehören begrüssen 4 8 müssen 12 wünschen 16 20 24 28 siezen haben sollen sollen anbieten grüssen Setze die aufgeführten Verben im Text ein. Umgangsformen 7 Wortlehre: Verben Die jungen Menschen 1 einander. Das eigentlich auch verständlich, Erwachsenenalter jedoch 3 2 recht so und sie doch auch Altersgenossen. Im 4 man ohne gegenseitige Vereinbarung Unbekannte, auch wenn sie zur gleichen Arbeitsgruppe 5 Wann beginnt das Ansprechen mit „Sie? So etwa nach dem Volksschulaustritt, also mit 16 Jahren, 6 Erwachsene die Jugendlichen mit „Sie 6.1. Manchen in die Lehre eingetretenen Schulabgänger 7 es eigenartig vorkommen, dass ihn am Arbeitsplatz und in der Berufsschule die Lehrkräfte siezen. Es wird ihm damit bewusst gemacht, dass er sich nun in einem neuen Lebensbereich – ins Arbeitsfeld der Erwachsenen – begeben 8 dass von ihm nicht mehr als Schüler, sondern als Lehrling die selbstständige Entfaltung seiner eigenen Fähigkeiten erwartet wird. Das Duzen unter Freunden und nahen Bekannten näher 10 Doch man 11 13 zeigen, dass man selber herausfinden, ob er junge Erwachsene diese Ansprechform noch Gleichberechtigung 9 12. Im Sinne der doch im Gegenzug auch jene Bekannten, die einen jungen Menschen nach der Volksschulzeit immer noch per Du ansprechen, das „Du anbieten 14 Oft Menschen mit einfacher Bildung oder bescheidenem Einkommen ohne gegenseitiges Einverständnis per „Du behandelt. Die Empfindungen, das Verständnis für geistige Werte oder die Moralvorstellungen unterschiedlich sein, doch die Umgangsform 16 15 zwar bei allen gleich sein. Eine Raumpflegerin soll im gleichen Masse höflich angesprochen werden, wie eine Bankdirektorin. Es 17 auch Gebiete in der Schweiz, wo Menschen anstelle von „Sie mit „Ihr angesprochen werden. Es erlauben 19 18 dort spezielle Dialekt, der das , doch in allen übrigen Gegenden ist das Ansprechen mit „Ihr ein Duzen. Es 20 beispielsweise in einem Restaurant nicht heissen: „Was wünsched Ihr?, sondern „Was wünschen Sie? In manchen Landesgegenden 21es früher üblich, dass die verheirateten Söhne und Töchter der Mutter nicht mehr „Du sondern in Ehrfurcht „Ihr 22 Ehrfurcht vor dem Alter haben wir heute noch, doch diese Anredeform ist nicht mehr verbreitet. 8 Wortlehre: Verben Zum guten Umgangston 23 auch, die Mitarbeiter am Arbeitsplatz, Bekannte im Quartier oder im Dorf zu grüssen, Älteren oder Frauen gleich welchen Standes den Vortritt zulassen, ihnen beispielsweise im vollbesetzten Zug den eigenen Platz 24. Selbstverständlich soll es auch sein, dass man einer Frau in den Mantel 27 25 , dass ein Mann 26, wenn er eine Frau Es ist zwar üblich, dass der Herr zuerst die Dame 28 . Doch es ist zu erwarten, dass Schülerinnen und Schüler, Lehrtöchter oder Lehrlinge ihre Vorgesetzten ob Mann oder Frau zuerst grüssen. Grammatische Übereinstimmung Welcher Satz ist richtig? Markiere jene Sätze, die richtig sind. Eine Menge fauler Äpfel lag unter dem Baum. Eine Menge fauler Äpfel lagen unter dem Baum Dieser Schrank und dieser Tisch bleiben in der Wohnung. Dieser Schrank und dieser Tisch bleibt in der Wohnung. Alt und Jung liess sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Alt und Jung liessen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Sie bekamen einen roten Kopf. Sie bekamen rote Köpfe. Die Küche und nicht der Kellner haben das Menü verwechselt. Die Küche und nicht der Kellner hat das Menü verwechselt. Viele haben damals ihren Beruf gewechselt. Viele haben damals ihre Berufe gewechselt. 9