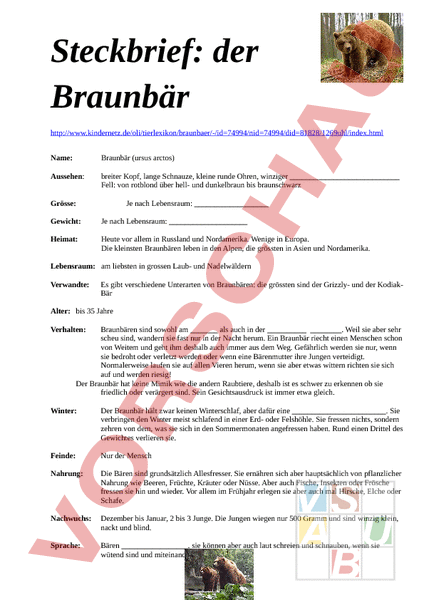Arbeitsblatt: Steckbriefe Wolf, Luchs, Bär
Material-Details
Ein Steckbrief über diese Raubtiere
Biologie
Tiere
5. Schuljahr
6 Seiten
Statistik
118828
1860
31
25.07.2013
Autor/in
Eliane Blumer
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Steckbrief: der Braunbär Name: Braunbär (ursus arctos) Aussehen: breiter Kopf, lange Schnauze, kleine runde Ohren, winziger Fell: von rotblond über hell- und dunkelbraun bis braunschwarz Grösse: Je nach Lebensraum: Gewicht: Je nach Lebensraum: Heimat: Heute vor allem in Russland und Nordamerika. Wenige in Europa. Die kleinsten Braunbären leben in den Alpen, die grössten in Asien und Nordamerika. Lebensraum: am liebsten in grossen Laub- und Nadelwäldern Verwandte: Es gibt verschiedene Unterarten von Braunbären: die grössten sind der Grizzly- und der KodiakBär Alter: bis 35 Jahre Verhalten: Braunbären sind sowohl am als auch in der . Weil sie aber sehr scheu sind, wandern sie fast nur in der Nacht herum. Ein Braunbär riecht einen Menschen schon von Weitem und geht ihm deshalb auch immer aus dem Weg. Gefährlich werden sie nur, wenn sie bedroht oder verletzt werden oder wenn eine Bärenmutter ihre Jungen verteidigt. Normalerweise laufen sie auf allen Vieren herum, wenn sie aber etwas wittern richten sie sich auf und werden riesig! Der Braunbär hat keine Mimik wie die andern Raubtiere, deshalb ist es schwer zu erkennen ob sie friedlich oder verärgert sind. Sein Gesichtsausdruck ist immer etwa gleich. Winter: Der Braunbär hält zwar keinen Winterschlaf, aber dafür eine . Sie verbringen den Winter meist schlafend in einer Erd- oder Felshöhle. Sie fressen nichts, sondern zehren von dem, was sie sich in den Sommermonaten angefressen haben. Rund einen Drittel des Gewichtes verlieren sie. Feinde: Nur der Mensch Nahrung: Die Bären sind grundsätzlich Allesfresser. Sie ernähren sich aber hauptsächlich von pflanzlicher Nahrung wie Beeren, Früchte, Kräuter oder Nüsse. Aber auch Fische, Insekten oder Frösche fressen sie hin und wieder. Vor allem im Frühjahr erlegen sie aber auch mal Hirsche, Elche oder Schafe. Nachwuchs: Dezember bis Januar, 2 bis 3 Junge. Die Jungen wiegen nur 500 Gramm und sind winzig klein, nackt und blind. Sprache: Bären, sie können aber auch laut schreien und schnauben, wenn sie wütend sind und miteinander kämpfen. Steckbrief: der Luchs Name: Luchs (lynx lynx) Lynx kommt aus dem Griechischen und bedeutet „funkeln, leuchten - Augen des Luchses Aussehen: beige bis rotbraunes, dunkel getupftes Fell, lange „Pinsel an den Ohren, Stummelschwanz, Backenbart Grösse: 80 cm bis 110 cm lang, 55 cm bis 65 cm hoch Gewicht: bis Heimat: Heute vor allem in Nord- und Osteuropa Lebensraum: Wälder Verwandte: gehören zur Familie der „Katzenartigen (wie Tiger, Löwe, Hauskatze) Es gibt 4 Luchsarten: Europäischer Luchs oder Nordluchs, Pardell-Luchs, Kanada-Luchs, RotLuchs Alter: in Freiheit bis , in Gefangenschaft bis Verhalten: Luchsen können im Dunkeln so gut sehen wie Menschen. Luchse streifen als durch die Wälder, meist sind sie in der Dämmerung und nachts aktiv. Sie leben in Revieren. Ihre Reviere markieren die Luchse mit Urin, und diese Duftmarken sagen anderen Luchsen: Hier wohne ich, und du hast hier nichts zu suchen. Feinde: Wolf, Bär aber vor allem der Nahrung: Luchse jagen meist in der Dämmerung. Sie töten ihr Opfer mit einem ins Genick oder die Kehle. Luchse haben viele Beutetiere: Von Fröschen über Mäuse und Hasen bis zum Reh und Hirsch fressen sie alles. Meist ernähren sie sich jedoch von Rehen und Gämsen. Ein Luchs braucht pro Woche ein Reh; das sind etwa Fleisch! Nachwuchs: Mai bis Juni, 2 bis 4 Junge. Das Junge wiegt nur 250 -300 und ist noch blind. Sprache: Luchse miauen ähnlich wie unsere . Zur Paarungszeit kann man von den Männchen schon mal ein Knurren und Heulen hören. Steckbrief: der Wolf l Name: Wolf (canis lupus) Aussehen: Fell je nach Lebensraum: dunkelgrau bis dunkelbraun, schwarz, weiss, hellbraun, blond; buschiger Schwanz (30 cm bis 40 cm) Grösse: 110 cm bis 140 cm lang, 65 cm bis 80 cm hoch Gewicht: zwischen Heimat: Heute vor allem in Nordamerika und Osteuropa, kleine Rudel in Italien, Frankreich, Spanien Lebensraum: Wölfe können sich sehr gut anpassen: Wälder, Wüsten, Küsten, Gebirge Verwandte: Wölfe sind die wilden Vorfahren unserer . Es gibt etwa 12 verschiedene Unterarten Alter: etwa 10 bis 12 Jahre Verhalten: Wölfe sind . Sie leben in großen Familien (ca. 10 bis 12 Tiere, manchmal auch bis zu 20) zusammen und wissen, dass sie nur gemeinsam stark genug sind, um große Beutetiere erlegen zu können. Wölfe sind meist dämmerungs- und nachtaktiv. Feinde: Luchs, Bär aber vor allem der Mensch Nahrung: Vor der Jagd heulen die Wölfe. Oft jagen zwei Wölfe das Beutetier, während sich die anderen verstecken und dem erschöpften Reh oder Hirsch auflauern, um es zu überwältigen. Ist die Beute erlegt, fressen alle gemeinsam. Auch für die rangniederen Tiere fällt genug Nahrung ab. Da Wölfe meist schwache oder kranke Tiere jagen, sind sie für das Ökosystem besonders wichtig. Sie sorgen dafür, dass nur gesunde Tiere überleben und sich fortpflanzen. Wenn der Wolf, so wie in der Schweiz, eher alleine lebt, jagt er auch mal (gesunde) Schafe oder Kälber, sehr zum Ärger der Hirte und Bauern. Je nach Lebensraum jagen sie Elche, verschiedene Hirscharten, Wildschweine, Steinböcke, Hasen, Mäuse. Manchmal fressen sie auch Aas. Nachwuchs: Februar bis Mai, 3 bis 6 Welpen, die noch blind sind. Sprache: Genau wie unsere Haus-Hunde können Wölfe knurren, jaulen und bellen. Berühmt sind sie jedoch für ihr , das vor allem im Winter und Frühjahr in der Nacht zu hören ist. In der Schweiz Der Bär Im Alpenraum hat sich in Italien, Slowenien und Österreich eine Bärenpopulation angesiedelt. Die Bären haben sich der Schweiz bis auf wenige Dutzend Kilometer genähert. Die letzten Alpenbären leben bei Madonna di Campiglio in der italienischen Provinz Trentino, 60 Kilometer vom Schweizerischen Nationalpark entfernt. Diese wenigen Tiere sollen durch Aussetzung von slowenischen Bären verstärkt werden. Falls es wirklich zu Aussetzungen kommt, ist eine Zuwanderung von Bären in den Park innerhalb der nächsten 20 Jahre nicht auszuschliessen. Wölfe breiten sich von den italienischen Abbruzzen Richtung Norden aus und haben bereits den südwestlichsten Teil des Alpenbogens erreicht. Wie erfolgreich die weitere Rückeroberung sein wird, hängt unter anderem von unserer Toleranz bei allfälligen Schäden ab. Wölfe sind Raubtiere, die sich in erster Linie von Huftieren und Schafen ernähren. Der letzte wildlebende Braunbär der Schweiz wurde 1904 im Gebiet des Val Mingèr durch die Kugeln eines Jägers erlegt. Der Schweizer Nationalpark liegt im Südosten des Kantons Graubünden. Der Park liegt im Unterengadin im Dreieck der Orte Zernez und Scuol/ Schuls und dem Ofenpass. 2012: Ein einziger Bär Noch bedenklicher fällt die WWF-Jahresbilanz beim Bär aus. Mit M12 undM13 aus dem Trentino haben nur zwei Bären den Weg in die Schweiz gefunden. M12 wurde schliesslich im Südtirol überfahren, M13 sorgte im Puschlav für Aufregung, bevor er in Winterruhe ging. Giftköder wurden ausgelegt und einzelne Jäger sprachen gar öffentlich vom Abschuss des Bären. Der Umgang mit dem Bären muss im Puschlav erlernt werden, denn M13 wird nicht der letzte Bär sein, der in die Schweiz kommt, sagt Eichenberger. Die Bärenpopulation im nahen Trentino wächst stetig und weitere Bärenbesuche sind nur eine Frage der Zeit. Bärensichere Abfallcontainer, Herdenschutz und die Sicherung von Bienenhäusern wurden im benachbarten Münstertal erprobt und müssen auch im Puschlav Schule machen. Quelle: WWF Schweiz 2012 Der Wolf Wölfe waren früher über den ganzen europäischen Kontinent verbreitet. Im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts wurden sie aus Mitteleuropa verdrängt. Mitte dieses Jahrhunderts lebten noch kleine Wolfsbestände in Südeuropa, grössere in Osteuropa und Skandinavien. Seit den 80er Jahren breiten sich Wölfe von Italien und Slowenien wieder in die Alpen aus. 1995, also 123 Jahre nachdem der letzte Schweizer Wolf im Tessin erlegt worden war, traten im Wallis wieder freilebende Wölfe auf. Wölfe breiten sich von den italienischen Abbruzzen Richtung Norden aus und haben bereits den südwestlichsten Teil des Alpenbogens erreicht. 2012: Insgesamt 17 Wölfe ein Wolfsrudel Seit 1995 wandern immer wieder Wölfe in die Schweiz ein, doch mit 17 Wölfen sind wir immer noch meilenweit von einem überlebensfähigen Bestand entfernt, sagt Kurt Eichenberger, Grossraubtierexperte beim WWF Schweiz. Bei den meisten Wölfen in der Schweiz handelt es sich um einzelne Männchen (Wallis, Tessin, Zentralschweiz) oder ein einzelnes Weibchen (Bern/Freiburg). Die Hälfte der Wölfe leben in der bündnerischen Calanda, wo Wildhüter vor Wochenfrist acht Wölfe beieinander sichteten. Im Frühjahr konnte dort das erste Schweizer Rudel nachgewiesen werden. Das Wolfspaar mit drei Jungen hat in den letzten Wochen Zulauf von weiteren zuvor wohl einzelgängerisch lebenden Wölfen bekommen. Trotz dieser aufsehenerregenden Meldung aus Graubünden: In unseren Nachbarländern Italien und Frankreich haben sich die Wolfs-Bestände viel besser entwickelt: Innert 20 Jahren haben sich im Alpenraum mindestens 30 Wolfsrudel gebildet, dort sind 400 Wölfe unterwegs. Quelle: WWF Schweiz 2012 Der Luchs Um 1700 war der Luchs noch in der ganzen Schweiz heimisch. 1894 wurde der letzte Luchs im Wallis getötet. 1971 bis 1976 wurden in den Kantonen OW, NE und VD Luchse ausgesetzt. Heute haben die Luchse einen beträchtlichen Teil des zentralen und westlichen Alpen- und Voralpengebietes besiedelt. Ein wissenschaftlich betreutes Projekt versucht seit kurzem die Wiederansiedlung in der Ostschweiz. In den Nordwestalpen haben sich die Luchse stark vermehrt. Zur Zeit leben knapp 60 erwachsene Luchse in dieser Region. Sie können sich nicht auf natürliche Weise weiter ausbreiten, weil ihnen Flüsse, Seen sowie Siedlungen und Autobahnen den Weg versperren. In dieser Region führten Schafrisse und eine Abnahme des Wildbestandes zu Konflikten mit Schafzüchtern und Jägern. Trotz des relativ grossen Bestandes in den Nordwestalpen ist die Zahl der Luchse zu gering und ihr Lebensraum zu klein, um das langfristige überleben der Art zu sichern. 2012: Rund 130 Luchse Einzig beim Luchs gibt es in der Schweiz inzwischen einen Lichtblick. Nach der Auswertung von Fotofallen leben heute rund 130 Luchse in der Schweiz, aufgeteilt auf drei Populationen im Jura, in den Nordwestalpen (aufgrund von Wiederansiedlungen von Tieren aus den slowakischen Karpaten in den 1970er Jahren) und in der Nordostschweiz (aufgrund von Umsiedlungen aus den Alpen und dem Jura vor 10 Jahren). Der Bestand ist aber verletzlich und braucht Blutauffrischung. Wie schnell sich Inzucht bemerkbar machen kann, zeigt die Situation in Slowenien, wo der Luchsbestand in den letzten Jahren regelrecht zusammenbricht. Quelle: WWF Schweiz 2012