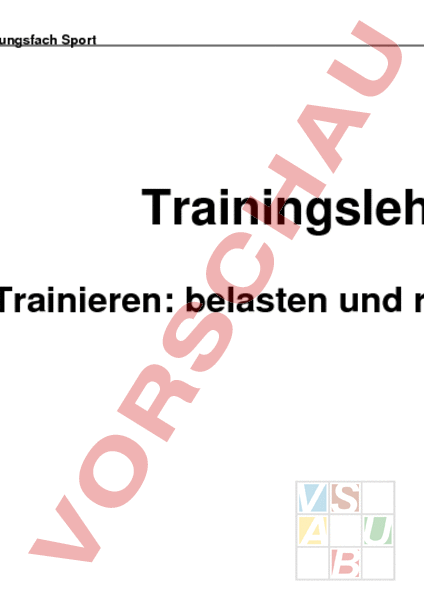Arbeitsblatt: Trainingslehre
Material-Details
Für SuS, die sich vorstellen können, eine Ausbildung im Sportbereich zu machen. Basiswissen über die Trainingslehre.
Bewegung / Sport
Anderes Thema
12. Schuljahr
1 Seiten
Statistik
120080
1137
7
29.08.2013
Autor/in
David Kobel
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Trainingslehre „Trainieren: belasten und regenerieren 1 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Was bedeutet eigentlich „trainieren? • Erhöhung der Belastungstoleranz • Entwicklung optimaler Leistungsvoraussetzungen • Ausschöpfung von Entwicklungspotenzialen • Fähigkeit, die bestmögliche Leistung in Bewährungssituationen abzurufen 2 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Wie passt sich der Körper den Veränderungen an? • Strukturelle Anpassung – Zunahme an Masse und Grösse • Muskelfaserquerschnitt nimmt zu, Sehnen und Bänder werden massiver, Knochenmasse wird dichter, Herzvolumen wird grösser, zusätzliche Kapillaren bilden sich • Funktionelle Anpassung – Optimierung bestimmter Funktionen • Organfunktionen werden Bedürfnissen angepasst (Bsp. schnellere Erholung), reibungslosere Stoffwechselprozesse, fliessendere Bewegungsabläufe • Lokale Anpassung – strukturelle funktionale Veränderungen, die trainiert werden • mehr Kapillaren, Glykogen und Fettspeicher werden vergrössert • Systematische Anpassung – strukturelle funktionelle Veränderungen, die dem ganzen Organismus dienen • Transportkapazität für Sauerstoff nimmt zu, grösseres HerzMinutenVolumen aufgrund erhöhtem Schlagvolumen Die Organfunktionen werden durch das vegetative Nervensystem und das Hormonsystem optimal reguliert! 3 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Superkompensation ist die Antwort auf HomöostaseStörungen Unser Gewebe befindet sich in einem ununterbrochenen Auf und Abbau. Ändern sich die körperlichen Bedingungen, reagiert unser Körper sofort und stellt sich darauf ein. • Homöostase: – Gleichgewicht zwischen anabolen (aufbauend) und katabolen (abbauenden) Prozessen – Beispiele: • Rote Blutkörperchen • Proteine • HomöostaseStörung: – Durch überschwelliges Training wird die Homöostase kurzfristig gestört und es kommt zu einem verstärkten Abbau, die Energiereserven ( Glykogenspeicher) werden entleert. 4 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Die Superkompensation im Bild 5 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Beschrifte die einzelnen Phasen 6 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Der Begriff „Training 7 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Der Begriff „Übertraining 8 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal „Jeder Mensch ist trainierbar, aber nicht jeder hat die Voraussetzungen zum Hochleistungs und Spitzensportler! (Jost Hegner, Training fundiert erklärt) • Was passiert genau in unserem Körper? • Trainingsreiz erhöhte Aktivität bestimmter Gene entsprechende Proteine werden aufgebaut. • Der Begriff der Genexpression • Transkription: Synthese einer mRNAKopie von einem DNAAbschnitt im Zellkern • Splitting: PrämRNA wird durch EditingEnzyme gesplittet, rearrangiert und modifiziert • Translation: Informationsgehalt eines mRNA Moleküls wird in ein Protein umgesetzt. 9 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Genexpression nochmals anders dargestellt DNA Transkription prämRNA mRNA Protein Splitting Translation 10 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Proteine setzen die genetischen Informationen um • Ein kurzer Exkurs über die Proteine: – Unterscheidung von Proteinen • • • • Größe: Insulin 51 AS, Serumalbumin 584 AS Form: globulär, fibrillär etc. Konformation: einfach oder zusammengesetzt Lokalisation: intra/extrazellulär, zytosolisch oder in der Membran – Struktur • • • • Primärstruktur: Aminosäuresequenz Sekundärstruktur: Helix, Faltblatt Tertiärstruktur: räumliche Faltung der Aminosäurekette Quartärstruktur: räumliche Struktur von Proteinkomplexen 11 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Proteine setzen die genetischen Informationen um • Struktur – Sekundärstruktur (Helix) 12 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Proteine setzen die genetischen Informationen um • Struktur – Sekundärstruktur (Faltblatt) 13 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Proteine setzen die genetischen Informationen um • Struktur – Tertiärstruktur (räumliche Faltung der Aminosäurekette) – Quartärstruktur (räumliche Struktur von Proteinkomplexen) 14 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Proteine setzen die genetischen Informationen um Aminosäuren mit hydrophoben Resten • Bausteine – • 20 verschiedene Aminosäuren, die ununterbrochen auf und wieder abgebaut werden Vorkommen – – – Aminosäuren mit hydrophilen Resten Dipeptide Oligopeptide 2100 Aminosäuren Proteine (Eiweiße): 100 Aminosäuren saure Aminosäuren basische Aminosäuren • Enzyme: Biokatalysatoren‚ – – – Zelle Fabrik, Zellorganellen Maschinen, Enzyme Arbeiter mehr als 2000 Enzyme bekannt Leberzelle: ca. 50 Millionen Enzymmoleküle Neutrale Aminosäuren 15 Aromatische Aminosäuren Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Proteine setzen die genetischen Informationen um • Während dem Training arbeiten die Proteine in unserem Körper. • Durch intensive Beanspruchung erhöht sich die Syntheserate. • Verschiedene Proteine, verschiedene Aufgaben – – – – – Motorproteine: Enzyme: Transportproteine: Strukturproteine: Rezeptorproteine: – Genregulatorproteine: Arbeit in den Muskelfasern Stoffwechsel Binden und transportieren bestimmte Ionen und Moleküle Mechanische Stütze für Gewebe und Zellen Empfangen und weiterleiten von Signalen innerhalb einer Zelle binden sich an bestimmten Stellen an die DNA, um die Aktivität bestimmter Gene zu regulieren. 16 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Die Trainingseffekte sind vielseitig und zahlreich • NervMuskelSystem – – – – • Funktionelle und strukturelle Anpassung Optimale neuromuskuläre Koordination Leistungsfähiger Energiestoffwechsel Optimale Sauerstoff und Substratversorgung Passiver Bewegungsapparat – Gute Knorpel und Knochenstruktur sowie funktionstüchtige Gelenke – Belastungstolerante Wirbelsäule – Zugfestigkeit und gute Elastizität von Sehnen und Bändern • Stoffwechselsysteme – Optimierung der Enzymaktivität • Baustoffwechsel, ATPProduktion, Transport/Ausscheidung von Stoffwechselprodukten 17 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Die Trainingseffekte sind vielseitig und zahlreich • Atmungs und Transportorgane – – – – • Vegetatives Nervensystem, Hormonsystem – – – – • Funktionstüchtiges Atmungssystem, insbesondere Atmungsmuskulatur Belastbares HerzKreislaufSystem Grösseres Blutvolumen dank mehr roten Blutkörperchen Höhere Pufferkapazität und Laktattoleranz Regulation aller HerzKreislauf und Atmungsfunktionen Anpassung des Bau und Betriebsstoffwechsels an die aktuellen Bedürfnisse Besserer Flüssigkeits und Elektrolythaushalt sowie bessere Temp.Regulation Optimierte Erholungs, Regeneration und Anpassungsfähigkeit Wahrnehmungsorgane, zentrales und peripheres Nervensystem – Entwicklung von „Special Team‘s, welche Informationen schneller umsetzen – Optimierung der synaptischen Effizienz (bessere neuronale Vernetzung) – Optimierung der Kapazität für Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen 18 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Die Trainingseffekte sind vielseitig und zahlreich Jost Hegner, Training fundiert erklärt, S.99 19 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Hormone: Regulation der Anpassungsbereitschaft Lokaler Reiz Ausschüttung von Botenstoffen über die Blutbahn Steigerung der Produktion Von bestimmten Proteinen Zelle Zelle Lokale Reaktion • Beispiel: Testosteron stimuliert die Proteinsynthese (unerlässlich für den Muskelaufbau) und fördert die Konditionsfähigkeit. 20 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Die Trainingsbelastung: „die Dosis macht‘s! Exogene Faktoren von aussen einwirkend Trainingsinhalte, methoden, mittel Ernährung Art der Beanspruchung Jahreszeit und klimatische Faktoren Anpassungsprozedere Soziales Umfeld Endogene Faktoren im Körper selbst Genetische Faktoren: Anpassungspotenzial Psychisch-emotionale Einflüsse Trainingszustand Alter, Geschlecht, Hormonhaushalt Eigenschaften des belasteten Gewebes Regenerative Massnahmen 21 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Die Trainingsbelastung: „die Dosis macht‘s! • • Zu intensive/wenig Belastung Optimale Belastung bionegative Folgen (Leistungsfähigkeit sinkt) biopositive Folgen (Leistungsfähigkeit und Belastungstoleranz steigen) Jost Hegner, Training fundiert erklärt, S.101 22 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Die Trainingsbelastung: „die Dosis macht‘s! • • • • • • Nur wer optimal trainiert, kann seine Leistung steigern. Untrainierte erreichen schneller eine Leistungssteigerung. Trainierte müssen oftmals an ihre Leistungsgrenzen gehen, um weiterzukommen. Der Grat zwischen überschwelligem und unterschwelligem Training ist sehr schmal. Nur wer sich optimal regeneriert, sieht nach dem Training den gewünschten Effekt! Belastung im Training nur so weit steigern, dass die langsam adaptierenden Systeme Schritt halten können, vor allem die Strukturen des Bewegungs und Stützsystems. Achtung: SUPERKOMPENSATION!!!!! 23 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Regeneration und Anpassung braucht Zeit! • • Unser Körper „trainiert auch dann, wenn wir uns erholen. Wir unterscheiden zwischen: – SofortRegeneration • ATP und KreatinphosphatSpeicher werden gefüllt – Kurzfristige Regeneration (innerhalb von 6 Stunden) • • • • Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz gehen auf Ruhewerte zurück Laktatabbau, phWert normalisiert sich Flüssigkeits und Elektrolythaushalt wird stabilisiert Glykogenspeicher füllen sich wieder – Mittelfristige Regeneration (zwischen 6 bis 36 Stunden) • Glykogen und Lipidspeicher in Muskelfasern und in Leber werden aufgefüllt • Kontraktile Proteine sowie Enzyme der anaeroben Glykolyse werden synthetisiert – Langfristige Regeneration (Tage bis Wochen) • ProteinResynthese wird abgeschlossen, Mitochondrien werden produziert • Binde und Stützgewebe regenerieren und adaptieren 24 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Regeneration und Anpassung braucht Zeit! • Ein Leistungseinbruch resultiert aus zu wenig Erholung! • Overreaching: – kurzfristiger Leistungseinbruch – Diagnose: Leistungsstagnation, Müdigkeit, Unlust, saure Muskeln, depressive Verstimmung, usw. – Erholung dauert ca. 2 Wochen – Superkompensation immer noch möglich • Overtraining Syndrom: – Krankhafter Symptonkomplex zurückzuführen auf eine systemische Erschöpfung – Diagnose: Reduktion von Maximalleistung, max. Herzfrequenz, Schlafprobleme, Appetitlosigkeit, psychomatische Beschwerden, usw. – Erholung dauert mehrere Wochen bis Monate – Prävention: ein Overreaching muss erkannt werden! – Therapie: vollständige Reduktion der Belastung über 6 Wochen bis 2 Monate 25 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Trainingslehre „Trainingsgrundsätze 26 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Pädagogische Trainingsgrundsätze • • • • Kind Jugendlicher Erwachsener Es bestehen wesentliche Unterschiede in der Trainingsgestaltung betreffend Umfang, Intensität, Trainingsverfahren, etc. Gleichgewicht muss immer vorhanden sein!! sportliche Entwicklung vs. persönliche Entwicklung Ein Trainer hat nebst der sportlichen/zielorientierten Aufgabe auch ein hohes Mass an pädagogischer Verantwortung. 27 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Methodische Trainingsgrundsätze • Prinzip der Individualität und Altersgemässheit – Rücksicht auf psychische und physische Voraussetzungen der Trainierenden • Prinzip des optimalen Belastungsreizes – Art und Stärke der Reize bestimmt die Anpassungen. • Prinzip der Kontinuität – Regelmässigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. • Prinzip der optimalen Gestaltung von Belastung und Erholung – Erholungsphasen (physische und psychische) gehören in jeden Trainingsplan. • Prinzip der progressiven Belastungssteigerung – Erhöhung: – Steigerung: 1. Trainingshäufigkeit 3. Belastungsumfang 2. Belastungsdichte 4. Belastungsintensität 28 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Methodische Trainingsgrundsätze Beispiel der progressiven Belastungssteigerung Erhöhung: 1. der Trainingshäufigkeit – mehr Trainingstage pro Woche 2. der Belastungsdichte – kürzere Pausen, wodurch der Muskel schneller ermüdet Steigerung: 3. des Belastungsumfanges – mehr Sätze pro Übung, mehr Übungen pro Muskelgruppe 4. der Belastungsintensität – Gewichtserhöhung, höhere Herzfrequenz 29 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Methodische Trainingsgrundsätze • Prinzip der Variation der Trainingsbelastung – Sie stellen für den angesprochenen Bereich (vegetatives Nervensystem) eine Unterbrechung der Belastungsmonotonie dar und verursachen als ungewohnte Belastungsreize weitere Homöostasestörungen mit nachfolgenden Anpassungen. • Prinzip der Periodisierung und Zyklisierung – umfangbetonte Belastungen disziplinspezifische Fähigkeiten – individuelle Fähigkeiten müssen bei der Trainingsplanung berücksichtigt werden – regelmässige Standortbestimmungen • Prinzip der unterschiedlichen Adaptionsprozesse – Muskulatur adaptiert rascher als passiver Bewegungsapparat • Prinzip der optimalen Belastungsfolge – Im erholten Zustand: Koordination, Technik, Schnelligkeit – Vor dem Ausdauertraining: Kraft 30 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Trainingslehre „Training im Kindes und Jugendalter 31 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Training im Kindes und Jugendalter • Kalendarisches vs. biologisches Alter – Biologisches Alter wird bestimmt durch: • Körperdimensionen • Knochenalter • Entwicklungsstand der Sexualfunktionen, Motorik, aerobe/anaerobe Leistungsfähigkeit – Biologisches Alter kann bis zu 3 Jahren nach vorne/hinten vom kalendarischen Alter abweichen • retardiert vs. akzeleriert – Entwicklungsstand kann • synchronnormal • synchronakzeleriert oder synchronretardiert • Asynchronakzeleriert oder asynchronretardiert verlaufen • Dem Entwicklungsstand muss im Sport Rechnung getragen werden?! 32 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Training im Kindes und Jugendalter • Talent – bestimmt durch die Erbanlagen und Umwelteinflüsse – durch qualifizierte Förderung werden überdurchschnittliche Leistungen erbracht – polysportive Förderung im Kindesalter bringt langfristig grössere Erfolge • Sensitive Phase nutzen!! – Kindesalter: Entwicklung des zentralen Nervensystems (sensomotorische, koordinative Fähigkeiten) – Pubertät: Entwicklung der konditionellathletischen Leistungsvoraussetzungen • Sportärztliche Betreuung – regelmässige Kontrolle der körperlichen Entwicklung – Beratung des Trainingsplanes in Bezug auf Belastung und Regeneration – Beratung betreffend Ernährung und gesundheitsfördernden Massnahmen 33 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Trainingslehre „Trainingsplanung 34 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Trainingsplanung • Die Phasen der langfristigen Trainingsplanung • Grundlagentraining • Aufbautraining • Hochleistungstraining 35 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Trainingsplanung • Grundlagentraining (Entwicklung der polysportiven Grundlagen) – – – – – – – – – – – koordinative Fähigkeiten motorische Grundfertigkeiten psychophysische Belastungstoleranz kognitive und mentale Fähigkeiten konditionelle Fähigkeiten technischtaktische Kenntnisse psychische und emotionale Fähigkeiten Langzeitinteressen Vielseitigkeit statt Spezialisierung Förderung der harmonischen Entwicklung aller Organe und Organsysteme kontinuierliche Entwicklung des Leistungspotenzials auf möglichst breiter Basis 36 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Trainingsplanung • Aufbautraining (Aufbau auf den Grundlagen) – erwerben eines ausgereiften sportartspezifischen Könnens – Spezialisierung in bestimmten Disziplinen – Entwicklung optimaler Bedingungen für ein spezialisiertes, hochintensives Training – sportarten und disziplinspezifisches Training wird forciert • Hochleistungstraining – Anpassungs und Entwicklungspotenzial soll voll ausgeschöpft werden – Trainingsmethoden erfordern sehr gut entwickelte Grundlagen und eine hohe Belastungstoleranz 37 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Trainingslehre „Wir erstellen unseren Trainingsplan 38 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal „Wir erstellen unseren Trainingsplan Mit der Trainingsplanung skizzieren wir den Weg zum Ziel. 1. Wir entwickeln unsere Visionen und definieren die übergeordneten Ziele. Unser Ziel Wir absolvieren den Halbmarathon von Winterthur (Sonntag, 26.05.2013) in der bestmöglichen Zeit. 39 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal 40 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal „Wir erstellen unseren Trainingsplan 2. Wir analysieren die Anforderungen und überlegen uns, welche – psychischemotionalen – intellektuellkognitiven – koordinativtechnischen und – konditionellen Eigenschaften es braucht, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Wir erstellen ein Anforderungsprofil 41 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal „Wir erstellen unseren Trainingsplan 3. Wir machen eine Standortbestimmung und analysieren den Ist Zustand, unser momentanes Leistungspotenzial; wir erstellen ein aktuelles, persönliches Leistungsprofil. IstZustand wird ermittelt mittels 5kmLauf. 4. Wir vergleichen den IstZustand mit dem Anforderungsprofil und ziehen Bilanz. 5. Wir legen unser Konzept für die Jahrestrainingsplanung fest. 6. Wir erstellen den Jahrestrainingsplan und definieren unsere Teil und Etappenziele. 7. Wir entwerfen ein Trainingstagebuch. 8. Wir legen die Evaluationsinstrumente und die Kriterien für die Beurteilung der Trainingserfolge fest. 42 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Trainingslehre „Regulation der Motorik Die Koordination 43 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Die Koordination • • • • Koordination: Steuerung und Regulation der Motorik Kondition: Kraft und Ausdauer Koordination und Kraft stehen in einer Wechselbeziehung zueinander gesteuert wird alles durch das zentrale Nervensystem (ZNS) • Die Bewegungsregulation basiert auf einem ständigen Informationsaustausch zwischen dem ZNS und den Muskeln, Sehnen und Bändern 44 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Die Koordination • Unterschied zwischen Fähigkeiten und Fertigkeiten • Fähigkeit (motor ability) – – kann man nicht neu erwerben werden unterteilt in • • • • • Fertigkeiten (skills) – – – • psychischemotional intellektuellkognitiv koordinativtechnisch physischkonditionell automatisierte Komponenten menschlicher Tätigkeiten aufgaben oder situationsspezifisch werden erlernt koordinative Fähigkeiten – – endogene Voraussetzungen zur Regulation von Bewegungshandlungen koordinative Fähigkeiten sind die Voraussetzung für das Erlernen von Fertigkeiten 45 Ergänzungsfach Sport Kantonsschule Glattal Die Koordination Komponenten der koordinativen Fähigkeiten (bekannt aus GHW!!) • Gleichgewichtsfähigkeit – • Differenzierungsfähigkeit – • Bsp. Fechten (schnelles Reaktionsvermögen) Orientierungsfähigkeit – • Bsp. Service (langsam und schnell aufschlagen) Reaktionsfähigkeit – • Bsp. Stabilisationsübungen Bsp. Skiakrobatik oder Turmspringen Rhythmisierungsfähigkeit – Bsp. Hürdenlaufen, Tanzen, etc. 46