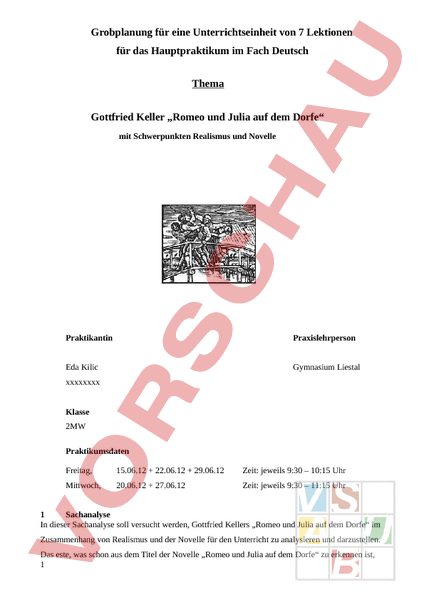Arbeitsblatt: LNW zu Kellers "Romeo und Julia auf dem Dorfe"
Material-Details
Unterrichtsreihenplanung von 7 Lektionen am Gymnasium; mit Schwerpunkten Realismus und Novelle
Deutsch
Leseförderung / Literatur
7. Schuljahr
14 Seiten
Statistik
120812
1739
31
10.09.2013
Autor/in
Eda Kilic
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Grobplanung für eine Unterrichtseinheit von 7 Lektionen für das Hauptpraktikum im Fach Deutsch Thema Gottfried Keller „Romeo und Julia auf dem Dorfe mit Schwerpunkten Realismus und Novelle Praktikantin Praxislehrperson Eda Kilic Gymnasium Liestal xxxxxxxx Klasse 2MW Praktikumsdaten Freitag, 15.06.12 22.06.12 29.06.12 Zeit: jeweils 9:30 – 10:15 Uhr Mittwoch, 20.06.12 27.06.12 Zeit: jeweils 9:30 – 11:15 Uhr 1 Sachanalyse In dieser Sachanalyse soll versucht werden, Gottfried Kellers „Romeo und Julia auf dem Dorfe im Zusammenhang von Realismus und der Novelle für den Unterricht zu analysieren und darzustellen. Das este, was schon aus dem Titel der Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe zu erkennen ist, 1 dass es eine Verbindung zu Shakespeares „Romeo und Julia aufweist. Doch hat Keller häufig betont, sein Werk basiere nicht auf der Grundlage des Dramas, sei sondern aus dem Alltagsleben gefunden. Wie er auf diese Liebesgeschichte zweier Bauernkinder aus verfeindeten Familien gestossen ist, gibt er mit dem Ursprung einer Zeitungsnotiz aus der Zürcher „Freitagszeitung vom 3.9.1847 an: „Im Dorfe Altsellerhausen, bei Leipzig, liebten sich ein Jüngling von 19 Jahren und ein Mädchen von 17 Jahren, beide Kinder armer Leute, die aber in einer tödlichen Feindschaft lebten und nicht in eine Vereinigung des Paares willigen wollten. Am 15. August begaben sich die Verliebten in eine Wirtschaft, wo sich arme Leute vergnügen, tanzten daselbst bis nachts 1 Uhr und entfernten sich hierauf. Am Morgen fand man die Leichen beider Liebenden auf dem Felde liegen; sie hatten sich durch den Kopf geschossen.1 Kellers Novelle beginnt eben mit diesem Kommentar des Erzählers, worin er betont, dass seine Geschichte „auf einem wahren Vorfall beruhte, zum Beweise, wie tief im Menschenleben jede der schönen Fabeln wurzelt, auf welche ein grosses Dichterwerk gegründet ist2. Zum Schluss schildert abermals eine Zeitungsmeldung, den Tod der beiden Liebenden in Anlehung der realen Vorlage.3 1.1 Inhalt der Novelle Im Vordergrund der Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe wird der Beginn und Verlauf einer Fehde zwischen den Bauern Manz und Marti und deren Konsequenzen für ihre Kinder Sali und Vrenchen beschrieben. Die Auswirkungen dieser Streitigkeit führt schliesslich zum Selbstmord des jungen Paares. Anfangs herrscht Frieden zwischen Manz und Marti, die bis dahin seit Jahren ihre nah gelegenen Äcker bestellen. Nur ein Stück Brachland trennt sie voneinander. Der Besitzer dieses Brachlandes ist der „Schwarze Geiger, der als Landstreicher und ohne Bürgerrechte in Seldwyla lebt. Aufgrund fehlender schriftlicher Dokumente kann er das Land nicht für sich beanspruchen. Nach und nach erweitern beide Bauern im stillen Übereinstimmigkeit bei jedem Pflügen ihre Äcker um weitere 1Zitiert nach: Böhning, Thomas (Hrsg.): Anmerkungen und Stellenkommentar zu „Romeo und Julia auf dem Dorfe. In: Keller, Gottfried: Die Leute von Seldwyla. Text und Kommentar. Hrsg. von Thomas Böhning. Frankfurt/Main: Deutscher Klassiker Verlag 2006. S. 690-711. Hier: S. 690 2Keller, Gottfried: Romeo und Julia auf dem Dorfe. In: Ders.: Die Leute von Seldwyla. Text und Kommentar. Hrsg. von Thomas Böhning. Frankfurt/Main: Deutscher Klassiker Verlag 2006. S. 69-144. Hier: S. 690. Im Folgenden werden Zitate aus „Romeo und Julia im Fliesstext als „RJ gekennzeichnet. 3Der Schluss der Novelle, der den Selbstmord des Paares als Zeichen der „Verwilderung der Leidenschaften (RJ 144) kommentiert, ist von Keller mehrfach verändert worden. In der ersten Ausgabe endet die Novelle mit einer längeren Reflexion über eben jene „Entsittlichung der Gesellschaft und betont, die Tat der Liebenden solle in keiner Weise glorifiziert werden. In Absprache mit Paul Heyse wurde die Novelle im Deutschen Novellenschatz ohne diese Schlussbetrachtung veröffentlicht. Die zweite Auflage der Leute von Seldwlya enthält als eine Art Zwischenlösung den oben erwähnten abschliessenden Kommentar von der „Verwilderung der Leidenschaften. Dazu: Selbmann, Rolf: Gottfried Keller: Romane und Erzählungen. Berlin: Erich Schmidt 2001. S. 62-64. 2 kleine Teile des unbewirtschafteten Landes. Das verbleibende Stück Land verwenden sie nutzvoll für Steine und Unkraut. Das Eklat schlägt mit dem Verkauf des brachen Landes ein: Beide Bauern wollen das brachliegende Land an sich bringen, in dem sie verbissen für den Acker bieten. Schliesslich erhält Manz den Zuschlag und fordert nun von Marti, den zuvor an seinen Besitz angeschlossenen, dreieckigen Teil des Feldes zurück zu geben. Die Weigerung von Marti führt zum Beginn einer jahrelangen Fehde zwischen den Bauersfamilien. Dies betrifft auch die, bis dahin eng befreundeten Kinder Sali und Vrenchen, die von nun an getrennt sind. Die Bewohner Seldwylas stacheln die Fehde immer wieder erneut an, was unweigerlich zum sozialen Abstieg der Landwirte führt. Manz Familie verliert bald allen Landbesitz und muss in der Stadt eine heruntergekommene Gastwirtschat übernehmen, während Marti als armer Bauer sein Leben bestreitet, dessen Auskommen kaum zum Überleben ausreicht. Nach dem Tod seiner Frau lebt er mit seiner Tochter Vrenchen im Dorf. Ein zufälliges Treffen der verfeindeten Bauern endet in einer Schlägerei. Anders ist es für Sali und Vrenchen, die sich bei dieser Gelegenheit ebenfalls wiedersehen und ihre Liebe zueinander erkennen. Der Kampf wird von den beiden vorerst beendet. Die Liebenden treffen sich heimlich am Acker, der schicksalshaft die Fehde ihrer Väter ausgelöst hatte. Dabei werden sie von Vrenchens Vater Marti entdeckt. Daraufhin eskaliert die Situation dermassen, dass es auch hier zum Streit kommt und Sali mit einem Stein auf Marti einschlägt. Obwohl sich die anfängliche Befürchtung, Marti sei tot nicht bewahrheitet, hat die Verletzung doch schlimme Folgen: Marti verliert seinen Orientierungssinn und endet erinnerungslos in einer Irrenanstalt. Ohne Vater ist Vrenchen nun endgültig mittellos und muss den letzten Besitz der Familie verkaufen. Indessen sucht sie dann auch nach einer Anstellung um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Eine Verbindung des Liebespaares wird zunehmend aussichtslos, da ohne finanzielle Mittel eine gemeinsame Zukunft in kleinbürgerlichen Verhältnissen unmöglich ist. Vor ihrem endgültigen Entschluss sich zu trennen, möchten Sali und Vrenchen einen gemeinsamen, sorgenfreien Tag verbringen, als wären sie ein Paar, das gute Zukunftaussichten hat. Der Traum von der gespielten Idylle wird ihnen jäh von den Dorfbewohnern auf der Kirmes zerstört, die sie als die Kinder der verfeindeten Bauern erkennen. Ihre Flucht vor den missgünstigen Menschen endet in einem heruntergekommenen Gasthaus an einem See, wo Arme und Ausgestossene der Gesellschaft ihren Tanzabend feiern. Hier treffen sie auch den Schwarzen Geiger wieder. Dieser eröffnet dem Paar die Möglichkeit eines gemeinsamen Lebens ausserhalb der Gesellschaft: Sali und Vrenchen sollen mit ihm und dem Fahrenden Volk in den Wäldern leben. Als beide erkennen, dass sie ein solches Leben in Abgeschiedenheit nicht führen können, lehnen sie ab und verlassen die wild musizierende und tanzende Gruppe um den Geiger. Sali und Vrenchen beschliessen in ihrer Verzweiflung nach einer symbolischen Hochzeit am Fluss gemeinsam Selbstmord zu begehen. 3 1.2 Inhaltliche Aspekte und Figurenanalyse Für den Literaturunterricht trägt „Romeo und Julia auf dem Dorfe zahlreiche zentrale inhaltliche Aspekte und eignet sich gut dafür. Mittels der folgenden Figurenanalyse4 werden einige dieser Aspekte besonders herausgestellt: –die unterschiedliche Lebensweise in der Stadt und dem Land, als auch der Wandel, dem diese Konzeptionen unterworfen sind –die Konkurrenz und das Motiv des (angestrebten) Reichtums um jeden Preis –familiäre Zwänge als Hinderungsgrund der Selbstverwirklichung des Einzelnen –der Suizid als Mittel, eine unmögliche Liebesbeziehung zu realisieren (vgl. Shakespeares „Romeo und Julia und die angesprochene Veränderung des Novellenschlusses bei Keller) –soziale Ausgestossenheit aller zentralen Figuren im Kontrast zur Seldwyler Gesellschaft –das Motiv der Schuld, die sich über die Generationen hinweg fortsetzt5 1.3.1 Manz und Marti Die Beziehung zwischen Manz und Marti ist vor dem Ausbruch der Fehde auf den eigenen Vorteil bedacht, wenn es um den „schwarzen Geiger und sein brachliegendes Land geht. Sie verhalten sich gegenüber hochmütig, mitleidslos und scheinheilig. Nach Verkauf des Landes halten sie beide stur an ihrem Besitzanspruch auf einen dreieckigen Teil des Ackers fest. Die unendlichen Auseinandersetzungen um dieses Stück Land bringt sie aufgrund ihrer gegenseitigen Klagen vor Gericht um ihre Existenzgrundlage und zerstört ihre Persönlichkeit. Die Fehde artet dermassen aus, dass sie ihre Wut und ihre Gewaltbereitschaft nicht unter Kontrolle halten können, so dass sie sich auch nicht mehr um ihre Höfe kümmern können und in elende Verhältnisse verfallen.6 Die Pflügszene am Anfang (RJ 69-72) beschreibt die scheinbare ländliche Idylle exemplarisch. Verstärkt wird der Konflikt noch durch die Bewohner Seldwylas, die sich an dem Streit bereichern wollen: Da sie eine faule Sache hatten, so gerieten beide in die allerschlimmsten Hände von Tausendkünstlern, welche ihre verdorbenen Phantasie auftrieben zu ungeheuren Blasen, die mit den nichtsnutzigsten Dingen angefüllt wurden. Vorzüglich waren es die Spekulanten aus der Stadt Seldwyla, welchen dieser Handel ein gefundenes Fressen war, und bald hatte jeder einen Anhang von Unterhändlern, Zuträgern und Ratgebern hinter sich, die alles bare Geld auf hundert Wegen abzuziehen wussten. (RJ 82) So wie sie einst den „Schwarzen Geiger ausstiessen und benachteiligten, werden auch Manz und Marti nun zu Ausgestossenen. 1.3.2. Frau Manz 4Folgende ausgeführte Figurenanalysen beziehen sich auf wesentliche Aspekte, die für den vorliegenden Unterrichtsentwurf von Bedeutung sind. 5Ostermeyer, Jasmin, Unterrichtsentwurf zu Gottfried Kellers Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe, Leibniz Universität Hannover. 6 Friedl, Gerhard. Ein Unterrichtsmodell, in: Einfach Deutsch. 2002, Schöningh Verlag, Paderborn. 4 Nach dem finanziellen Ruin der Familie Manz ist Frau Manz gezwungen mit in die Stadt zu ziehen. Sie wird von Keller als eine verlogene und hinterhältige Frau vorgestellt, deren „weibliche Fehler (RJ 84) sehr ausgeprägt sind: Sie ist geschwätzig, verfressen und zu sehr um ihre Vormachtsstellung in der Nachbarschaft besorgt.Auch der Umzug in die Stadt kann ihrer Hochnäsigkeit keine Abhilfe schaffen; statt dessen lanciert sie es als einen sozialen Aufstieg und schaut von oben auf die zurückbleibenden Bauern herab: „Die Frau legte aber nichts desto minder ihren besten Staat an, als sie sich oben auf die Gerümpelfuhre setzte, und macht ein Gesicht voller Hoffnungen, als künftige Stadtfrau schon mit Verachtung auf die Dorfgenossen herabsehend []. (RJ 87). „So schwänzelte und tänzelte sie mit angestrengter Anmut herum, spitzte lächerlich das Maul, dass es süss aussehen sollte, hüpfte elastisch an die Tische hin, und das Glas oder den Teller mit gesalzenem Käse hinsetzend, sagte sie lächelnd „So so? so soli! herrlich, herrlich, ihr Herren! und solch dummes Zeug mehr [] Die Seldwyler von der schlechtesten Sorte, die da hockten, hielten sich die Hand vor den Mund, wollten vor Lachen ersticken, stiessen sich unter dem Tisch mit den Füssen und sagten: „Potz tausig! das ist ja eine Herrliche! (RJ 89) Dennoch können auch positive Merkmale bei ihr ausgemacht werden: In der grössten Not steht sie treu zu ihrem Mann; auch Sali gegenüber hegt sie mütterliche Gefühle und wünscht sich, dass er ein glücklicheres Leben führen möge (RJ 117). 1.3.3. Vrenchen Trotz des frühen Todes ihrer Mutter und dem streitsüchtigen, geizigen und tyrannischen Vater Marti kann Vrenchen ein heiteres und fröhliches Wesen bewahren. Zu Beginn der Novelle ist Martis Tochter 5 Jahre alt, bei ihrem Tod dann 17. Keller beschreibt sie, mit ihren „hübschen Augen, der „bräunliche Gesichtsfarbe und ganz krause dunkle Haare, welche ihm ein feuriges und treuherziges Ansehen gaben (vgl. Friedl, G.,S.9) als leidenschaftliches, „feuriges Dirnchen (RJ 77). Schon als Kind empfindet sie eine tiefe Zuneigung zu Sali. Auch sie ist jung und träumt von schönen Kleidern und ist niedergeschlagen, ohne schöne Schuhe zum Tanzen gehen zu müssen (RJ 114). Vielleicht ist auch das einer der Gründe warum sie die Möglichkeit, ein Aussenseiterleben beim Fahrenden Volk zu führen nicht in Betracht zieht und sich für den Tod entscheidet: „Nein, dahin möchte ich nicht gehen, denn da geht es auch nicht nach meinem Sinn zu. (RJ 138). Vielmehr träumt sie von einem Leben mit Sali innerhalb der Gesellschaft. In ihrem Gespräch mit der Nachbarin zeigt sich, wie ihr Traum aussieht: „Versteht sich, in drei Wochen halten wir Hochzeit! [] Das schönste Haus hat er schon gekauft in Seldwyl mit einem grossen Garten und Weinberg; Ihr müsst mich auch besuchen, wenn wir eingerichtet sind, ich zähle drauf! [] Ihr werdet sehen, wie schön es da ist! einen herrlichen Kaffe werde ich machen und Euch mit feinem Eierbrot aufwarten, mit Butter und Honig! (RJ 120) 5 1.3.4. Sali (Salomon) Sali, Sohn von Manz ist „ein hübscher und kräftiger junger Bursche, der sich zu „wehren wusste Auch sein Leben wird durch die Fehde und Schuld der Väter, wie das Leben Vrenchens, übererschattet. Ihm geht es zwar finanziell nicht so schlecht wie Vrenchen, da seine Eltern „um ihrer Grosstuerei zu genügen, liessen sie ihm zukommen, kleideten ihn sauber und prahlerisch und unterstützten ihn in allem, was er zu seinem Vergnügen vornahm. (RJ 85). Diesem Verhalten seiner Eltern steht er missbilligend gegenüber und verachtet die kriminellen Aktivitäten seines Vaters. Eines schätzte er noch an seinem Vater, das er als Kind noch in Erinnerung hat: „[E]r bewahrte noch das frühere Bild seines Vaters wohl in seinem Gedächtnis als eines festen, klugen und ruhigen Bauers, desselben Mannes, den er jetzt als einen grauen Narren, Händelführer und Müssiggänger vor sich sah [] (RJ 85) Durch die Auseinandersetzung macht er sich zum Mitschuldigen in der ganzen Angelegenheit. Der eher ruhige Sali wird nur in Vrenchens Gegenwart leidenschaftlich. Im Gegensatz ist er im Vergleich mit Sali eher der Passivere. Auch er muss enttäuscht feststellen, dass er sich entweder für das Mädchen oder gegen das Leben in der Bürgerlichkeit aufgeben muss und schliesst sich letztendlich Vrenchens Schlussfolgerung an: „Sali liebte gewiss eben so stark wie Vrenchen, aber die Heiratsfrage war ihm doch nicht so leidenschaftlich lebendig als ein bestimmtes Entweder-oder, als ein unmittelbares Sein oder Nichtsein, welches nur das Eine zu fühlen fähig war und mit leidenschaftlicher Entschiedenheit unmittelbar Tod oder Leben darin sah. Aber jetzt ging ihm ein Licht auf und das weibliche Gefühl des jungen Mädchens war ihm auf der Stelle zu einem wilden und heissen Verlangen und eine glühende Klarheit erhellte ihm die Sinne. [] „Es ist schon so gut wie getan, es nimmt Dich niemand mehr aus meiner Hand, als der Tod! rief Sali ausser sich. (RJ 141/142) 1.3.5. Der Schwarze Geiger Der richtige Name, des „Schwarzen Geigers bleibt unbekannt und erscheint als ein mysteriöser Ausgestossener der Gesellschaft (ein „Heimatloser, RJ 72) mit einem zerfurchten Gesicht und einer riesigen Nase (RJ 133). Keller lässt ihn an entscheidenden Punkten in der Novelle auftreten: zuerst ist er der Auslöser der Schuld, die Manz und Marti auf sich laden, als sie ihm nicht helfen, den Acker als seinen Besitz zu beanspruchen. Dann erscheint er auf dem Acker und droht Sali und Vrenchen, kurz bevor es zu der fatalen Schlägerei des Jungen mit Vrenchens Vater kommt. Schliesslich ist er bei dem Liebespaar, bevor diese sich für den Tod als Ausweg ihrer Situation entscheiden. Er bietet den Verzweifelten eine Alternative zu ihrem Leben in der Gesellschaft, indem er sie zu Mitgliedern des fahrenden Volkes machen will, das ausserhalb von bürgerlichen Werten und Moralvorstellungen lebt: 6 „Kommt mit mir und meinen guten Freunden in die Berge, da braucht ihr keinen Pfarrer, kein Geld, keine Schriften, keine Ehre, kein Bett, nichts als Euren guten Willen! (RJ 137). Er fungiert in der Novelle als der schicksalhafte negativ-zwielichtige Symbolcharakter, in der Rolle des Verführers als auch des „Todesboten. 1.4 Epoche und Gattung in „Romeo und Julia auf dem Dorfe Die Novelle an sich ist nicht an den Realismus gebunden. Der Text von Keller gehört aber zur Epoche des Realismus, mit dem wir uns deshalb näher befassen müssen. Abgeleitet von lat. res -Ding, Sache, Wirklichkeit, tritt der Realismusbegriff in der Literatur beispielsweise als Schreib- und Stilmerkmal oder als Bezeichnung für eine Literaturperiode, als poetischer oder bürgerlicher Realismus auf. Dieser Begriff des poetischen Realismus wandte Otto Ludwig erstmals 1871 auf den deutschen Realismus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts an. 7 Zwar wird der Realismus mit Wirklichkeit übersetzt, doch in der Literatur durfte das sich nicht nur darauf beschränken, sondern musste die Realität mir literarischen Mitteln verarbeiten. Erst in zweiter Linie ist es eine Epochenbezeichnung.8 Literaturschaffende verknüpften dabei eine genaue Realitätsbeschreibung mit einer subjektiven Erzählhandlung. Man spricht also von Realismus, wenn „es um die Darstellung der gegebenen Wirklichkeit geht und nicht um das Reich der Fantasie oder um formale Experimente im Sinne einer Kunst um der Kunst willen.9 Das bedeutet jedoch nicht, dass es sich dabei um eine einfache Wiederholung der Wirklichkeit im Sinne einer Reduplikation sein kann; die literarische Wirklichkeit ist vielmehr durch ein ästhetisch-künstlerisches Element wiedergegeben. Entscheidend dabei ist, welche Rolle dieses Element bei der Darstellung der Realität spielen soll. Es ist eine Frage der Gestaltung, wie sich das Verhältnis von kreativem Bilden und Abbilden äussert. Der Leser kann den Eindruck der Realität und die unmittelbare Anteilnahme durch eine harmonische Verbindung von inneren und äusseren Räumlichkeiten erhalten. Im Realismus ist weiter als Merkmal, die formale, inhaltliche und stoffliche Einfachheit mit genauen Detailbeschreibungen zu beobachten. Wenn es eine Literaturgattung gibt, die besonders in dieser Epoche gross hervorkam, dann war das die Novelle. Zahlreiche Novellenzyklen und Novellen fanden in dieser Zeit wie in noch keiner anderen ihren Ausdruck. Gottfried Keller gehört zu den Hauptvertretern des Realismus und ist auch mit seinem Werk „Die Leute von Seldwyla besonders bekannt, in dessen 1. Band auch „Romeo und Julia auf dem Dorfe beinhaltet ist. Die Zeit des Realismus (1848-1890) ist historisch durch die im März 1848 in Wien, Berlin und 7 8Texte, 9Ebda, 7 Themen und Strukturen, Berlin 2009, S. 267 S.267 anderen Staaten des deutschen Bundes statt gefundenen Märzrevolution geprägt. Neben dem damit folgenden Ereignissen kam es am 18. Januar 1871 in Versailles zur Reichsproklamation, wonach der preussische König Wilhelm I. zum deutschen Kaiser wurde und Bismarck, vormaliger preussischer Ministerpräsident zum Reichskanzler. Berühmt ist die sogenannte „Zuckerbrot- und Peitschenpolitik Bismarcks, der die Innenpolitik des Deutschen Reichs bestimmte. Mit der „Zuckerbrotpolitik ist die Schaffung der Sozialgesetze gemeint, um die sozialen Gegensätze zu bekämpfen, die sich durch Industrialisierung und Wirtschaftskrise zugespitzt hatten. Die Peitschenpolitik beschreibt vor allem den Streit mit den liberalen Parteien und den Sozialdemokraten, den Bismarck hatte. 1890 trat Bismarck zurück, womit in der deutschen Aussenpolitik unter Wilhelm II. ein Kurswechsel einsetzte, der sich auf Aufrüstung und Kolonialpolitik verlagerte. Auch Keller hat die Tendenz wie die meisten Autoren in der Zeit des Realismus, die sich in ihrer Themenwahl auffallend häufig mit ihrer Region und der historischen Ereignisse beschäftigt haben, keinen abwägigen Diskurs eingeschlagen. Aufgrund der „Einheitseuphorie, wurden die bürgerlichen Humanitäts- und Bildungsideale im materialistischen Taumel der Gründerjahre verdrängt. Erst Ende des Jahrhunderts entwickelte sich wieder ein reges, vielgestaltiges literarisches Leben, da sich nun zeigte, dass das „Bündnis von Obrigkeitsstaat und kapitalistischem Wirtschaftssystem nicht in der Lage war, die wachsenden sozialen Probleme zu lösen. (vgl. S.267). Ziel ist es nun in der Unterrichtsgestaltung von 7 Lektionen diese oben geschilderten wichtigen Elemente zu berücksichtigen und den SuS verständlich nahe zu bringen. 2 Allgemeine (mögliche) Aspekte für den Deutschunterricht Für die Behandlung von „Romeo und Julia auf dem Dorfe können folgende Aspekte wesentlich sein: –der auktoriale Erzähler, der sich stark wertend verhält, beteuert zu Beginn der Lektüre den Eindruck von Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit der Novelle beendet sie mit einem Zeitungsbericht. Die Erzählinstanz verhält sich stark wertend und kommentiert häufig sarkastisch die Zustände in Seldwyla –Gegenstand des Unterricht kann auch die Anlehnung der Novelle an das Shakespearsche Drama, sowie der Bezug auf die konkrete historische Vorlage (Zeitungsartikel) sein. –Anregung für eine Schlussdiskussion findet sich zum Schluss der Geschichte. Diese kann unterschiedliche Deutungen zulassen. Wie lässt sich der Selbstmord der Protagonisten jeweils erscheinen? 8 –Unter Betracht der Zeit, d.h. des Erzähltempos, können die unterschiedlichen Erzählweisen in der Novelle durchleuchtet werden. Während die anfängliche Beschreibung von der Idylle des Landes und dem gemeinsamen Tag des Liebespaares sehr detailliert beschrieben werden, wird mitunter einige Begebenheiten sehr stark gerafft. Insgesamt beträg die erzählte Zeit 12 Jahre. –Die Lektüre „RJ gilt als Vertreter der Novelle10, die einen Bezug zu einer realen Vorlage bietet, über eine relative Kürze verfügt, eine klare Handlung besitzt und auf ein nicht veränderbares Ende hinführt. Den Wendepunkt stellt die Prügelei zwischen Sali und Marti dar. Anhand dieser Aspekte können die Charakteristika der Novelle erarbeitet werden. –Durch die Dichte an Symbolik im Text (Acker als Symbol der Schuld, Fliege und Puppenkopf zu Beginn als Symbol des Todes, die mysteriöse Gestalt des Schwarzen Geigers etc.) kann den SuS das vorausdeutende Erzählen näher gebracht werden: der Titel (Assoziation mit der Familienfehde, der unglücklichen Liebe etc.), die scheinbare Idylle zu Beginn (wird bereits von dem grausamen Spiel der Kinder überschattet), und zahlreiche Begriffen aus dem Wortfeld „sterben und Tod. 3 Schülerbezug und Erkenntnisziele „Romeo und Julia auf dem Dorfe knüpft in vielen Punkten an die Lebenswelt der SuS an, u.a. –Liebe/Liebesbeziehung, auch unter schwierigen Bedingungen –Versuch, eigene Träume auch gegen den Willen der Eltern zu verwirklichen –Abhängigkeit vom Familienverbund –Identitätsfindung –Bedeutung von Reichtum und Status sowie dessen Vergänglichkeit Durch diese Aufzählung können zu folgenden wesentlichen Erkentnisse im Unterricht gelangt werden: 1)Durch die Beschäftigung mit Kellers „Romeo und Julia auf dem Dorfe steigen die SuS exemplarisch in die literarische Gattung der Novelle ein. 2)Die Epoche des Realismus bildet eine literaturhistorische Basis, die sowohl dem Allgemeinwissen dient, als auch das Denken der damaligen Menschen veranschaulicht. 3)Das Befassen mit einem exemplarischen Text für eine Gattungsart, verdeutlicht den SuS die Nachweisbarkeit anhand spezifischer Merkmale. 4)Die Behandlung von Texten, mit sozialkritischen Charakter und die offen für eine Meinungsbildung sind, ermöglicht den SuS eine Identifikation mit der eigenen Haltung. 10Vgl. 9 Haida, Peter: Stundenblätter. Keller, „Romeo und Julia auf dem Dorfe. Stuttgart:Klett 1986.S. 6-11. 5)Die Epoche des Realismus kann anhand des Textes einen Bezug zum heutigen Verständnis von Reichtum und Status wieder aufgreifen und damit möglicherweise Parallelen oder aber auch historische Verhältnisse aufzeigen. 6)Durch eine Untersuchung des Textes können die Charakteristika der Novelle erarbeitet werden, evtl. können ansatzweise eigene Texte von SuS geschaffen werden, die Merkmale der Gattung beinhalten. 7)Das Verfassen eines eigenen Textes, weist den SuS die Möglichkeit auf, kreativ zu sein und beschert ein Erfolgserlebnis bei Anwendung des bereits Erlernten. 8)Die Fähigkeit, einen Text zu einer Gattung und Epoche einordnen zu können, bildet die Basis für die Matura. 9)Durch das Befassen mit dieser Lektüre erhalten SuS auch gleichzeitig eine Erweiterung ihres „poetologischen Vokabulars, d.h. ihre Fachterminologie wird angereichert. 4 Didaktische Analyse und Reduktion Kellers Novelle gehört schon seit Jahren zum Literaturkanon der deutschsprachigen Schulbücher. Die SuS sollen Kenntnisse der deutschsprachigen Literatur, ihrer Gattungen, Epochen und Einbettung in den historischen Kontext erwerben. Aufgrund des realistischen Gehalts ist die Novelle für SuS leicht zugänglich. Es behandelt einige wichtige Probleme, die gerade Jugendliche in diesem Alter beschäftigt und regt zur Reflexion über allgemeine und bürgerliche Werte und Institutionen, etwa Familie, Liebe, Gesellschaft, an. Die ersten Auflehnungen gegen das Elternhaus, die Gesellschaft und die einhergehende Bewusstwerdung über die persönliche Freiheit sind nur einige wichtige Faktoren die zu nennen sind. Die Novelle kann für SuS auch sensibilisierend für das Einwirken von gesellschaftlichen Einflüssen und zur Durchsetzung der eigenen Bedürfnisse wirken und kann mit heutigen aktuellen Themen verknüpft werden, wie etwa verbotene Liebesbeziehungen aufgrund unterschiedlicher kultureller Herkunft. Gleichermassen schafft das Befassen mit diesen Problemen des Älterwerdens Vertrauen in die eigene Persönlichkeitsfindung, als auch Entwicklung. Das Werk bietet den SuS die Möglichkeit genau mit diesen Themen auseinander zu setzen und sich zu äussern. Daneben fördert sie fast unbewusst die Meinungsbildung. Neben den inhaltlichen Aspekten und Themen der menschlichen Beziehungen ist im folgenden Unterrichtsverlauf Wert auf die sprachliche, erzähltechnische und gattungsspezifische Gestaltung gelegt.11 Natürlich kann keine umfassende Behandlung der Lektüre innerhalb von 7 Lektionen stattfinden, doch sollten wesentliche Elemente eines Textes erfasst werden können. Dazu gehören 11Einfach 10 Deutsch, Unterrichtsmodell, S.13ff u.a. die Figurendarstellung und –entwicklung sowie die Analyse des Konfliktverlaufs. Man muss sich bewusst werden, dass es sich bei den 7 Lektionen um jeweils 45min Unterricht handelt und es aus eben diesen zeitlichen Gründen keine umfassenden Übungen oder Arbeitsmöglichkeiten stattfinden können, trotz der Möglichkeit und auch Notwendigkeit, das Lesen der Lektüre als Hausaufgabe aufzugeben. Hauptaugenmerk muss unbedingt auf die wesentlichen Dinge gelegt werden, die schnell zum den Erkenntniszielen führen. 5 Groblernziele Kognitive Lernziele •Die SuS können die Merkmale der Novelle ausmachen und erkennen •Die SuS können die epochenspezifische Merkmale des Realismus erkennen •Die SuS lernen die wichtigsten Fachbegriffe im Verlauf kennen •Die SuS nennen Gründe für den tragischen Ausgang der Liebe •Die SuS können das eigene Verstehen erkennen und reflektieren Affektive Lernziele •Die SuS können sich in die Problemsituation des Liebespaares einfühlen und einen Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Moralvorstellungen herstellen •Die SuS setzen sich mit ausgewählten Bildern aus Szenen auseinander •Die SuS können ihre Meinung zu den vorliegenden starren Gesellschaftsregeln äussern Pragmatische Lernziele •Die SuS lernen die Auseinandersetzung mit einem Werk unter Betrachtung von einer Epoche und Gattung kennen •Die SuS können formal und inhaltlich unter Berücksichtigung der Merkmale der Novelle des Realismus interpretieren •Die SuS kennen die Hauptakteure im Werk so gut, dass sie schriftliche Charakterisierungen vornehmen können 6 Aufteilung Datum Zeit 11 Inhalt der Lektion 15.06.12/ Zeit, Epoche und Gattung der Lektüre werden vorgestellt; 1 Lektion Definitionen gemacht. Historische Hintergründe und Gottfried 20.06.12 2 Keller; Ankündigung der Lektüre Befassen mit dem ersten Teil der Novelle. Die Lektüre kann ein Stück gemeinsam in der Klasse erfolgen. Deutlich soll werden, wie sich die anfangs friedliche und harmonische Atmosphäre verändert. Die zweite Stunde soll die Gründe und die Art und Weise des spiegelbildlichen Miteinanders der beiden Bauern aufzeigen, das sich auch in der Äusserlichkeit hervortut, aber dann in eine Fehde umschlägt. Die Auswirkungen und der Höhe- und Wendepunkt auf der Brücke, leiten zu den Kindern, und somit zu den beiden 22.06.12 1 Hauptpersonen und ihrer Liebe aus tragischem Konflikt hin. Kern des Geschehens wird veranschaulicht. Diese Stunde widmet sich der Entfaltung, der Zuspitzung und den Auswirkungen des Konfliktes. Die Verliebten fliehen in Wunschvorstellungen und Träume, die sich an ihrem letzten Lebenstag für kurze Zeit 27.06.12 2 teilweise verwirklichen. Das thematische und bildliche Zentrum der Novelle ist Inhalt dieser ersten UL. Fokussiert wird auf den Gegensatz zwischen Verwilderung und Ordnung auf unterschiedlichen Ebenen, wobei Themen wie, soziale Probleme, moralische Urteile und das Verhältnis zwischen Natur und Kultur behandelt werden. Am Beispiel von „Romeo und Julia auf dem Dorfe werden grundlegende Begriffe und Kategorien für den Umgang mit Literatur angewendet oder vertieft. Hier kommt es darauf an, dass die SuS konkrete Vorstellungen verbinden und es auf andere 29.06.12 1 Texte übertragen können. Die Endstunde versucht vom Ende der Lektüre das Geschehen noch einmal aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten; darüber hinaus soll es einen aktuellen Diskurs eröffnen, in den sich auch Jugendliche hineinversetzen können. 12 7 Literatur •EinFach Deutsch. Ein Unterrichtsmodell. Paderborn: Schöningh Verlag 2002. •Keller, Gottfried: Romeo und Julia auf dem Dorfe. In: Ders.: Die Leute von Seldwyla. Text und Kommentar. Hrsg. von Thomas Böhning. Frankfurt/Main: Deutscher Klassiker Verlag 2006. S. 69-144. •Böhning, Thomas (Hrsg.): Anmerkungen und Stellenkommentar zu „Romeo und Julia auf dem Dorfe. In: Keller, Gottfried: Die Leute von Seldwyla. Text und Kommentar. Hrsg. von Thomas Böhning. Frankfurt/Main: Deutscher Klassiker Verlag 2006. S. 690-711. •Haida, Peter: Stundenblätter. Keller, „Romeo und Julia auf dem Dorfe. Stuttgart: Klett 1986. •Ostermeyer, Jasmin. Unterrichtsentwurf zu Gottfried Kellers „Rome und Julia auf dem Dorfe. •Paefgen, Elisabeth Katharina: Einführung in die Literaturdidaktik. 2. Aufl. Stuttgart: Metzler 2006. •Schurf, Bernd u.a. (Hg.): Texte, Themen und Strukturen. Deutschbuch für die Oberstufe, Berlin: Cornelsen 2009. •Selbmann, Rolf: Gottfried Keller: Romane und Erzählungen. Berlin: Erich Schmidt. Internet 13