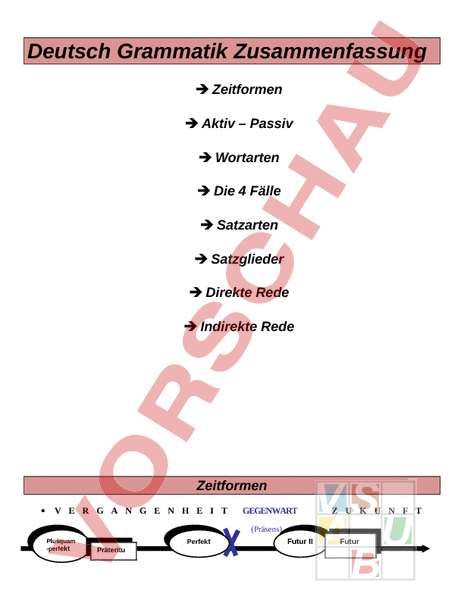Arbeitsblatt: Deutsch Grammatik Dossier
Material-Details
Zusammenfassung der wichtigsten grammatikalischen Themen
Deutsch
Grammatik
9. Schuljahr
10 Seiten
Statistik
120834
1253
54
09.09.2013
Autor/in
Hofstetter Claudia
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Deutsch Grammatik Zusammenfassung Zeitformen Aktiv – Passiv Wortarten Die 4 Fälle Satzarten Satzglieder Direkte Rede Indirekte Rede Zeitformen • E G N E H I • Plusquam Plusquam •-perf ekt -perfekt Perfekt Perfekt Präteritu GEGENWART (Präsens) Futur II Futur II U U F Futur • VORHER JETZT SPÄTER DAS PRÄSENS (GEGENWART) drückt Geschehen oder Zustände aus, • die sich jetzt gerade abspielen: Er fährt gerade draussen vorbei. • die sich ständig wiederholen: Jeden Morgen um sieben Uhr klingelt der Wecker. • die allgemein gültig sind: Morgenstund hat Gold im Mund. • die unmittelbar bevorstehen: Der Film beginnt gleich. • die zwar in der Vergangenheit begonnen haben, aber in die Gegenwart hineinreichen: Seit drei Jahren nehme ich Reitunterricht. • die zwar vergangen sind, aber durch das Präsens dramatisiert werden sollen (Historisches Präsens): Als ich in die Kurve vor dem Schulhaus fuhr, taucht plötzlich von links ein Camion auf. Ich versuche zu bremsen, doch es ist zu spät. DAS PRÄSENS KANN AUCH VERGANGENES ODER ZUKÜNFTIGES AUSDRÜCKEN. DAS PRÄTERITUM/IMPERFEKT (1. VERGANGENHEIT) drückt Geschehen oder Zustände aus, • die in der Vergangenheit abgeschlossen wurden: Gestern nun stürzte die Brücke ein. • die in schriftlichen Berichten, Aufsätzen oder Erzählungen dargestellt werden: Lieber Max, Wir befinden uns seit zwei Tagen in Pisa. Gestern besuchten wir den Schiefen Turm. Dann kehrten wir in eine Trattoria ein und genehmigten uns eine feine Pizza. DAS SCHWEIZERDEUTSCHE KENNT DAS PRÄTERITUM (IMPERFEKT) NICHT! DAS PERFEKT (2. VERGANGENHEIT, VORGEGENWART) drückt Geschehen oder Zustände aus, • die in der Vergangenheit stattgefunden haben und bis in die Gegenwart wirken: Weil es in der Nacht geschneit hat, lasse ich heute mein Velo zu Hause. • die mündlich berichtet werden: Was ich gestern gemacht habe? Zuerst einmal habe ich ausgeschlafen, dann bin ich. • über die eine Zeitung in ihren Schlagzeilen berichtet: Köbi Brösmeli hat gestanden. Bundesrat Bleicher ist zurückgetreten. WENN DU EINEN AUFSATZ IN DER GEGENWART (PRÄSENS) SCHREIBST, BRAUCHE BEI VORZEITIGKEITEN DAS PERFEKT! DAS PLUSQUAMPERFEKT (3. VERGANGENHEIT, VORVERGANGENHEIT) drückt Geschehen oder Zustände aus, • die zu einem Zeitpunkt der Vergangenheit stattgefunden haben, der noch weiter von der Gegenwart entfernt ist, als es das Perfekt auszudrücken vermag: Ich bin wirklich verärgert, dass ich eine Mahnung bekommen habe. Ich hatte dieses Buch doch schon längst zurückgegeben. • die als Vergangenheit zum Präteritum stehen: Gestern endlich beendete ich meine Zeichnung, die ich schon vor Wochen angefangen hatte. WENN DU EINEN AUFSATZ IN DER VERGANGENHEIT (PRÄTERITUM) SCHREIBST, BRAUCHE BEI VORZEITIGKEITEN DAS PLUSQUAMPERFEKT! DAS FUTUR (ZUKUNFT) drückt Geschehen oder Zustände aus, • die für die Zukunft erwartet werden: Morgen wird es einen heissen Tag geben. • die verrnutet werden: Du wirst es sicher schaffen. • die angekündigt oder angedroht werden: Das nächste Mal werde ich dich nicht mehr so sanft anfassen. UM ÜBER ZUKÜNFTIGES ZU SCHREIBEN, VERWENDET MAN VOR ALLEM IN DER UMGANGSSPRACHE LIEBER DAS PRÄSENS: MORGEN GIBT ES EINEN HEISSEN TAG. DAS FUTUR II (FUTURUM EXACTUM, VOLLENDETE ZUKUNFT) drückt Geschehen oder Zustände aus, • die bereits der Vergangenheit angehören und über die Vermutungen angestellt werden: Ihr werdet schon nicht so dumm gewesen sein. • die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft schon abgeschlossen sein werden: Bis morgen werden wir uns entschlossen haben. DAS FUTUR II IST EINE RECHT SELTENE FORM. Aktiv – Passiv AKTIV TIV Das Subjekt (Tina) tut etwas. Tina füttert dieKatze. Aus dem Objekt wird das Subjekt. Die Katze wird gefüttert. PASSI PASSIV Mit dem Subjekt (Katze) passiert etwas. PRÄSENS Aktiv: Passiv: Sie füttert die Katze. Die Katze wird gefüttert. PRÄTERITUM Aktiv: Passiv: Sie fütterte die Katze. Die Katze wurde gefüttert. PERFEKT Aktiv: Passiv: Sie hat die Katze gefüttert. Die Katze ist gefüttert worden. PLUSQUAMPERFEKT Aktiv: Passiv: Sie hatte die Katze gefüttert. Die Katze war gefüttert worden. FUTUR Aktiv: Passiv: Sie wird die Katze füttern. Die Katze wird gefüttert werden. FUTUR II Aktiv: Passiv: Sie wird die Katze gefüttert haben. Die Katze wird gefüttert worden sein. Die Wortarten Adjektiv Nomen Artikel Pronomen Verb Erklärung Beschreibt Lebewesen und Dinge genauer, kann man mit „wie? oder „Was für ein? erfragen. Kann gesteigert werden. Benennt Lebewesen (Katze, Hund, ), Pflanzen (Nelke, Rose), Dinge (Tisch, Fenster), Gedachtes (Freude, Angst) und Personen (Kind, Freundin und kommt meist mit einem Artikel (der, ein) Schreibt man immer groß; kann „dekliniert (in die vier Fälle gesetzt werden) Steht meist vor einem Hauptwort, kann bestimmt (der, die, das) oder unbestimmt (einer, eine) sein. Beispiel groß, lieb, schön, schnell, hoch, langsam, freundlich, etc. Steigerung: z.B. schnell, schneller, am schnellsten Steht als Begleiter vor einem Hauptwort oder als Stellvertreter für ein Hauptwort. Verschiedene Arten von Pronomen: Personalpronomen, Possessivpronomen, Reflexivpronomen Personalpronomen (Persönliche Fürwörter): ich, du, er/sie/es; wir, ihr, sie; Possessivpronomen (Besitzanzeigende Fürwörter): mein, meine, meines Reflexivpronomen (Rückbezügliche Fürwörter, beziehen sich auf das Subjekt zurück): ich wasche MICH, du wäscht DICH, wir waschen UNS, etc. Demonstrativpronomen (Hinweisendes Fürwort): dieser, diese, dieses; jener, jene, jenes Beschreiben das, was man tut. Infinitiv (Grundform) Aktiv/Passiv Konjugation Indikativ/Konjunktiv Zeiten Verbindet Satzglieder miteinander. das Haus, der Garten, die Freunde, die Schule, die Angst Nominativ: der Hund (wer?) Genetiv: des Hundes (wessen?) Dativ: dem Hund (wem? wo?) Akkusativ: den Hund (wen? wohin?) Bestimmter Artikel: der Mann, die Frau, das Kind Unbestimmter Artikel: ein Mann, eine Frau, ein Kind z.B. füttern Ich füttere die Katze./Die Katze wird gefüttert. ich füttere, du fütterst, er/sie/es füttert; Ich füttere die Katze./Es könnte nicht schanden, wenn jemand die Katze fütterte. Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur, Futur II und, aber, sondern, oder, weil, dass, nachdem, ob Konjunktion Präposition Adverb Steht immer vor einem Nomen oder Pronomen; kein eigenes Satzglied Kann nicht gesteigert werden, eigenes Satzglied, macht nähere Angaben: zum Ort (Lokaladverb) zur Zeit (Temporaladverb) zur Art und Weise (Modaladverb) zur Begründung (Kausaladverb) vor, zu, während, nach, auf Lokaladverbien: hier, da, oben, unten Temporaladverbien: damals, morgens, oft, vorher, heute Modaladverbien: sehr, gern, so, vielleicht Kausaladverbien: deshalb, trotzdem, dennoch Die 4 Fälle des Nomens (Substantives) Das Nomen steht in der deutschen Sprache immer in einem der folgenden vier Fälle: Nominativ (Wer-Fall) SUBJEKT Fragewort: Wer oder Was Beispiel: Das Fell ist braun Wer ist braun Das Fell Genitiv (Wes-Fall) Fragewort: Wessen Beispiel: Das Fell des Hundes ist braun Wessen Fell ist braun Das Fell des Hundes Dativ (Wem-Fall) Fragewort: Wem Beispiel: Der Hund gehört dem Mann. Wem gehört der Hund dem Mann Akkusativ (Wen-Fall) Fragewort: Wen oder Was? Beispiel: Peter sieht das Fahrrad. Wen oder was sieht Peter das Fahrrad Satzarten SATZLEHRE (SYNTAX) Einfacher Satz Satzreihe (mind. zwei Teilsätze) Satzverbindung Satzgefüge Jeder einfache Satz ist ein Hauptsatz Sie besteht aus zwei oder mehreren Hauptsätzen. Es besteht aus einem Hauptsatz und einer beliebigen Anzahl von Nebensätzen. ( H .) ( N .) Das konjugierte Verb steht im Aussagesatz an zweiter Stelle. Der einfache Satz kann auch bloß ein Satzfragment sein. Die Verbindung geschieht meist mit einem Komma. Oft steht noch eine nebenordnende Konjunktion (und, oder, denn, deshalb.) Die Verbindung geschieht mit einem Komma. Meist beginnt der Nebensatz mit einem Einleitewort (der, welche, ob, dass, als.) Im Nebensatz steht das Verb am Schluss- Die Nebensatzarten 1. Der Relativsatz Hier sehen wir Tim, der auf Löwenjagd geht. (der ist hier ein Relativpronomen) 2. Der Interrogativsatz Der Löwe fragt sich, was Tim von ihm will. (was ist hier ein Interrogativpronomen) 3. Der Konjunktionalsatz Löwen sind gefährlich, wenn man sie angreift. (wenn ist eine Konjunktion) Es gibt noch drei weitere Formen. Es sind Nebensätze ohne Einleitewort: 4. Der unechte Hauptsatz Ich glaube, Struppi unterschätzt den Löwen. Lässt sich leicht in einen „dass-Satz oder in einen „wenn-Satz verwandeln. 5. Der Partizipialsatz Vor Schmerzen laut jaulend, will der Löwe fliehen.* In diesem Nebensatz kommt das Verb nicht in einer konjugierten Form, sondern im Partizip Präsens oder im Partizip Perfekt vor. 6. Der Infinitivsatz Ohne lange zu zögern, stürzt sich Struppi auf den Löwen.* In diesem Nebensatz kommt das Verb nicht in einer konjugierten Form vor, sondern steht im Infinitiv (Grundform) Die Satzglieder Die Blöcke, aus denen sich ein Satz zusammensetzt, nennt man Satzglieder. Man kann sie innerhalb des Satzes umstellen. Durch die Umstellprobe kann man herausbekommen, welche Wörter im Satz ein Satzglied bilden. Ein Satzglied ist ein einzelnes Wort oder eine Wortgruppe, die sich verschieben lässt, ohne dass der Satz sinnlos wird und ohne dass er seinen Inhalt wesentlich verändert. Letzten Samstag spielten wir bis Mitternacht Schach. Diesen Satz kann man umstellen um die Satzglieder zu bestimmen: Wir spielten/ letzten Samstag /bis Mitternacht Schach. Bis Mitternacht spielten/ wir letzen Samstag Schach. Schach spielten wir letzen Samstag bis Mitternacht. Jeder einfache Satz besteht mindestens aus einem Subjekt und einem Prädikat. Der Satz kann noch weitere Satzglieder haben: Objekt und Adverbiale. In den Satzgliedern (ausser im Prädikat) können noch Attribute enthalten sein. Das Prädikat Das Prädikat (Präd.) wird dargestellt durch ein Verb. In fast allen Fällen ist es das einzige Verb des Satzes. Das Verb kann einteilig, zweiteilig oder mehrteilig sein. Im Satz stehen die Verbteile so, dass das Prädikat entweder einteilig oder zweiteilig ist. Beispiel: Dirk liest ein Buch. Dirk hat ein Buch lesen wollen. Das Subjekt Als Subjekt (Subj.) können ein Substantiv, ein Pronomen oder ein unbestimmtes Zahlwort auftreten. Man fragt nach dem Subjekt mit wer oder was. Beispiel: Dirk liest ein Buch. Wer oder was liest ein Buch? Das Akkusativ-Objekt Das Akkusativ-Objekt (Akk.-Obj.) kann durch ein Substantiv, ein Pronomen oder ein unbestimmtes Zahlwort dargestellt werden. Nach dem Akkusativ-Objekt fragt man mit wen oder was. Beispiel: Dirk liest ein Buch. Wen oder was liest Dirk? Das Dativ-Objekt Das Dativ-Objekt (Dat.-Obj.) kann durch ein Substantiv, ein Pronomen oder ein unbestimmtes Zahlwort dargestellt werden. Man fragt nach dem Dativ-Objekt mit wem. Beispiel: Dirk liest seinem kleinen Bruder ein Buch vor. Wem liest Dirk ein Buch vor? SATZGLIED(Baustein) Bemerkung Wir finden das Satzglied mit der Frage: 1. Subjekt 2. Prädikat 3. Objekt 4. Adverbiale steht immer im Nominativ alle Teile, die zum Verb gehören Ergänzung zum Prädikat gibt die Umstände an, unter denen etwas geschieht gehört immer zu einem Nomen (Hier funktioniert die Verschiebeprobe nicht) Wer oder was tut (oder erleidet) etwas? Was tut (oder erleidet) das Subjekt? wessen? wem? wen oder was? wann? wo? wie? warum? 5. Attribut Was für ein.? Satzanalyse: Im Aquarium habe ich gestern einen kleinen Tintenfisch gesehen. 1. Verschiebeprobe (mdl.) machen. „Einen kleinen Tintenfisch habe. Ich habe. Gestern habe. 2. Satzglieder bestimmen: Im Aquarium wo? Adverbiale habe konj. Verb Prädikat ich wer? Subjekt gestern wann? Adverbiale ei. kl. Tintenfisch wen oder was? gesehen. (Teil des Prädikats) Objekt Direkte Rede Begleitsatz vor der wörtlichen Rede Fabian sagte: „Ich gehe jetzt nach Hause. Burak brüllte: „Ich bin stocksauer! Carlo fragte: „Kann ich dir noch etwas mitbringen, Michelle? Steht der Begleitsatz vorne, wird er mit Doppelpunkt von der wörtlichen Rede abgetrennt. Begleitsatz nach der wörtlichen Rede „Ich gehe Brötchen holen, flötete Gülistan. „Bringst du mir auch ein Croissant mit?, fragte Luan. „Du denkst wohl, ich mach alles für dich!, erwiderte Gülistan. Begleitsatz zwischen der wörtlichen Rede „Mir ist langweilig, Frau Meier, gähnte Nicole, „ich will nach Hause. „Jetzt stell dich mal nicht so an, Nicole!, schimpfte Frau Meier, „du kannst dich ruhig mal ein bisschen anstrengen. „Soll das ein Witz sein?, fragte Nicole, „ich bin todmüde! Indirekte Rede Um einen Satz in indirekter Rede zu schreiben, braucht man den Konjunktiv des Verbs. Die Satzzeichen der direkten Rede fallen weg. Ina sagte: „Ich habe dir die CD wieder gegeben. Ina sagte, sie habe mir die CD wieder gegeben. Steffi meint: „Heute ist es zu heiß für Unterricht. Steffi meint, dass es heute zu heiß für Unterricht sei. Peter entgegnet: „Ich erlebte schon viel heißere Tage. Peter entgegnet, dass er schon viel heißere Tage erlebt habe. Nina erzählt: „Meine Eltern laufen jeden Tag 3 km im Wald. Nina erzählt, dass ihre Eltern jeden Tag 3 km im Wald liefen. Der Lehrer verspricht: „Morgen wird es keine Hausaufgaben geben. Der Lehrer verspricht, dass es morgen keine Hausaufgaben geben werde. Der Lehrer schimpft: „Sie lernten viel zu wenig für die GS Probe. Der Lehrer schimpft, dass sie zu wenig für die GS Probe gelernt hätten. Michael erzählt: „Wir spielen in Sportunterricht immer Fußball. Michael erzählt, dass sie im Sportunterricht immer Fußball spielten.