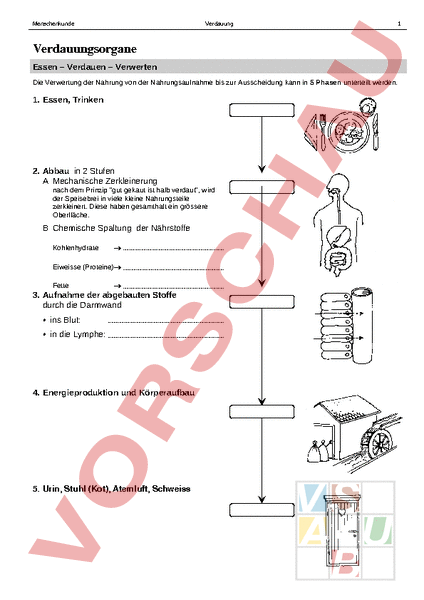Arbeitsblatt: Verdauungsorgane
Material-Details
Mappe
Chemie
Gemischte Themen
8. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
122371
681
4
02.12.2013
Autor/in
Ludwig89 (Spitzname)
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Menschenkunde Verdauung Verdauungsorgane Essen – Verdauen – Verwerten Die Verwertung der Nahrung von der Nahrungsaufnahme bis zur Ausscheidung kann in 5 Phasen unterteilt werden. 1. Essen, Trinken 2. Abbau in 2 Stufen Mechanische Zerkleinerung nach dem Prinzip gut gekaut ist halb verdaut, wird der Speisebrei in viele kleine Nahrungsteile zerkleinert. Diese haben gesamthaft ein grössere Oberfläche. Chemische Spaltung der Nährstoffe Eiweisse (Proteine) Kohlenhydrate Fette 3. Aufnahme der abgebauten Stoffe durch die Darmwand • ins Blut: . • in die Lymphe: . 4. Energieproduktion und Körperaufbau 5. Urin, Stuhl (Kot), Atemluft, Schweiss 1 Menschenkunde Verdauung 2 Verdauungsorgane Der Verdauungsapparat umfasst alle Organe, die am Verdauungsvorgang beteiligt sind. Dazu gehören auch Drüsen die Verdauungssäfte liefern. Schreibe alle Organe mit Hilfe des Buches (S. 57) an und male die Organe sorgfältig an. Betrachte die Organe auch am Torso und versuche sie aus- und einzubauen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Mund Länge Aufenthaltsdauer der Nahrung bis 1 min Speiseröhre Magen Dünndarm Dickdarm Mastdarm Total 22 – 25 cm 20 cm 5–6m 1.5 15 – 20 cm 6.7 – 7 4 – 10 1–9h 7–9h 20 – 30 30 – 120 63 – 68 Menschenkunde Verdauung 3 Mundhöhle (Buch S. 50 und 123) Die Mundhöhle wird durch den harten und weichen Gaumen, die Wangen und den Unter- und Oberkiefer gebildet. Darin wird die Nahrung geprüft, zerkleinert, eingespeichelt und teilweise schon chemisch zerlegt. In der Schleimhaut der Zungenoberseite befinden sich mehrere Arten von Papillen und Sinneskörperchen, die verschiedene Geschmacksreize wahrnehmen können. Schreibe die Mundteile an (Vorderer und hinterer Gaumenbogen, harter Gaumen, weicher Gaumen, Halszäpfchen, Gaumenmandel, Zunge, Rachenhöhle). Schreibe die Regionen für die verschiedenen Geschmacksrichtungen an und färbe sie mit einer passenden Farbe. Die Zähne – für die mechanische Zerkleinerung (Buch S. 50 – 53) Mit Hilfe der Zähne zerkleinern und zermahlen wir die Nahrung. Je feiner der mechanisch zerlegte Speisebrei ist (grössere Gesamtoberfläche), desto besser kann er mit Verdauungssäften vermischt und dann geschluckt werden: „Gut gekaut ist halb verdaut. 1. Erkläre möglicht anschaulich, warum kleiner Teile eines bestimmten Volumens eine grössere Gesamtoberfläche ergibt. 2. Male die Zahnarten in verschiedenen Farben an. Schneidezähne: rot Eckzähne: grün (Vordere) Backenzähne: blau Mahlzähne (hintere Backenzähne): gelb Weisheitszähne: schwarz 3. Trage die Zahl für das Milchgebiss (innerer Zahnkreis) und das vollständige Dauergebiss (äusserer Zahnkreis) mit Farbe in die richtigen Felder. Milchgebiss rechts Bz Ez links Sz Sz Ez Bz Oberkiefer Unterkiefer Dauergebiss Total rechts Wz Mz Bz links Ez Sz Sz Ez Bz Mz Wz Oberkiefer Unterkiefer Total 4. Die Abbildungen zeigen die Längsschnitte durch einen Schneide- und einen Backenzahn. Beschrifte die Zähne mit Hilfe des Menschenkunde Verdauung 4 Buches S. 53 und male sie entsprechend aus. Auch Zähne werden krank – Karies Dank modernster Zahnpflegemittel, Aufklärung und regelmässige Zahnkontrolle (Schulzahnarzt) konnte die Zahngesundheit in der Schweiz einen bemerkenswert hohen Standard erreichen. Vor allem die Zähne von Jungendliche sind in einem sehr guten Zustand. Besonders in Klosters haben nur wenige Schülerinnen und Schüler Karies. Entstehung von Karies In der Mundhöhle leben unzählige Bakterien, die sich vorwiegend von Kohlenhydraten ernähren. Ein Teil dieser Bakterien bildet einen Belag (Plaque) auf den Zahnoberflächen. Diese Bakterien wandeln den Zucker in Säure um, welche in die schützende Schmelzschicht eindringt und den Zahn entkalkt. So verliert die Schmelzschicht ihre Festigkeit immer mehr, bis sie einbricht: Ein Loch im Zahn (Karies) entsteht. Wie können wir uns schützen? 1. Ernährung: . 2. Zahnreinigung: 3. Fluoride: 4. Regelmässige Kontrolle Schlucken – vom Mund in den Magen (Buch S. 52 – 55) Nach dem Kauen wird der Nahrungsbissen heruntergeschluckt. Dazu wird die Nahrung von der Zunge an den weichen Gaumen gedrückt. Dies löst den Schluckreflex aus. Dieser ist angeboren und läuft ab, ohne dass wir ihn willentlich beeinflussen können. Die Muskulatur der Rachenwand zieht sich reflexartig zusammen und das Zäpfchen schliesst die Rachenhöhle gegen die Nasenhöhle ab. Der Kehlkopf hebt sich in der Luftröhre. Wenn Du einmal leer schluckst und dabei die Hand vorne an den Hals legst, spürst Du die Bewegung des Kehlkopfes. Der Kehlkopf wird Menschenkunde Verdauung 5 nun vom Kehldeckel verschlossen. So wird vermieden, dass Speiseteile in die Luftröhre eindringen. Redet man allerdings während des Schluckens, kann Speise in den falschen Hals geraten. Durch krampfhaftes Husten wird sie dann aus der Luftröhre und aus dem Kehlkopf hinausbefördert. Normalerweise gleitet aber die Speiseportion in die Speiseröhre, die hinter der Luftröhre liegt. Zeichne in die Darstellung Halszäpfchen und Kehldeckel richtig ein. Stelle mit Pfeilen auch den Weg der Atemluft und der Nahrung dar. Schreibe die Teile auch an. Hilfe findest du im Buch S. 55. Atemstellung Schluckstellung Durch die Speiseröhre Die Nahrung gleitet nicht einfach passiv mittels der Schwerkraft in den Magen. Dies belegt die Tatsache, dass wir selbst im Kopfstand essen und trinken können. Wenn man einmal einen etwas zu grossen Brocken heruntergeschluckt hat, ist die Tätigkeit der Speiseröhre deutlich zu spüren: Sie schiebt den Brocken langsam magenwärts. Für den Transport sind Muskeln verantwortlich, deren Bewegungen wellenförmig vom Rachen zum Magen verlaufen. Dabei wird der Brocken in wenigen Sekunden in den Magen gepresst. Dies ist ein aktiver Transportvorgang. Die wellenartigen Bewegungen der muskulösen Wände des Verdauungsapparates werden Peristaltik genannt. Schreibe die Figuren an und male sie aus: Bau und Funktion des Magens (Buch S. 54 – 56) Schreib die Teile des Magens (Längsschnitt durch einen leeren Magen) an ergänze den untenstehenden Text. Menschenkunde Verdauung 6 1 . 2 . 3 . 4 . . 5 . . 6 . 7 . Der Magen ist ein etwa 20 cm langer Schlauch, der im leeren Zustand kaum vom übrigen Verdauungskanal zu unterscheiden ist. Sein Fassungsvermögen beträgt etwa Die Schleimhaut enthält Mio. Drüsen, die pro Tag ausscheiden. Dieser enthält neben viel Schleim . Liter. Liter Magensaft und das Enzym Der Schleim verflüssigt die Nahrung und schützt die Magenwand vor Zerstörung durch die Die Salzsäure tötet . ab, und das Pepsin leitet die chemische Zerlegung der ein. Die Muskulatur führt langsame peristaltische Bewegungen aus, die den Nahrungsbrei kneten und mit Magensaft durchmischen. Je nach Zusammensetzung bleibt der Nahrungsbrei eine bis mehrere Stunden lang im Magen und entleert sich dann portionenweise durch den . in den . Verweildauer aufgenommene Nahrung im Magen 1 – 2 Stunden 2 – 3 Stunden 3 – 4 Stunden 4 – 5 Stunden 5 – 7 Stunden 8 – 9 Stunden Die Leber – zentrales Stoffwechselorgan (Buch S. 58 – 59) Die Leber ist die grösste Drüse des menschlichen Körpers. Sie wiegt beim Erwachsenen etwa 1.5 kg. Die Leber hat wie jedes Organ eine zuführende Arterie, die Leberarterie, und eine abführende Vene, die Lebervene. Zusätzlich Menschenkunde Verdauung 7 mündet noch eine weitere starke Vene, die Pfortader, in die Leber. Sie transportiert die aus dem Darm aufgenommenen Eiweisse und Kohlenhydrate. Die in der Leber produzierte Galle wird durch den Gallengang in die Gallenblase und aus dieser in den Zwölffingerdarm geleitet. Schreibe die schematische Übersicht der Leber an und male sie aus (Arterien: rot, Venen: blau, Pfortader: violett, Gallenblase und Gallengang: grün). Die Leber spielt im Stoffwechselgeschehen unseres Körpers eine äusserst wichtige Rolle. Sie erfüllt eine Vielzahl von lebenswichtigen Aufgaben, von denen im Folgenden nur die wichtigsten genannt werden. (Buch S. 58). Gallenproduktion: Entgiftung: Funktion für das Blut: Weitere Stoffwechselfunktionen: . Gefährdung der Leber Menschenkunde Verdauung Die Leberzellen sind ein kleines Wunderwerk: Sie sind in der Lage, sich zu regenerieren. Selbst wenn zwei Drittel zerstört sind, kann sich die Leber wieder erholen. Doch alles verzeiht sie nicht: Alkohol- und Medikamenten-Missbrauch, aber auch eine dauerhaft falsche, zu fette Ernährung sind die Feinde der Leber. Auch Schwermetalle in der Nahrung, Rückstände aus Schädlingsbekämpfungsmitteln, organische Lösungsmittel und das Rauchen schaden ihr. 1 Gesunde Leber 2 Chronisch entzündete Leber 3 Leber von Krebs befallen 4 Leber mit Zirrhose 8 1 2 3 4 Ursachen 30 bis 50 Prozent aller Lebererkrankungen sind in der westlichen Welt durch Alkohol verursacht. Die alkoholbedingte Zirrhose ist hier die häufigste der Leberzirrhoseformen. Alkoholbedingte Hepatitis und die Verfettung der Leber sind als Vorstadien der Leberzirrhose anzusehen und noch verbreiteter. Männer sind mehr als doppelt so häufig betroffen wie Frauen. Alkohol Alkohol ist die Droge mit der stärksten Verbreitung. Wahrscheinlich handelt es sich auch um die älteste Droge der Welt, denn Alkohol ist schon mehrere tausend Jahre vor Christi Geburt entdeckt worden. Alkohol schädigt nicht nur die Leber, er hat noch weitere Wirkungen. Notiere Wirkungen und Folgen von Alkoholkonsum. Benütze dabei das Buch (S. 172-174) und die Unterlagen. . Die Bauchspeicheldrüse produziert wichtige Enzyme für die Verdauung (Buch S. 60 – 61) Die Drüse, welche die grösste Vielfalt an Verdauungsenzymen produziert ist die Bauchspeicheldrüse. Sie ist ungefähr 15 cm lang und liefert täglich etwa 1 Bauchspeichel. Dieser Verdauungssaft wird in den Zwölffingerdarm abgegeben. Er enthält für jeden Nährstoff (Kohlenhydrat, Eiweiss, Fett) mindestens ein Enzym. Menschenkunde Verdauung 9 Wirkungsweise eines Enzyms Für die Verdauung sind Wirkstoffe, die in der Fachsprache als Enzyme bezeichnet werden, verantwortlich. Enzyme kommen in unserem gesamten Körper vor. Sie regulieren und beschleunigen chemische Prozesse, ohne dabei selbst verändert zu werden. Bei der Verdauung zerschneiden Enzyme Kettenmoleküle in ihre Einzelteile. 1 . 2 . . 3 . . 4 . . 5 . Beispiele (Buch S. 63) Enzym Drüse/ Ort Wirkung Amylase, Ptyalin Speicheldrüsen im Mund Zerlegung von Stärke zu Pepsin Magen Erste Verdauung der Gallensaft Leber/ Gallenblase Emulgierung (Fett in kleine Fetttröpfchen) der Amylase Bauchspeicheldrüse Zerlegung der Stärke in Trypsin Bauchspeicheldrüse Zerlegung Eiweisse in Lipase Bauchspeicheldrüse Zerlegung Fette in Dünndarmsaft Dünndarm Weitere chemische Verdauung aller Nährstoffe Der Dünndarm – wichtigster Abschnitt der Verdauung (Buch S. 60 u. 62) Der erste kurze Abschnitt des Dünndarms ist so lang wie 12 Finger breit sind. Er heisst darum Zwölffingerdarm und ist der wichtigste Ort der chemischen Verdauung. Die Leber und die Bauchspeicheldrüse liefern ihre Verdauungssäfte in den Zwölffingerdarm. Der ganze Dünndarm enthält aber auch Drüsen, die Darmsaft für die weitere Verdauung produzieren. Der Darm ist nicht etwa ein gewöhnlicher Schlauch. Seine Schleimhaut besteht aus vielen querliegenden, rundherum verlaufenden Falten. Auf der Oberfläche dieser Querfalten erheben sich fingerförmige Ausstülpungen, die Menschenkunde Verdauung 10 Darmzotten (20 30 pro mm2). Die Zottenoberfläche besteht wiederum aus einem ganz feinen Teppich von Mikrozotten. Durch die Querfalten, Darmzotten und Mikrozottenoberfläche wir die Innenfläche des Darmes fast 7000mal vergrössert. Dies ergibt eine Fläche von etwa 2000 m2. Dieser Bau des Dünndarms ermöglicht das Erfüllen der zwei Hauptaufgaben: • • Falten und Zotten der Dünndarmschleimhaut Aufnahme der Nährstoffe durch die Darmzotten in die Blutgefässe (Resorption) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . Der Dickdarm (Buch S. 61 – 64) Der Dickdarm besitzt einen Durchmesser von ca. 7 cm und ist damit deutlich dicker als der Dünndarm. Er besteht aus dem Blinddarm mit Wurmfortsatz, einem aufsteigenden, einem querliegenden und einem absteigenden Abschnitt. Sie sind zusammen etwa 1 lang. Möglicherweise ist Dir eine Blinddarmentzündung aus eigener, schmerzhafter Erfahrung bekannt. Dass bei dieser Entzündung jedoch nicht der Blinddarm, sondern der Wurmfortsatz betroffen ist, wissen nur wenige. Bei einer entsprechenden Operation wird dieses durchschnittlich 10 cm lange Stück entfernt. Menschenkunde Verdauung 11 Die Schleimhaut bildet im Dickdarmbereich zwar noch immer Falten, aber keine Zotten mehr. Sie sondert grosse Mengen Schleim ab, der den Darm gleitfähig hält. Da die verdauten Nährstoffe bereits im Dünndarm resorbiert wurden, muss der Dickdarm vor allem noch Wasser und Salze resorbieren. Die Hauptaufgabe des Dickdarms ist also: Der Dickdarm ist von vielen Darmbakterien besiedelt. Sie sind in der Lage einen Teil der unverdaulichen Nahrungsreste (Zellulose) in Traubenzucker zu zerlegen und vergären restliche Kohlenhydrate. Übrig gebliebene Proteine werden durch Fäulnisprozesse abgebaut. Durch die Aktivität der Bakterien entstehen Gase, die Du unschwer beim Entströmen aus dem Körper mit der Nase und öfters auch mit den Ohren feststellen kannst. Die Bakterien produzieren auch Vitamin und leisten damit einen Beitrag zu unserer Gesunderhaltung. Mastdarm Im Mastdarm wird der Kot gesammelt und periodisch ausgeschieden. Er besteht aus 65 bis 85% Wasser. Der Rest setzt sich vorwiegend aus Bakterien und abgetragenen Darmzellen zusammen. Bei Durchfall ist der Wasseranteil wesentlich höher und meist sind noch viele Nährstoffe im dünnflüssigen Kot enthalten. Dies zeigt deutlich, dass die Resorption nur mangelhaft stattgefunden hatte. Vergleich von Darmlängen mit der Körpergrösse Darmlänge (Dünn- und Dickdarm) Vergleich zur Körpergrösse Darmlänge (Dünn- und Dickdarm) Vergleich zur Körpergrösse Mensch 6.5 mal länger Pferd 39 mal länger Katze 2.5 mal länger Schwein 15 mal länger Hund 8.4 mal länger Rind 60 mal länger Schaf 42 mal länger Menschen und Fleischfresser haben einen . Verdauungskanal. Pflanzenfresser haben einen . Verdauungskanal. Pflanzliche Nahrung braucht viel . bis sie verdaut ist. Übersicht über die Verdauungsvorgänge (Buch S. 63) Organ und seine Verdauungstätigkeit Chemische Verdauung 12 Eiweiss (Protein) Verdauung Kohlenhydrate Menschenkunde Fett . Chemische Verdauung/ Enzyme 1 Ptyalin 2 Pepsin 3 Galle 4 Bauchspeichel 5 Dünndarmsaft . Die Nieren – Kläranlage und Stoffausscheidungsorgan (Buch S. 98 – 102) Schädliche Abfallstoffe aus den Zellen sammeln sich in Lymphe und Blut. Sie müssen ausgeschieden werden. Das Menschenkunde Verdauung 13 geschieht durch die Tätigkeit der Nieren und der Schweissdrüsen. Blutkreislauf 1 2 3 Niere 4 5 6 7 Ableitung 8 9 10 Funktion 11 12 Pro Tag fliesst . entstehen Liter Vorharn. Der grösste Teil davon wird wieder vom Blut. aufgenommen. Wir . mal die gesamte Blutmenge durch die Nieren (etwa scheiden nur etwa Liter Harn aus. l). Pro Tag Menschenkunde Verdauung 14 Bau der Niere (Längsschnitt) 1 2 3 4 5 6 7 8 Feinbau der Niere und ihre Funktion Die Rinde jeder Niere enthält ungefähr 1 Million Durchmesser von je 0,2 mm. Jedes Nierenkörperchen besteht aus einer kugeligen in welche feinste eingestülpt sind. Zusammenfassung (Kreuzworträtsel) Ä AE, Ö OE, Ü UE mit einem Menschenkunde Verdauung 15 Waagrecht Senkrecht 2. Der letzte Abschnitt des Dickdarms 5. Kann bei häufigem Konsum zu Leberzirrhose (Leberkrankheit) führen 10. Ein Kohlenhydrat (eine Kette von Traubenzuckermolekülen) 11. Versorgt die Leber mit Blut (vom Dünndarm und Milz) 15. Die wichtigste Verdauungsdrüse des Menschen 17. Ein Enzym zur Stärkespaltung 18. Wird dem Nahrungsbrei im Dickdarm hauptsächlich entzogen 19. Ei Teil der Leber (dort wird ein Enzym zur Fettemulgierung produziert) 21. Ein wichtiges bestimmtes Enzym zur Eiweissverdauung 22. Sitzen auf den Falten der Darmwand 24. Ein Organ, das neben anderen Funktionen zur Entgiftung des Körpers beiträgt 25. Ein Vorgang zur Nahrungszerkleinerung 26. Harter Teil eines Zahns 27. Ein Schließmuskel des Magens 28. Verbindet Niere mit Blase 29. Name des 6-8 cm langen Anfangsteils des Dickdarms 30. Der erste Abschnitt des Dünndarms 1. Schwer bzw. gar nicht verdauliche Nahrungsbestandteile 3. Ein Baustein von Fettmolekülen (das Enzym Lipase zerlegt Fett in seine Bausteine) 4. Der am schnellsten durch die Darmwand aufgen. Einfachzucker 6. Wird durch das Kauen und Zerkleinern der Nahrung erreicht 7. Wird bei einer „Blinddarmentzündung operiert 8. Ein Bestandteil des Magensaftes 9. Ein Baustein von Fettmolekülen (das Enzym Lipase zerlegt Fett in seine Bausteine) 12. Hintere Backenzaehne 13. Teil der Niere mit vielen Nierenkörperchen 14. Abgestimmte Kontraktionen von Speiseröhre, Magen und Darm zum Nahrungstransport 16. Zur Spaltung von Särke dienende Enzyme (Mehrzahl) 20. Verschliesst beim Schlucken die Luftröhre 23. Die Bausteine von Proteinen (Eiweissen)