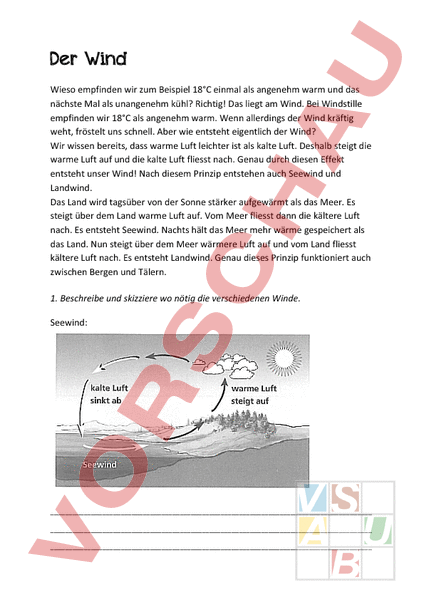Arbeitsblatt: Der Wind
Material-Details
M&U-Thema Wetter
Geographie
Anderes Thema
5. Schuljahr
6 Seiten
Statistik
123496
1178
17
06.11.2013
Autor/in
Maria Schlegel
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Der Wind Wieso empfinden wir zum Beispiel 18C einmal als angenehm warm und das nächste Mal als unangenehm kühl? Richtig! Das liegt am Wind. Bei Windstille empfinden wir 18C als angenehm warm. Wenn allerdings der Wind kräftig weht, fröstelt uns schnell. Aber wie entsteht eigentlich der Wind? Wir wissen bereits, dass warme Luft leichter ist als kalte Luft. Deshalb steigt die warme Luft auf und die kalte Luft fliesst nach. Genau durch diesen Effekt entsteht unser Wind! Nach diesem Prinzip entstehen auch Seewind und Landwind. Das Land wird tagsüber von der Sonne stärker aufgewärmt als das Meer. Es steigt über dem Land warme Luft auf. Vom Meer fliesst dann die kältere Luft nach. Es entsteht Seewind. Nachts hält das Meer mehr wärme gespeichert als das Land. Nun steigt über dem Meer wärmere Luft auf und vom Land fliesst kältere Luft nach. Es entsteht Landwind. Genau dieses Prinzip funktioniert auch zwischen Bergen und Tälern. 1. Beschreibe und skizziere wo nötig die verschiedenen Winde. Seewind: Landwind: 2. Wie entstehen Tal-‐ und Bergwind? Erkläre und skizziere wo nötig! Talwind: Bergwind: Der Luftdruck Aber auch der Luftdruck ist für die Bewegungen des Windes verantwortlich. Es entstehen Hoch-‐ und Tiefdruckgebiete, die auch die Windrichtung beeinflussen. ein Hochdruckgebiet entsteht dort, wo Luft absinkt und einen höherer Luftdruck entsteht. In Bodennähe fliesst dann die Luft aus dem Hochdruckgebiet in das benachbarte Tiefdruckgebiet, da dort niedrigerer Luftdruck herrscht. Diese Luftbewegung, die dadurch entsteht nehmen wir als Wind wahr. 3. Erkläre, was ein Hochdruckgebiet ist. Die Corioliskraft Betrachten wir einmal die gesamte Erde, dann stellen wir fest, dass in manchen Gegenden die Winde überwiegend in eine Richtung wehen. Das kommt daher, dass am Äquator das ganze Jahr die Sonne fast senkrecht auf die Erde scheint. Die Luft dort erwärmt sich besonders stark. Diese warme Luft steigt auf und strömt Richtung Süd-‐ und Nordpol. Diese Passatwinde entstehen, wenn ein Teil dieser Luft etwa beim 30 Breitengrad wieder abfällt und zum Äquator zurückfliesst. Die restliche Luft fliesst zu den Polen, um dort wieder auf die Erde abzusinken und in Richtung Äquator zurückzufliessen. Durch die Erddrehung werden diese ganzen Winde abgelenkt. Mann nennt diese Kraft die „Corioliskraft. Natürlich können diese Winde nicht frei fliessen, da jeder Berg und jedes grössere Gebirge eine Art Hindernis darstellen. Aber der Wind ist nicht immer so freundlich und bringt nur Regenwolken, die wir zum Wachsen der Pflanzen und Nahrungsmittel benötigen. Der Wind kann auch sehr gefährlich werden. Als Orkan oder Tornado begegnet ihm sicherlich keiner gerne. 4. Warum können Winde nicht frei über die Erde hinwegwehen? 5. Überlege dir welchen Nutzen der Mensch aus der Windkraft zieht. Liste mögliche Beispiele auf. Die Beaufortskala Sir Francis Beaufort war ein britischer Admiral, der von 1774 bis 1857 lebte. Als Schiffskommandant hat er sich mit Windgeschwindigkeiten beschäftigt, denn Wind ist für ein Schiff sehr wichtig. Es gab bereits eine Einteilung, mit der man an Land bestimmen konnte, wie stark der Wind gerade wehte allerdings konnte man das nicht einfach so auf die Windverhältnisse auf dem Meer übertragen. Im Jahr 1806 hatte Beaufort dann die nach ihm benannte Beaufort-‐Skala entwickelt. Seit dem wird anhand dieser Skala der Wind in 12 verschiedene Stärken unterteilt. Dafür braucht man kein Messgerät. Die Windstärken lassen sich anhand von typischen sichtbaren Auswirkungen auf die Landschaft bestimmen. Diese Auswirkungen hat Beaufort einmal für Wind an Land festgelegt und einmal für Wind auf See. Etwas über 100 Jahre später wurde sie dann noch um fünf weitere Windstärken von 13 bis 17 erweitert. 1. Was genau misst die Beaufortskala? 2 Versuche, die Auswirkungen der Richtigen Windstärke zuzuordnen, indem du sie in das passende Kästchen schreibst. Lange, mässige Wellen; grosse Äste werden bewegt Hohe Wellenberge; Bäume neigen sich, Äste reissen ab See vollständig weiss, keine Sicht; starke Schäden an Land Mässig hohe Wellenberge; Zweige werden abgerissen See türmt sich; Blätter werden abgerissen Spiegelglatte See; Wäsche hängt ganz still Extreme Wellenberge, Häuser können Schaden nehmen Kleine, längere Wellen; grosse Zweige werden bewegt Vereinzelte Schaumköpfe; bewegte Blätter Kleine Kräuselwellen; ganz leicht bewegte Blätter Sehr hohe Wellenberge; entwurzelte Bäume Grössere Wellen; grosse Äste werden stark bewegt Kleine, kurze Wellen; leicht bewegte Blätter Windstärke Skala Auswirkungen Windstille 0 Leiser Zug 1 Leichte Brise 2 Schwache Brise 3 Mässige Brise 4 Frische Brise 5 Starker Wind 6 Steifer Wind 7 Stürmischer Wind 8 Sturm 9 Schwerer Sturm 10 Orkanartiger Sturm 11 Orkan 12