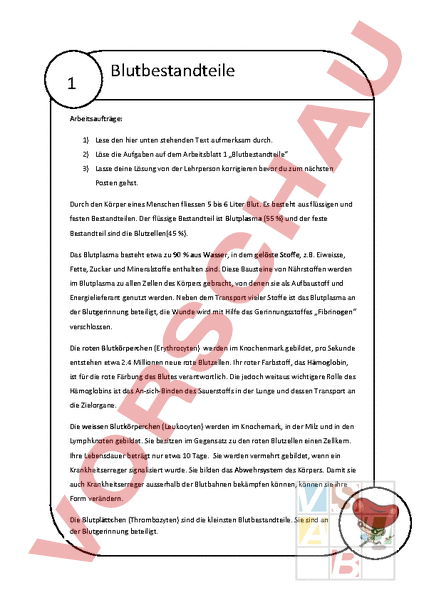Arbeitsblatt: Blut_Postenlauf
Material-Details
Zu jedem Bereich des Blutes gibt es mehrerer Arbietsblätter auch mit praktischen Versuchen, die die S selbständig durchführen können.
Der gesamte Postenlauf braucht zwischen 5 und 7 Lektionen.
Biologie
Anatomie / Physiologie
7. Schuljahr
16 Seiten
Statistik
124675
1442
14
03.12.2013
Autor/in
Martina Vecchi
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
fd 1 Blutbestandteile Arbeitsaufträge: 1) Lese den hier unten stehenden Text aufmerksam durch. 2) Löse die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt 1 „Blutbestandteile 3) Lasse deine Lösung von der Lehrperson korrigieren bevor du zum nächsten Posten gehst. Durch den Körper eines Menschen fliessen 5 bis 6 Liter Blut. Es besteht aus flüssigen und festen Bestandteilen. Der flüssige Bestandteil ist Blutplasma (55 %) und der feste Bestandteil sind die Blutzellen(45 %). Das Blutplasma besteht etwa zu 90 aus Wasser, in dem gelöste Stoffe, z.B. Eiweisse, Fette, Zucker und Mineralstoffe enthalten sind. Diese Bausteine von Nährstoffen werden im Blutplasma zu allen Zellen des Körpers gebracht, von denen sie als Aufbaustoff und Energielieferant genutzt werden. Neben dem Transport vieler Stoffe ist das Blutplasma an der Blutgerinnung beteiligt, die Wunde wird mit Hilfe des Gerinnungsstoffes „Fibrinogen verschlossen. Die roten Blutkörperchen (Erythrocyten) werden im Knochenmark gebildet, pro Sekunde entstehen etwa 2.4 Millionen neue rote Blutzellen. Ihr roter Farbstoff, das Hämoglobin, ist für die rote Färbung des Blutes verantwortlich. Die jedoch weitaus wichtigere Rolle des Hämoglobins ist das An-sich-Binden des Sauerstoffs in der Lunge und dessen Transport an die Zielorgane. Die weissen Blutkörperchen (Leukocyten) werden im Knochemark, in der Milz und in den Lymphknoten gebildet. Sie besitzen im Gegensatz zu den roten Blutzellen einen Zellkern. Ihre Lebensdauer beträgt nur etwa 10 Tage. Sie werden vermehrt gebildet, wenn ein Krankheitserreger signalisiert wurde. Sie bilden das Abwehrsystem des Körpers. Damit sie auch Krankheitserreger ausserhalb der Blutbahnen bekämpfen können, können sie ihre Form verändern. Die Blutplättchen (Thrombozyten) sind die kleinsten Blutbestandteile. Sie sind an der Blutgerinnung beteiligt. 1 Blutbestandteile dddssdsdsds AB Aufgabe 1 Füge die folgenden Begriffe passend ins Diagramm ein: Blutplättchen, Erythrozyten, Leukozyten, Blutplasma, rote Blutkörperchen, Wasser, Blutzellen, gelöste Bestandteile und weisse Blutkörperchen Aufgabe 2 Benenne die abgebildeten Blutbestandteile. Gebe jeweils beide möglichen Bezeichnungen an. Schreibe zu jeder Blutzelle, so viele Informationen wie möglich. Bezeichnung Abbildung Entstehungsort Lebensdauer Funktion fd 2 Blutgruppen Arbeitsaufträge: 1) Lese aufmerksam die Grundlagen zum Thema Blutgruppen hier unten durch. 2) Löse das Arbeitsblatt 1,2 3 „Blutgruppen 3) Lasse deine Lösungen von der Lehrperson kontrollieren bevor du zu nächstem Posten gehst. Die Blutgruppen werden durch die verschiedenen Antigene ( Eiweissstoffe Proteine) auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen bestimmt. Als Antigene bezeichnet man Substanzen, die im Körper die spezifische Abwehrreaktion des Immunsystems auslösen, indem Antikörper gebildet werden. Träger der Blutgruppe besitzen das Antigen und die der Blutgruppe das Antigen B. Menschen mit der Blutgruppe AB besitzen beide Antigene und die der Blutgruppe 0 keine Antigene. Jeder Mensch besitzt in seinem Serum ( Flüssigkeit des Blutes ohne die Blutzellen), auch ohne vorherigen Kontakt mit fremden Blutkörperchen, Antikörper gegen dasjenige Antigen des ABO-Systems, das ihm selbst fehlt. Antikörper sind Eiweissverbindungen, die vom Körper gebildet werden, wenn Antigene eingedrungen sind. Sie heften sich an die Antigene und hindern sie so an ihrer Vermehrung oder sie markieren Antigene, sodass sie von sogenannten Fresszellen abgetötet werden können. Man unterscheidet dabei Antikörper-A (Anti-A) und Antikörper-B (Anti-B). Das heisst also, dass die Blutgruppe den Antikörper A, die Blutgruppe den Antikörper B, die Blutgruppe beide Antikörper und die Blutgruppe AB keine Antikörper besitzen. Bei einer Bluttransfusion tritt immer dann eine Verklumpung auf, wenn die Antikörper im Serum des Empfängers zu den Antigenen auf der Oberfläche der roten Blutzellen des Spenders wie ein Schlüssel zum Schloss passen. So passt Anti-A genau zum Antigen und kann dort andocken. Durch diese Antigen-Antikörper-Reaktion vernetzen die roten Blutzellen und verklumpen. Man nutzt diese Antigen-AntikörperReaktion, um einen Blutgruppentest durchzuführen. Neben den Antigenen und gibt es weitere Antigene auf der Oberfläche der roten Blutzellen. Eines davon ist der Rhesusfaktor. Er wird ebenfalls beim Blutgruppentest erfasst. Er wurde bei Rhesusaffen entdeckt. Etwa 85 der Mitteleuropäer besitzen diesen Rhesusfaktor, ihr Blut wird mit rh (rhesus-positiv) bezeichnet. Die übrigen 15 besitzen dieses Molekül nicht; ihr Blut wird mit rh- (rhesus-negativ) bezeichnet. Muss bei einem Patienten eine Bluttransfusion durchgeführt werden, so wird anhand seiner Blutgruppe entschieden, welches Blut, also welche roten Blutzellen ihm gespendet werden können. Bei einigen Blutgruppen können mehrere Spender empfangen werden, bei anderen ist es nur die eigene Blutgruppe. Wir reden bei der Transfusion vom Spender- und vom Empfängerblut. Die falsche Wahl des Spenderblutes kann den Tod des Patienten zur Folge haben. fd 2 Blutgruppen – AB 1 Aufgabe 1 Vervollständige die folgende Tabelle. Benutze für deine Zeichnung folgende Symbole: Antigen Antigen Anti-A Blutgruppe Anti-B A AB 0 43% 14% 6% 37% Antigen auf den roten Blutzellen Antikörper im Serum Verklumpung mit Häufigkeit in Europa Abbildung des Blutes mit Beschriftung der Antigene und Antikörper Aufgabe 2 Trage in die roten Blutzellen sinnvoll die 4 Blutgruppen ein. Die rote Blutzelle, von der aus ein Pfeil geht, ist der Spender, diejenige auf die ein Pfeil zukommt ist der Empfänger. fd 2 Blutgruppen – AB 2 Aufgabe 3 Gehe auf die Seite: Drei Patienten brauchen deine Hilfe. Sie benötigen eine Bluttransfusion, jedoch können sie uns nicht sagen, welche Blutgruppe sie haben. Nun ist es an dir, ihr Blut zu untersuchen und zu entscheiden, welches Blut sie bekommen. Deine Entscheidung kann ihnen das Leben retten! Viel Erfolg Patient 1: Reaktion mit: Antikörper-A: Antikörper -B: Rhesusfaktor: Seine Blutgruppe ist: Ausserdem kann er folgende Blutgruppen empfangen: Patient 2: Reaktion mit: Antikörper -A: Antikörper -B: Rhesusfaktor: Seine Blutgruppe ist: Ausserdem kann er folgende Blutgruppen empfangen: Patient 3: Reaktion mit: Antikörper t-A: Antikörper -B: Rhesusfaktor: Seine Blutgruppe ist: Ausserdem kann er folgende Blutgruppen empfangen: Hilfestellung: Zoome das Bild heran, so siehst du alles genauer. Wähle einen Patienten. Nehmen ihm am Arm Blut ab. Füge sein Blut in die drei Reagenzgläser. Untersuche nun den Inhalt der Reagenzgläser. Welches Blut würde so auf die Antikörper-A und auf die Antikörper-B reagieren? Bei dem Rhesusfaktor musst du herausfinden ob es auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen ein zusätzliches Antigen gibt. Bei der Bluttransfusion musst du alle für den Patienten mögliche Blutgruppen auf die Transfusionsstange hängen. Weitere Übungsmöglichkeiten unter: So wirst auch du zu einem Blutbestimmungsprofi Blutgruppen – AB 3 2 Aufgabe 4 a) Erkläre mit eigenen Worten, was der Rhesusfaktor ist. Was heisst es, wenn jemand rhesus-negativ ist? b) Könnte man Serum der Blutgruppe im Reagenzglas mit Blutgruppe AB ohne Verklumpung vermischen? Begründe! c) Erkläre weshalb Blutkonserven der Gruppe AB/rh- so selten sind. d) Erkläre das Schlüssel-Schluss-Prinzip bei der Antigen-Antikörper-Reaktion. 3 Blutkreislauf Arbeitsaufträge: 1) Studiere diese schematische Darstellung des menschlichen Herzens und versuche dir dabei die Bezeichnungen der einzelnen Partien einzuprägen. Du musst wissen, es gibt 2 Arten von Blutgefässen (Blutbahnen), die Arterien (Aorta) und die Venen. Die Arterien führen Blut vom Herzen weg und die Venen führen Blut ins Herz hinein. So wie du die Skizze nun betrachtest, ist die rechte Herzensseite auf der linken Hälfte des Blattes. (Der Spitz unten zeigt immer nach links, also zu unserem linken Arm. Deswegen besteht auch der linke Lungenflügel nur aus zwei Lappen anstatt aus drei, wie es bei dem rechten Lungenflügel der Fall ist.) 2) Schaue dir aufmerksam folgendes Video an: und verfolge beim zweiten Anschauen den Weg des Blutes auf dem Bild hier unten. 3) Löse die Arbeitsblätter 1 und 2 „Blutkreislauf 4) Lasse deine Lösung von der Lehrperson korrigieren bevor du zu nächstem Posten gehst. fd 3 Blutkreislauf – AB 1 Aufgabe 1 Vervollständige den Lückentext. Verwende die folgenden Wörter: Kapillaren – Herzkammer – Lungenarterie – Vorhof – Aorta – linken –Herzkammer – rechten – sauerstoffreiches – Gasaustausch – sauerstoffreiche– Lungenvene – Lungen – Kohlenstoffdioxid –Körperarterie – Herzkammer -Hohlmuskel – Sauerstoff – Vorhof – kohlenstoffdioxidreiches Das Herz ist ein starker. Er besteht aus einer_ und einer Herzhälfte. Jede Herzhälfte ist in einen und in eine geteilt. Durch die linke Herzhälfte strömt nur Blut. Es wird aus der linkendurch die () in den Körper gepumpt. Die Arterien verzweigen sich immer mehr und leiten das Blut in dünne. Diese versorgen die Zellen unseres Körpers mit und nehmen aus den Zellen auf. Nun fliesst durch die Venen bis zum rechten zurück. Von der rechten führt die Lungenarterie das sauerstoffarme Blut zu den. Dort findet der statt. Durch die wird das jetzt Blut in den linken Vorhof geführt. So schliesst sich der Kreislauf. fd 3 Blutkreislauf – AB 2 Aufgabe 2 Beschrifte in der Skizze alle Bestandteile des Herzens mit korrekten Bezeichnungen. Versuche es zuerst ohne Hilfsmittel. Färbe danach Bereiche, wo sich sauerstoffreiches Blut aufhaltet in rot und bei sauerstoffarmen Blut blau an. Aufgabe 3 Ist dir schon mal aufgefallen, dass einige deiner Blutgefässe eher blau als rot aussehen. Nun wollen wir experimentell erfahren, wie es zu dieser Erscheinung kommt. Versuch (nur in Anwesenheit der Lehrperson!) Wir geben etwa 2 cm hoch nicht-gerinnendes Blut in alle 3 Reagenzgläser. In die beiden äusseren Reagenzgläser geben wir die Winkelröhrchen, verbinden das linke mit der Sauerstoff-Flasche, das rechte mit der Kohlenstoffdioxid-Flasche und lassen die Gase ganz langsam durch das Blut perlen. Stelle eine Hypothese (Vermutung) auf. Führe den Versuch durch. Das Ergebnis ist schon nach wenigen Minuten sichtbar. Notiere deine Beobachtung und vergleiche diese mit deiner Hypothese. Notiere deine Schlussfolgerung. Hypothese: Beobachtung: Schlussfolgerung: fd 4 Blutdruck Arbeitsaufträge: 1) Zuerst musst du den Begriff Blutdruck kennen lernen damit du nachvollziehen kannst, wie er gemessen wird. Lese nun den nachfolgenden Text aufmerksam. 2) Löse mit einem Partner die Arbeitsaufträge von dem Arbeitsblatt 1 „Blutdruck. Während des Herzschlages zieht sich der Herzmuskel zusammen und presst das Blut mit hohem Druck (Blutdruck) in das Gefässsystem (sog. Systole). Anschliessend erschlafft das Herz wieder und füllt seine Kammern mit neuem Blut (sog. Diastole). Normalerweise sollte der Blutdruck langfristig nicht über einem systolischen Wert von 140 mmHg und einem diastolischen Wert von 90 mmHg liegen. Bei älteren Menschen über 60 Jahre darf der systolische Wert manchmal auch etwas über 140 mmHg liegen. Dieser höhere Wert lässt sich darauf zurückführen, dass die Blutgefässe im Alter einen Teil ihrer Elastizität einbüssen. Wichtig ist jedoch, dass auch in diesem Alter der diastolische Wert die Grenze von 90 mmHg nicht überschreitet. Bei Kindern liegen die Normalwerte niedriger als bei Erwachsenen. Daher wäre ein Wert von 140/90 mmHg bei einem Kind bereits als Bluthochdruck anzusehen. Die Blutdruckmessung ist ein Verfahren, bei dem auf akustischer Basis eine Überprüfung des Blutflusses in den Blutgefässen vorgenommen wird. Dabei nutzt man die Tatsache, dass das Blut in den Gefässen nicht kontinuierlich, sondern in Druckwellen fliesst, welche durch die Pumpbewegung des Herzmuskels erzeugt werden. Der Herzmuskel zieht sich zusammen und presst das Blut mit hohem Druck in das Gefässsystem (sog. Systole). Anschliessend erschlafft das Herz wieder und füllt seine Kammern mit neuem Blut (sog. Diastole). Der sog. systolische Blutdruck der Ausstossphase liegt also über dem Mittelwert, während der sog. diastolische Blutdruck unter dem Mittelwert liegt. Die Angabe des Blutdrucks umfasst daher immer den systolischen und den diastolischen Wert, wobei der systolische Wert immer höher sein muss als der diastolische Wert. fd 4 Blutdruck – AB 1 Aufgabe 1: Führe mit einem Partner die Blutdruckmessung nach der Anleitung durch. Notiere dann die gemessenen Werte von dir und deinem Partner. Anleitung: Die Messung mit einem manuell bedienbaren Blutdruckmessgerät wird durchgeführt, indem zunächst die Manschette um den Arm gelegt und geschlossen wird. Anschliessend wird die Manschette aufgepumpt, so dass der von aussen wirkende Druck auf die Blutgefässe grösser ist als der systolische Blutdruck. Das Stethoskop wird an den Arm unterhalb der Blutdruckmanschette angelegt, um im Verlauf der Messung die durch den Blutfluss erzeugten Geräusche zu hören. Liegt der durch die Manschette ausgeübte Druck höher als der systolische Druck des Blutes, kann das Blut nicht durch das Gefäss fliessen. Erst wenn der Manschettendruck vorsichtig verringert wird, kann, sobald der systolische Blutdruck erreicht ist, der Blutfluss als pulsendes Geräusch wahrgenommen werden. In diesem Moment wird der systolische Druck als Wert auf der Messskala der Manschette abgelesen. Wird durch weiteres Verringern des Manschettendrucks der diastolische Blutdruck erreicht, sind mit dem Stethoskop keine Geräusche mehr zu hören. In diesem Moment kann der diastolische Blutdruck als Wert auf der Skala der Manschette abgelesen werden. (siehe auch Videoanleitung unter: Gemessene Werte: Ich: Mein/e Mitschüler/in: Funktionen des Blutes fd 5 Arbeitsaufträge: 1) Lese den Nachfolgenden Text und notiere jeweils eine passende Abschnittüberschrift. 2) Löse das Kreuzworträtsel auf AB 3 „Funktionen des Blutes. 3) Lasse deine Lösungen von der Lehrperson korrigieren bevor du zu nächstem Posten gehst. Aufgaben des Blutes Blut gilt als „flüssiges Organ – eines der wichtigsten und grössten Organe im menschlichen Körper überhaupt. Ein erwachsener Mensch hat rund 5 – 6 Liter Blut. Der Blutkreislauf ist das grösste Transportsystem des Körpers: Rund 96�00 Kilometer lang ist dieses Leitungssystem, das jede Zelle mit Energie versorgt. Einzig die Hornhaut der Augen, die Haare, der Zahnschmelz sowie die Zehen- und Fingernägel sind nicht durchblutet. Zu den wesentlichen Aufgaben des Blutes gehören vor allem der Stofftransport, die Abwehr von Krankheitserregern, der Wundverschluss sowie die Wärmeverteilung. Um leben zu können, benötigt jede Zelle unseres Körpers Energie. Diese gewinnt sie durch „Verbrennung von Zucker mit Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser. Den Transport dieser Stoffe hin zu den einzelnen Zellen übernimmt das Blut. Transport von Gasen Sauerstoff gelangt durch das Einatmen von Luft in die Lunge. In der Lunge nehmen die roten Blutkörperchen Sauerstoff auf und transportieren ihn zu den Zellen in Geweben und Muskeln. Das in den Zellen entstehende „Abfallprodukt Kohlendioxid wird hier aufgenommen und zurück zur Lunge transportiert, von wo es durch Ausatmen Funktionen des Blutes AB 1 fd 5 Transport von festen Stoffen Blut nimmt aus dem Darm Nährstoffe auf und transportiert sie zu den Zellen. Dabei sind zwei Gruppen zu unterscheiden: Wasserlösliche (z.B. Traubenzucker) und wasserunlösliche Feststoffe (z.B. Fette). Die wasserunlöslichen Stoffe werden für den Transport an ein Eiweiss gebunden. Zellen übergeben dem Blut Abfallstoffe. Es führt sie zur Lunge, zur Leber oder zu den Nieren. Anschliessend verlassen diese Stoffe den Körper, beispielsweise im Urin. In der Umwelt leben zahlreiche Krankheitserreger wie Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten (z.B. Malariaerreger). Unser Organismus braucht ein Abwehrsystem, um sich gegen diese bedrohlichen Eindringlinge zur Wehr zu setzen. An diesem Abwehrsystem sind die weissen Blutkörperchen beteiligt. Die Blutplättchen (oder Thrombozyten) und die Eiweissstoffe aus dem Plasma (Gerinnungsfaktoren) schützen den Körper vor Blutverlust bei kleineren Verletzungen. Die Blutstillung läuft in mehreren Schritten ab: Die verletzten Blutgefässe ziehen sich zusammen, sie verengen sich. Die Blutplättchen heften sich an den Rand der Gefässöffnung und verschliessen diese innerhalb weniger Minuten. Die Gerinnungsfaktoren (Plasmaeiweisse) werden aktiviert und in einem komplexen Vorgang entsteht ein unlösliches, fadenförmiges Protein, das Fibrin. Dieses verstärkt den Plättchenpfropf und bildet einen Schutz, der die fd 5 Funktionen des Blutes – AB 2 Sowohl bei kaltem Winterwetter wie auch im heissen Sommer soll das Innere des menschlichen Körpers eine Temperatur von ca. 37 C aufweisen. Die Körperwärme entsteht vor allem in arbeitenden Zellen. Das Blut transportiert diese Wärme durch den Körper zu allen Organen. Überschüssige Wärme wird durch erweiterte Blutgefässe in die Haut geführt und abgestrahlt. Wenn nötig, wird die Wärmeabgabe durch Schwitzen (Verdunstung von Wasser) verstärkt. Löse das Kreuzworträtsel: 1) Der wissenschaftliche Name der roten Blutkörperchen 2) Der zellfreie Bestandteil des Blutes 3) Der wissenschaftliche Name der Blutplättchen 4) Der rote Blutfarbstoff der Blutkörperchen 5) Entstehungsort der Zellen des Blutes 6) Der wissenschaftliche Name der weissen Blutkörperchen 7) Eine der 4 Funktionen des Blutes 8) Ein Art von Stoffen, welche vom Blut transportiert wird 9) Ein Art von Stoffen, welche vom Blut transportiert wird 10) Ein Art von Stoffen, welche vom Blut transportiert wird 11) Ein Art von Stoffen, welche vom Blut transportiert wird 12) Blutbestandteil, der für die Abwehr von Krankheitserregern zuständig ist 13) Blutbestandteil, der für den Wundverschluss zuständig ist fd 5 Funktionen des Blutes – AB 3 Blutkrankheiten fd 6 Achtung! Dieser Posten ist fakultativ zu bearbeiten. Bevor du damit beginnst sollst du zuerst alle 5 vorherigen Posten bearbeitet haben! Arbeitsauftrag: 1. Erstelle für deine Mitschüler eine Präsentation zum Thema als Vortrag mit Plakaten, Folien, Wandtafel, Smartboard oder Beamer zusammen: Wähle eine der Bluterkrankung aus und beschreibe ihr Erscheinungsbild (Symptome) und ihre Herkunft(Ursache). Was lässt sich medizinisch dagegen unternehmen (heilen)? Was lässt sich vorbeugend dagegen unternehmen? 2. Erstelle eine Seite (am Computer) mit den wichtigsten Informationen zu deinem Thema als Kopiervorlage. 3. Formuliere 2 mögliche Prüfungsaufgaben als Auswahl für eine Schlussprüfung. Notiere darunter die korrekten und ausführlichen Antworten. Links mit benötigten Informationen zur Präsentationsgestaltung: