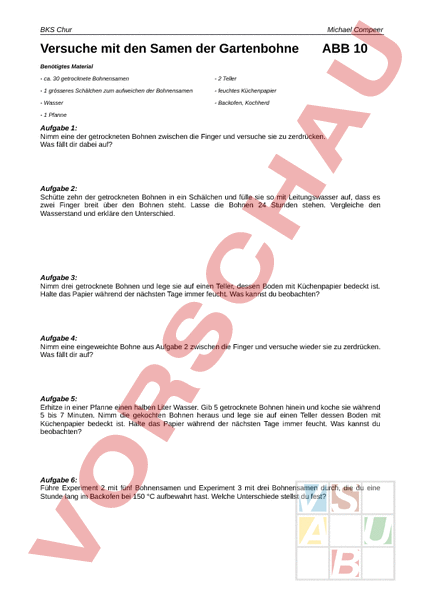Arbeitsblatt: Lebensansprüche von Pflanzen
Material-Details
Was benötigen Pflanzen für die Keimung und für ein erfolgreiches Wachstum?
Biologie
Pflanzen / Botanik
7. Schuljahr
15 Seiten
Statistik
124715
2382
29
05.12.2013
Autor/in
Michael Compeer
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
BKS Chur Michael Compeer Versuche mit den Samen der Gartenbohne ABB 10 Benötigtes Material ca. 30 getrocknete Bohnensamen 2 Teller 1 grösseres Schälchen zum aufweichen der Bohnensamen feuchtes Küchenpapier Wasser Backofen, Kochherd 1 Pfanne Aufgabe 1: Nimm eine der getrockneten Bohnen zwischen die Finger und versuche sie zu zerdrücken. Was fällt dir dabei auf? Aufgabe 2: Schütte zehn der getrockneten Bohnen in ein Schälchen und fülle sie so mit Leitungswasser auf, dass es zwei Finger breit über den Bohnen steht. Lasse die Bohnen 24 Stunden stehen. Vergleiche den Wasserstand und erkläre den Unterschied. Aufgabe 3: Nimm drei getrocknete Bohnen und lege sie auf einen Teller, dessen Boden mit Küchenpapier bedeckt ist. Halte das Papier während der nächsten Tage immer feucht. Was kannst du beobachten? Aufgabe 4: Nimm eine eingeweichte Bohne aus Aufgabe 2 zwischen die Finger und versuche wieder sie zu zerdrücken. Was fällt dir auf? Aufgabe 5: Erhitze in einer Pfanne einen halben Liter Wasser. Gib 5 getrocknete Bohnen hinein und koche sie während 5 bis 7 Minuten. Nimm die gekochten Bohnen heraus und lege sie auf einen Teller dessen Boden mit Küchenpapier bedeckt ist. Halte das Papier während der nächsten Tage immer feucht. Was kannst du beobachten? Aufgabe 6: Führe Experiment 2 mit fünf Bohnensamen und Experiment 3 mit drei Bohnensamen durch, die du eine Stunde lang im Backofen bei 150 C aufbewahrt hast. Welche Unterschiede stellst du fest? BKS Chur Samen der Feuerbohne Samen der Feuerbohne Michael Compeer BKS Chur Samen der Feuerbohne Samen der Feuerbohne Michael Compeer BKS Chur Michael Compeer Die Gartenbohne ABB 11A Blüte und Frucht Die Blüten der Gartenbohne besitzen unterschiedlich geformte Blütenblätter. Aus der Entfernung erinnern sie an einen kleinen Schmetterling. Blüten mit diesem Aussehen heissen Schmetterlingsblüten. Wie ist eine solche Blüte aufgebaut? Aufbau von Schmetterlingsblüte und Hülse Der fünfzipfelige, grüne Kelch ist glockenförmig. Nach oben ragt aus ihm ein besonders großes Blütenblatt, die Fahne, heraus. Die beiden seitlichen Blütenblätter, die den Schmetterlingsflügeln gleichen, heissen Flügel. Zwischen ihnen versteckt liegt ein kahnförmiges Gebilde, das Schiffchen. Es besteht aus zwei miteinander verklebten Blütenblättern. Insgesamt besitzt die Blüte der Gartenbohne also fünf Blütenblätter. Sie ist fünfzählig. Verborgen im Inneren des Schiffchens liegen zehn Staubblätter. Neun davon sind im unteren Abschnitt miteinander verwachsen. Sie bilden eine Rinne, die vom zehnten, freien Staubblatt abgedeckt wird. In dieser Rinne befindet sich der lang gestreckte Fruchtknoten. Er besteht aus einem einzigen Fruchtblatt. Der Griffel ist hakenförmig aufwärts gebogen. Die Narbe liegt also in unmittelbarer Nähe der Staubbeutel. Deshalb können reife Pollenkörner leicht auf die Narbe gelangen; es kommt regelmäßig zur Selbstbestäubung. Im Gegensatz zu vielen anderen Pflanzen (z.B. Apfelbäume, Birnbäume, Kirschbäume, Tulpen, Klee,) ist bei der Gartenbohne keine Fremdbestäubung zur Samenbildung erforderlich. Nach der Befruchtung entwickelt sich eine einfächrige Frucht, die Hülse. In ihrem Inneren reifen mehrere Bohnensamen. Aus jedem von ihnen kann eine neue Bohnenpflanze heranwachsen. Zum Aufbau der Samen Der Bohnensamen ist von einer Samenschale umgeben, an der deutlich der Nabel zu erkennen ist. An dieser Stelle war die Bohne in der Hülse angewachsen. Bei einem Samen, der über Nacht in Wasser gelegen hat, lässt sich die Samenschale leicht entfernen. Der geschälte Samen besteht aus zwei dicken, weißlichen Hälften. Dies sind die nährstoffhaltigen Keimblätter. Dazwischen liegt der Keimstängel mit den ersten Laubblättern und der Keimknospe. Die Keimwurzel ist ebenfalls deutlich zu erkennen. Das bedeutet: Der Samen einer Pflanze ist ein mit Vorratsstoffen ausgestatteter Keimling oder Embryo im Ruhezustand. Er ist ein vollständiges Pflänzchen, das nur noch heranwachsen muss. Keimung und Wachstum Solange die Samen der Gartenbohne nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, verändern sie ihr Aussehen nicht. Sie scheinen vollkommen leblos; sie befinden sich in Samenruhe. So überstehen sie ohne Schaden ungünstige Bedingungen, zum Beispiel lange Trockenheiten oder Frost. Damit der Samen sich zu einer jungen Pflanze entwickeln kann, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein: • Ohne Wasser kann kein Samen keimen. • Die Temperatur beeinflusst die Keimung: Wärme fördert die Geschwindigkeit; Samen, die kühl gehalten werden, keimen weniger rasch. • Wie alle Lebewesen benötigen keimende Samen auch den Sauerstoff der Luft. Licht und Erde sind dagegen für die Entwicklung der Keimpflanze zunächst nicht nötig. Erst die wachsende Pflanze ist darauf angewiesen. BKS Chur Michael Compeer Die Gartenbohne II ABB 11B Unerlässliche Keimungsbedingungen sind also Wasser, Wärme und der Sauerstoff aus der Luft. In feuchter Erde nehmen die Samen der Gartenbohne Wasser auf, quellen und werden grösser. Der dadurch entstehende Druck lockert das umgebende Erdreich und der Keimling kann beim Wachsen den Boden leichter durchdringen. Als erstes durchbricht die Keimwurzel die Samenschale. Sie wächst nach unten in die Erde und bildet dabei Seitenwurzeln aus. Erst jetzt wird der hakenförmig gebogene Stängel sichtbar. Er wächst nach oben und zieht die beiden Keimblätter aus der aufgeplatzten Samenschale heraus. Der weissliche Stängel richtet sich über der Erde auf und wird, ebenso wie die beiden Keimblätter, im Licht bald grün. Die ersten Laubblätter entfalten sich und der Spross wächst mit der Stängelknospe in die Länge. Gleichzeitig schrumpfen die Keimblätter, trocknen ein und fallen schliesslich ab. Der wachsende Stängel verfestigt sich und hält die Pflanze aufrecht. Das ist zum Beispiel bei den niedrig wachsenden Buschbohnen der Fall. Stangenbohnen dagegen benötigen eine Stütze, wenn sie grösser werden. Sie führen beim Wachsen kreisende Suchbewegungen aus. Haben sie einen Halt gefunden, so winden sie sich um die Stütze herum. Dies geschieht immer in der gleichen Richtung. Die Bohne ist ein Linkswinder, das heisst sie dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, wenn man von oben auf die Pflanze blickt. Aufgabe 1: Schäle einen gequollenen Bohnensamen. Brich ihn in zwei Teile auseinander. Betrachte das Innere mit dem Binokular und zeichne. Zeichnung Aufgabe 2: Ergänze die Abbildung mit folgenden Begriffen: Samenschale (1) Keimblatt Samen trocken Frucht mit Samen Keimblätter Laubblätter (1) Nabel Keimstängel (1) Samen gequollen Wurzeln Laubblätter (2) Keimpore Blüte Keimwurzel (2) Junge Keimpflanze Keimwurzel (1) Samenschale (2) Erwachsene Pflanze Keimstängel (2) Sprossspitze BKS Chur Entwicklung der Bohne ABB 11C Michael Compeer BKS Chur Entwicklung der Bohne II Michael Compeer ABB 11D Keimung Wenn du im Garten Bohnenpflanzen ziehen möchtest, so legst du im Frühjahr Bohnensamen ins feuchte Erdreich. Manchmal keimen Samen aber nicht. Woran kann das liegen? Wahrscheinlich ist irgendeine Bedingung, die zum Keimen des Samenkorns nötig ist, nicht erfüllt. Man kann die Keimungsbedingungen durch Experimente herausbekommen. Wenn du zum Beispiel wissen möchtest, ob Erde notwendig ist, dann musst du die Erde in einem Keimungsversuch durch etwas anderes ersetzen. Wenn die Samen dennoch keimen, dann ist Erde überflüssig. Damit du richtige Ergebnisse erhältst, musst du überprüfen, ob die verwendeten Samen überhaupt keimfähig sind. Dazu legst du zehn Samen in feuchte Erde und schaffst natürliche Bedingungen. Die Keimung ist gelungen, wenn die ersten grünen Blättchen zu sehen sind. Ein solches Experiment heisst Kontrollversuch. Aufgabe 3: Nenne fünf Bedingungen, welche erfüllt sein müssen, dass eine Pflanze keimen und wachsen kann. Aufgabe 4: Keimen die Samen in den fünf untenstehenden Abbildungen? Ist nach der Keimung ein weiteres Wachstum möglich? Warum nicht? Situation Bewertung Situation Bewertung BKS Chur Michael Compeer Bedingungen für Keimung und Wachstum ABB 12 Aufgabe 5: In den Versuchen mit den Bohnensamen zu Hause hast du Bohnensamen gekocht und dabei festgestellt, dass sie dadurch die Fähigkeit zur Keimung verloren haben. Was passiert deiner Meinung nach, wenn du die Samen für eine Woche in den Kühlschrank gibst? Was bedeutet das Ergebnis für die natürlichen Verhältnisse? trockene Samen gequollene Samen Bedeutung für die Natur Aufgabe 6: Bohnen werden in feuchtem Sand zum Keimen gebracht, bis Spross bzw. Wurzel 2 cm lang sind. Mit wasserlöslicher Tusche werden im Abstand von 1 mm Markierungsstriche angebracht. Nach vier Tagen wird kontrolliert. Die Ergebnisse sind in den unten stehenden Abbildungen dargestellt. Beschreibe das Ergebnis. BKS Chur Michael Compeer Bedingungen für Keimung und Wachstum ABB 12B Aufgabe 7: In einem Labor werden die unten beschriebenen Versuche durchgeführt. Beschreibe wie die Keimlinge nach 14 Tagen deiner Meinung nach aussehen. a) Über einen Topf mit jungen Keimlingen wird eine schwarz ausgekleidete Schachtel gestülpt, so dass die Keimlinge sich in vollständiger Dunkelheit befinden. c) Der dritte Topf wird ohne Abdeckung waagrecht hingelegt. Was passiert mit Stängeln und Wurzeln? b) Der zweite Topf wird mit einem Dunkelkasten wie bei a) versehen. Diesmal wird eine Öffnung geschaffen. Das einfallende Licht trifft die Spitze der Keimlinge. d) Der vierte Topf dient als Kontrolle. BKS Chur Michael Compeer Ansprüche an Wasser, Boden, Licht ABB 13A Stülpt man ein grosses Glas über eine Pflanze, so beschlägt es von innen mit Wassertröpfchen. Offenbar verdunstet das Wasser aus den Blättern der Pflanze. Mikroskopische Untersuchungen zeigen, dass die Blätter winzige spaltförmige Öffnungen besitzen. Diese befinden sich meist auf der Blattunterseite und sind mit der Lupe als dunkle Punkte zu erkennen. Im mikroskopischen Bild sieht man, dass der Spalt von zwei bohnenförmigen Zellen gebildet wird. Aus der dazwischen liegenden Öffnung verdunstet das Wasser. Die Spaltöffnungen können geöffnet und geschlossen werden und so die Wasser-abgabe regeln. Wie gelangt nun ständig neues Wasser in die Blätter? Bringt man einen beblätterten Zweig in mit roter Tinte gefärbtes Wasser, so erkennt man den Verlauf des Wasserstroms bis in die Blattadern hinein. Den Transport in Spross und Blatt übernehmen bestimmte Wasserleitungs-bahnen, die Gefässbündel. Die Pflanze nimmt das Wasser aus dem Erdreich auf. Kurz hinter der wachsenden Wurzelspitze befindet sich ein weisslicher, watteähnlicher Überzug, die Wurzelhaare. Durch ihre Oberfläche gelangt das Wasser in die Pflanze. Über die Gefässbündel werden alle Pflanzenteile von der Wurzel aus mit Wasser versorgt. Eine Birke mittlerer Grösse verdunstet auf diese Weise an warmen Sommertagen etwa 300 Liter Wasser. Das verdunstende Wasser kühlt die Blätter und zieht weiteres Wasser in der Pflanze nach. Der Wasserstrom in der Pflanze hat noch eine wichtige Aufgabe. Ein Versuch gibt darüber Auskunft: Zwei Bohnenkeimlinge, die gleich weit entwickelt sind, werden in zwei Bechergläser gebracht, nachdem das Erdreich von ihren Wurzeln abgespült worden ist. In einem Glas befindet sich destilliertes Wasser; beim zweiten Glas wird in das Wasser ein Esslöffel Komposterde eingerührt. Die Pflanze im destillierten Wasser beginnt zu kränkeln und wächst nur kümmerlich weiter; die zweite Pflanze entwickelt sich normal. Welchen Grund hat das? In der Erde befinden sich Stoffe, die von Pflanzen für ihr Gedeihen benötigt werden. Diese lebensnotwendigen Stoffe sind Mineralstoffe. Sie werden durch das Wasser aus dem Boden herausgelöst und dann durch die Wurzeln in die Pflanze aufgenommen. BKS Chur Michael Compeer Ansprüche an Wasser, Boden, Licht II Auch das Licht beeinflusst das Gedeihen einer Pflanze. Zimmerpflanzen, die nur von einer Seite her Sonnenlicht erhalten, krümmen sich zum Fenster hin und wenden ihre Blätter mit der Blattfläche dem Lichteinfall zu. Bei Bäumen sind die Blätter häufig so angeordnet, dass sie sich möglichst wenig gegenseitig beschatten (Blattmosaik). Pflanzen, die eine Zeit lang im Dunkeln gehalten werden, unterscheiden sich in ihrem Wachstum und Aussehen von gut belichteten Pflanzen. Ihr Spross wächst stark in die Länge, aber die Blätter bleiben klein und bleich. Eine grüne Pflanze kann sich nur dann gut entwickeln, wenn sie ausreichend Licht erhält. Ohne Licht geht sie schliesslich zugrunde. ABB 13B Blattmosaik beim Ahorn Düngung Pflanzen nehmen aus dem Erdreich fortwährend Mineralstoffe auf. Diese gehen dem Boden jedoch nicht verloren. Beim herbstlichen Laubfall oder nach dem Absterben der Pflanzen gelangen diese Stoffe wieder in den Boden zurück. Sie können nach der Zersetzung erneut genutzt werden. Gülledüngung Aber dort, wo der Mensch in seinen Gärten oder auf den Feldern die Pflanzen aberntet und abtransportiert, verarmen die Böden. Dieser Verlust lässt sich durch natürlichen Dünger, wie Kompost oder Stallmist, wieder ausgleichen. Der Boden wird dadurch zusätzlich mit Humusstoffen angereichert. Das sind verweste, pflanzliche und tierische Stoffe, die ebenfalls zur Verbesserung des Bodens beitragen. Auf Wiesen und Feldern wird häufig mit Jauche oder Gülle gedüngt. Diese flüssigen Dünger haben den Vorteil, dass sie sich leichter auf grossen Flächen verteilen lassen. Ein Teil dieser Stoffe gelangt so allerdings auch in das Grundwasser. Dies hat in manchen Gegenden bereits zur Verschlechterung der Trinkwasserqualität geführt. Gülle darf deshalb nur zu bestimmten Zeiten ausgebracht werden, z. B. im zeitigen Frühjahr, kurz bevor das Pflanzenwachstum einsetzt und die Mineralstoffe dem Boden von den Pflanzen schnell wieder entzogen werden. In der Landwirtschaft wird heute in grossem Umfang Mineraldünger (Kunstdünger) benutzt. Je nach Bodenbeschaffenheit und Pflanzenart muss unterschiedlich gedüngt werden. Der Landwirt muss deshalb die Zusammensetzung des Ackerbodens und die Ansprüche seiner Kulturpflanzen genau kennen. Denn auch ein Zuviel an Mineralstoffen kann zu Schäden an den Pflanzen führen. Sie wachsen dann möglicherweise zu schnell oder sind anfälliger gegen ungünstige Witterungsverhältnisse und Schädlinge. BKS Chur Ansprüche an Wasser, Boden, Licht III Michael Compeer ABB 13C Aufgabe 1: Wasser verdunstet aus den Blättern einer Pflanze. Wie funktioniert dies? Aufgabe 2: Erkläre den Begriff „Gefässbündel. Aufgabe 3: Auf welche Weise gelangt das Wasser, welches in der Erde festgehalten wird, in die Wasserleitungsgefässe einer Pflanze? Nimm die entsprechende Abbildung zu Hilfe. Aufgabe 4: Welche Stoffe (neben dem Wasser) werden ebenfalls mit Hilfe der Wurzeln aufgenommen? Wozu braucht die Pflanze diese Stoffe? Was passiert bei einem Mangel an solchen Stoffen? Aufgabe 5: Weshalb krümmen sich Zimmerpflanzen immer zum Licht hin? Pflanzen erzeugen Nährstoffe ABB 14A Menschen und Tiere können nicht leben, ohne zu essen und zu trinken. Aber hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wovon sich Pflanzen ernähren? Bereits im Jahr 1640 beschäftigte sich der holländische Arzt Van Helmont mit dieser Frage. Um sie zu beantworten, führte er folgenden Versuch durch. Er pflanzte ein Weidenbäumchen mit einer Masse von 2.5 kg in einen Kübel, in dem sich eine genau abgewogene Menge Erde befand. Fünf Jahre lang hat er die Pflanze nur mit Regenwasser gegossen und darauf geachtet, dass keine Erde hinzukam oder weggespült wurde. Die Weide hatte danach eine Masse von 84.5 kg, war also um 82 kg schwerer geworden. Das Nachwiegen der Erde ergab, dass sie nur um 57 leichter geworden war. Van Helmont meinte, die Frage nach der pflanzlichen Ernährung gelöst zu haben. Für ihn lautete die Antwort: Ausser einer geringen Menge an Mineralstoffen benötigt die Pflanze für ihr Wachstum und ihre Gewichtszunahme nur ausreichend Wasser. Beides nimmt sie durch ihre Wurzeln aus dem Erdreich auf. Aber ist das schon die vollständige Erklärung? Wir wollen einmal nachrechnen: Pflanzen bestehen zu einem grossen Teil aus Wasser. Zum Beispiel werden 100 frisches Gras durch Trocknung zu etwa 20 Heu. Die restlichen 80 sind Wasser und verdunsten beim Trocknen. Van Helmonts Weidenbäumchen, das um 82 kg schwerer geworden ist, verliert beim Trocknen etwa 67.6 kg Wasser. Seine Trockenmasse beträgt also noch 16.9 kg. Das ist sehr viel im Vergleich zu den 57 Mineralstoffen, die aus der Erde aufgenommen wurden. Selbst wenn noch etwas Wasser in der Pflanze zurückbleibt, lässt sich die Differenz von 16.9 kg nicht erklären. Was hat Van Helmont übersehen? BKS Chur Michael Compeer Eine zufällige Beobachtung führte im Jahre 1772 einen Schritt weiter. Damals experimentierte der englische Naturforscher Priestley mit Pflanzen und Tieren, um zu untersuchen, wie sich die Luft durch Lebewesen verändert. Er stellte fest, dass eine Maus in einem luftdicht verschlossenen Gefäss nach kurzer Zeit ohnmächtig wurde. Eine brennende Kerze ging in der verbliebenen Luft sofort aus. Eine grüne Pflanze konnte erstaunlicherweise in der gleichen Luft weiterleben ohne abzusterben. In einem dritten Versuch zeigte sich zur Verblüffung von Priestley, dass die Maus bei Tageslicht in ihrem luftdichten Gefäss wesentlich länger ohne Schädigung überlebte, wenn sich gleichzeitig Pflanzen darin befanden. Wir erklären das heute so: Die Pflanze gibt den für die Atmung eines Tieres notwendigen Sauerstoff in die Luft ab. Gleichzeitig nimmt sie aus der Luft einen anderen Bestandteil auf, nämlich Kohlenstoffdioxid. Die rätselhafte Massenzunahme des Weidenbäumchens hängt auch mit Veränderungen der Luft zusammen. Pflanzen benötigen also nicht nur Wasser und Mineralstoffe aus dem Boden, sondern sie nehmen auch Kohlenstoffdioxid aus der Luft auf. Ausserdem wissen wir, dass Pflanzen zum Leben auch Licht benötigen. Damit kommen wir der Antwort auf die Frage nach der Ernährung von Pflanzen, also auch deren Massenzunahme, wieder ein Stück näher. BKS Chur Pflanzen erzeugen Nährstoffe II Michael Compeer ABB 14B Fotosynthese und Zellatmung Welche Stoffe machen eigentlich neben dem Wasser die Masse einer Pflanze aus? In einer Kirsche befindet sich Zucker, in der Kartoffelknolle ist Stärke enthalten. Nüsse sind sehr fettreich und das Holz eines Weidenbäumchens besteht zum Teil aus Zellulose. Diese Stoffe wir nennen sie allgemein organische Stoffe müssen im Organismus der Pflanze gebildet worden sein. Wie das geschieht, wurde in den vergangenen 200 Jahren durch viele Versuche erforscht. Heute weiss man, wie sich Pflanzen ernähren: • Wasser und Mineralstoffe nimmt die Pflanze durch die Wurzeln auf. Kohlenstoffdioxid gelangt durch die Spaltöffnungen in die Blätter. • Zucker und Stärke (Kohlenhydrate) werden in den Blättern aus Kohlenstoffdioxid und Wasser gebildet. • Licht und Blattgrün (Chlorophyll) müssen bei diesem Vorgang ebenfalls vorhanden sein. • Sauerstoff wird dabei von den Pflanzen in die Luft abgegeben. • Alle anderen organischen Stoffe werden unter Verwendung des Zuckers und der Mineralstoffe in der Pflanze hergestellt. Die Ergebnisse lassen sich folgendermassen zusammenfassen: Die Pflanze stellt mithilfe von Sonnenlicht und Blattgrün (Chlorophyll) aus Kohlenstoffdioxid und Wasser Zucker her. Dabei wird Sauerstoff freigesetzt. Dieser Vorgang heisst Photosynthese. Grüne Pflanzen erzeugen also ihre Nährstoffe selbst und speichern sie zum Beispiel in Früchten, Knollen und Wurzeln. Menschen und Tiere sind auf diese organischen Stoffe angewiesen. Sie benötigen den Zucker für ihren Stoffwechsel. Zusammen mit Sauerstoff wird der Zucker dazu genutzt, den Körper mit Energie zu versorgen. Kohlenstoffdioxid und Wasser werden dabei freigesetzt. Dieser Vorgang heisst Zellatmung. Auch Pflanzen leben von ihren Vorräten. Im Dunkeln können sie keine Fotosynthese betreiben. Sie müssen, wie Menschen und Tiere, Sauerstoff aufnehmen, also atmen. Grüne Pflanzen sind, wie andere Lebewesen auch, auf die Zellatmung angewiesen, wenn sie Energie für ihren Stoffwechsel freisetzen. Darüber hinaus sind sie zusätzlich zur Fotosynthese befähigt, wenn genügend Licht vorhanden ist. BKS Chur Photosynthese und Zellatmung Michael Compeer ABB 14C Aufgabe 1: Beschreibe anhand der obigen Abbildung den Gaswechsel bei der Photosynthese beziehungsweise bei der Zellatmung. Photosynthese Zellatmung Aufgabe 2: Welche Beobachtung hätte PRIESTLEY gemacht, wenn er eine Maus und eine grüne Pflanze im Dunkeln in einem luftdicht verschlossenen Gefäss gehalten hätte? Aufgabe 3: Auch Wurzeln müssen mit Sauerstoff versorgt werden. Begründe.