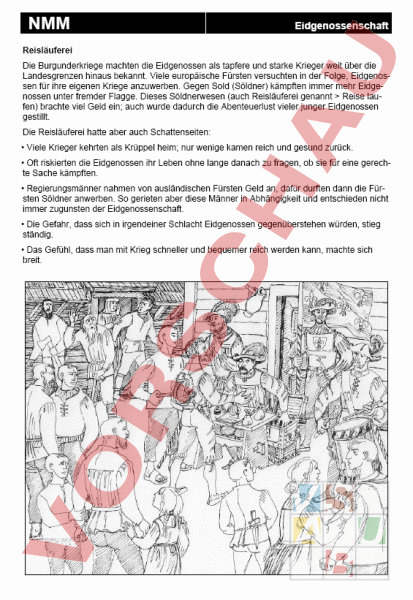Arbeitsblatt: Tagsatzung zu Stans
Material-Details
Gründe und Ergebnis der Tagsatzung zu Stans (1481); Reisläuferei; Saubannerzüge
Geschichte
Schweizer Geschichte
6. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
12634
1092
12
06.12.2007
Autor/in
René Spicher
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
NMM Eidgenossenschaft Reisläuferei Die Burgunderkriege machten die Eidgenossen als tapfere und starke Krieger weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Viele europäische Fürsten versuchten in der Folge, Eidgenossen für ihre eigenen Kriege anzuwerben. Gegen Sold (Söldner) kämpften immer mehr Eidgenossen unter fremder Flagge. Dieses Söldnerwesen (auch Reisläuferei genannt Reise laufen) brachte viel Geld ein; auch wurde dadurch die Abenteuerlust vieler junger Eidgenossen gestillt. Die Reisläuferei hatte aber auch Schattenseiten: • Viele Krieger kehrten als Krüppel heim; nur wenige kamen reich und gesund zurück. • Oft riskierten die Eidgenossen ihr Leben ohne lange danach zu fragen, ob sie für eine gerechte Sache kämpften. • Regierungsmänner nahmen von ausländischen Fürsten Geld an, dafür durften dann die Fürsten Söldner anwerben. So gerieten aber diese Männer in Abhängigkeit und entschieden nicht immer zugunsten der Eidgenossenschaft. • Die Gefahr, dass sich in irgendeiner Schlacht Eidgenossen gegenüberstehen würden, stieg ständig. • Das Gefühl, dass man mit Krieg schneller und bequemer reich werden kann, machte sich breit. Die Eidgenossen sind unter sich uneins Auf der einen Seite standen die Länderorte Uri, Schwyz und Unterwalden, Zug und Glarus auf der anderen Seite die Städteorte Luzern, Bern und Zürich. Da die Freiburger und Solothurner in den Burgunderkriegen den Eidgenossen geholfen hatten, hofften sie, in den eidgenössischen Bund aufgenommen zu werden. So dachte und sprach man damals in der Eidgenossenschaft: Im Burgunderkrieg haben sie mit uns gekämpft. Darum sind sie uns als Eidgenossen willkommen. Bis jetzt gehören fünf Länder und drei Städte zur Eidgenossenschaft. Nehmen wir Freiburg und Solothurn auf, dann haben beide Parteien gleich viele Stimmen. Wir Länderorte haben dann nichts mehr zu sagen. In der Eidgenossenschaft herrschen wilde Sitten. Da haben doch junge Burschen den Versuch unternommen, den Rest der von der Stadt Genf geschuldeten Summe von 20�00 Gulden im Saubannerzug eigenhändig abzuholen. Das ist ein Raubzug. Es ist Zeit, dass wir uns schützen. Richtig, wir Städter sind an der Tagsatzung in der Minderheit. Also schliessen wir ein Burgrecht mit Freiburg und Solothurn! Das ist ein Sonderbund! Luzern hat sich 1332 verpflichtet, uns anzufragen, bevor es ein Bündnis mit anderen Orten eingeht. Luzern muss wieder austreten! Ihr habt Unordnung in den Ländern, die übermütigen Burschen regieren bei euch, nicht die Landammänner. Anders wäre der Saubannerzug nicht zustande gekommen. Das ist kein Sonderbund. Er richtet sich nicht gegen euch, sondern dient allein unserem Schutz, denn wer weiss, was den Saubannerleuten noch einfällt! Die Verteilung der Beute von Grandson war ungerecht. Es sollte jeder Ort, ob klein oder gross, gleich viel Beute erhalten. Wir stellten im Burgunderkrieg die meisten Truppen, darum steht uns auch der grösste Teil der Beute zu. Es ist doch klar, dass grosse Orte wie z.B. Bern mehr Beute erhalten sollen als Zug. Die drei Städte haben jetzt schon zuviel Macht. Zusammen mit Freiburg und Solothurn wären sie noch viel stärker, und wir Länder könnten abdanken. Wir haben die Eidgenossenschaft gegründet, und jetzt befehlen die Herren in der Stadt, was wir zu tun haben. Euer Sonderbund ist so schlimm wie das Bündnis Zürichs mit Österreich im Alten Zürichkrieg. Zuletzt werden wir noch Untertanen der Städter. Sie schliessen uns ein, und wir können nochmals vorne beginnen, unsere Freiheit zu erkämpfen. Wir wollen keine Städter als neue Vögte. Das Stanser Verkommnis (1481) An der Tagsatzung von Stans vermag der Rat des Einsiedlers Nilaus von der Flüe den Streit zwischen Stadt- und Landorten zu schlichten. Im letzten Moment wird so das Auseinanderbrechen der Eidgenossenschaft verhindert. Die Gefahr eines Bürgerkrieges ist gebannt. Freiburg und Solothurn werden in den Bund aufgenommen. Das steht im Vertrag 1. Wir nehmen die Stände Freiburg und Solothurn als vollberechtigte Ort in unseren Bund auf. 2. Die alten Bundesbriefe sollen weiterhin gelten. Es gibt keine Sonderbünde. 3. Alle Orte helfen einander, wenn es gilt, aufständische Untertanen oder Feinde zu bezwingen. Es soll keinen Saubannerzug mehr geben! 4. Die Beute in Kriegszügen wird gerecht verteilt: Die Gebietsgewinne werden nach Orten verteilt, die Beute nach Köpfen (d.h. Anzahl Krieger). Als Saubannerzug (auch Kolbenbannerzug genannt) wird der Aufbruch einer Freischar aus der Innerschweiz nach Genf im Jahr 1477 bezeichnet. Der Name Saubanner geht auf ein mitgeführtes Banner zurück, auf welchem ein wilder Eber (Sau/Schwein) mit einem Kolben ein Zeichen für Unzufriedenheit – auf blauem Grund abgebildet war. Der Kolben (also eine Holzkeule) stand für Widerstandsbewegungen des 15. Jahrhunderts für die gerechte Sache. Hintergrund des Saubannerzugs waren die Burgunderkriege von 1474 bis 1477. Nach der Schlacht bei Nancy am 5. Januar 1477 gründeten zurückgekehrte Urner und Schwyzer Kriegsleute, die mit der Beuteverteilung unzufrieden waren, die so genannte Gesellschaft vom torechten Leben. In der Fastnachtszeit des Jahres 1477 brachen sie Richtung Westschweiz auf, um von Genf die versprochene Brandschatzsumme zu fordern. Dem Zug schlossen sich unterwegs auch Kriegsknechte aus anderen Orten der Zentralschweiz an. Die Zahl der am Zug Beteiligten wird auf 1700 Leute geschätzt. Den Obrigkeiten von Zürich, Bern und Luzern kam dieses Unterfangen jedoch äusserst ungelegen, da sie sich in Verhandlungen mit Frankreich und Savoyen befanden und nicht in den Verdacht geraten wollten, die eigenen Truppen nicht unter Kontrolle zu haben. Umgehend wurden Gesandtschaften aus Bern und den anderen eidgenössischen Orten sowie aus den Städten Genf, Basel und Strassburg zu den Aufständischen geschickt. Den Gesandten gelang es am 4. März 1477 den Zug, der bereits bis Payerne und Lausanne gelangt war, zu stoppen. Genf musste sich verpflichten, den Eidgenossen von den noch geschuldeten 24�00 Gulden sofort 8�00 auszuzahlen. Für den Rest wurden Geiseln gestellt. Zudem musste Genf jedem Zugteilnehmer zwei Gulden als Entschädigung entrichten sowie einen Umtrunk anbieten. Auch für die Bezahlung der Gesandten und weitere Ausgaben musste Genf aufkommen. Nach dem Zug ging Genf mit Bern und mit Freiburg das erste Burgrecht ein, um sich vor weiteren Freischaren zu schützen und die eidgenössischen Städte besiegelten ein unbefristetes Burgrecht. Dies wiederum rief den Protest der Länderorte hervor. Ein Ausweg aus dem Konflikt wurde mit dem Stanser Verkommnis gefunden.