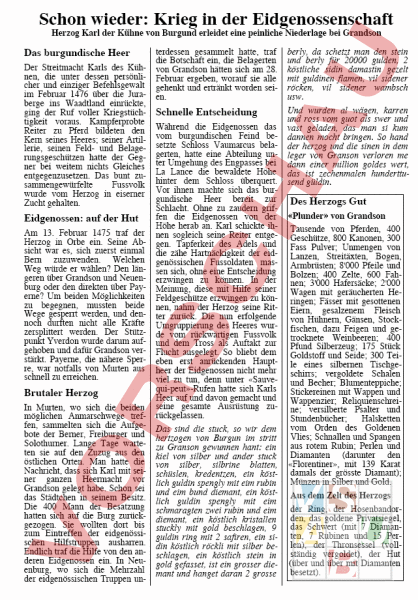Arbeitsblatt: Burgunderkriege
Material-Details
Die Burgunderkriege als Zeitung gestaltet
Geschichte
Schweizer Geschichte
6. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
12641
2286
66
07.12.2007
Autor/in
René Spicher
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Schon wieder: Krieg in der Eidgenossenschaft Herzog Karl der Kühne von Burgund erleidet eine peinliche Niederlage bei Grandson Das burgundische Heer Der Streitmacht Karls des Kühnen, die unter dessen persönlicher und einziger Befehlsgewalt im Februar 1476 über die Juraberge ins Waadtland einrückte, ging der Ruf voller Kriegstüchtigkeit voraus. Kampferprobte Reiter zu Pferd bildeten den Kern seines Heeres; seiner Artillerie, seinen Feld- und Belagerungsgeschützen hatte der Gegner bei weitem nichts Gleiches entgegenzusetzen. Das bunt zusammengewürfelte Fussvolk wurde vom Herzog in eiserner Zucht gehalten. Eidgenossen: auf der Hut Am 13. Februar 1475 traf der Herzog in Orbe ein. Seine Absicht war es, sich zuerst einmal Bern zuzuwenden. Welchen Weg würde er wählen? Den längeren über Grandson und Neuenburg oder den direkten über Payerne? Um beiden Möglichkeiten zu begegnen, mussten beide Wege gesperrt werden, und dennoch durften nicht alle Kräfte zersplittert werden. Der Stützpunkt Yverdon wurde darum aufgehoben und dafür Grandson verstärkt. Payerne, die nähere Sperre, war notfalls von Murten aus schnell zu erreichen. Brutaler Herzog In Murten, wo sich die beiden möglichen Anmarschwege treffen, sammelten sich die Aufgebote der Berner, Freiburger und Solothurner. Lange Tage warteten sie auf den Zuzug aus den östlichen Orten. Man hatte die Nachricht, dass sich Karl mit seiner ganzen Heermacht vor Grandson gelegt habe. Schon sei das Städtchen in seinem Besitz. Die 400 Mann der Besatzung hatten sich auf die Burg zurückgezogen. Sie wollten dort bis zum Eintreffen der eidgenössischen Hilfstruppen ausharren. Endlich traf die Hilfe von den anderen Eidgenossen ein. In Neuenburg, wo sich die Mehrzahl der eidgenössischen Truppen un- terdessen gesammelt hatte, traf die Botschaft ein, die Belagerten von Grandson hätten sich am 28. Februar ergeben, worauf sie alle gehenkt und ertränkt worden seien. Schnelle Entscheidung Während die Eidgenossen das vom burgundischen Feind besetzte Schloss Vaumarcus belagerten, hatte eine Abteilung unter Umgehung des Engpasses bei La Lance die bewaldete Höhe hinter dem Schloss überquert. Vor ihnen machte sich das burgundische Heer bereit zur Schlacht. Ohne zu zaudern griffen die Eidgenossen von der Höhe herab an. Karl schickte ihnen sogleich seine Reiter entgegen. Tapferkeit des Adels und die zähe Hartnäckigkeit der eidgenössischen Fussoldaten massen sich, ohne eine Entscheidung erzwingen zu können. In der Meinung, diese mit Hilfe seiner Feldgeschütze erzwingen zu können, nahm der Herzog seine Ritter zurück. Die nun erfolgende Umgruppierung des Heeres wurde vom rückwärtigen Fussvolk und dem Tross als Auftakt zur Flucht ausgelegt. So bliebt dem eben erst anrückenden Hauptheer der Eidgenossen nicht mehr viel zu tun, denn unter «Sauvequi-peut»-Rufen hatte sich Karls Heer auf und davon gemacht und seine gesamte Ausrüstung zurückgelassen. Das sind die stuck, so wir dem hertzogen von Burgun im stritt zu Granson gewunnen hant: ein kiel von silber und ander stuck von silber, silbrine blatten, schüslen, kredentzen, ein köstlich guldin spengly mit eim rubin und eim bund diemant, ein köstlich guldin spengly mit eim schmaragten zwei rubin und eim diemant, ein köstlich kristallen stuckly mit gold beschlagen, 9 guldin ring mit 2 safiren, ein sidin köstlich röckli mit silber beschlagen, ein köstlich stein in gold gefasset, ist ein grosser diemant und hanget daran 2 grosse berly, da schetzt man den stein und berly für 20000 gulden, 2 köstliche sidin damastin gezelt mit guldinen flamen, vil sidener röcken, vil sidener wambsch usw. Und wurden al wägen, karren und ross vom guot als swer und vast geladen, das man si kum dannen mocht bringen. So hand der herzog und die sinen in dem leger von Granson verloren me dann einer million goldes wert, das ist zechenmalen hunderttusend güldin. Des Herzogs Gut «Plunder» von Grandson Tausende von Pferden, 400 Geschütze, 800 Kanonen, 300 Fass Pulver; Unmengen von Lanzen, Streitäxten, Bogen, Armbrüsten; 8�00 Pfeile und Bolzen; 400 Zelte, 600 Fahnen; 3�00 Hafersäcke; 2�00 Wagen mit geräucherten Heringen; Fässer mit gesottenen Eiern, gesalzenem Fleisch von Hühnern, Gänsen, Stockfischen, dazu Feigen und getrocknete Weinbeeren; 400 Pfund Silberzeug; 175 Stück Goldstoff und Seide; 300 Teile eines silbernen Tischgeschirrs; vergoldete Schalen und Becher; Blumenteppiche; Stickereinen mit Wappen und Wappenzier; Reliquienschreine; versilberte Psalter und Stundenbücher; Halsketten vom Orden des Goldenen Vlies; Schnallen und Spangen aus rotem Rubin; Perlen und Diamanten (darunter den «Florentiner», mit 139 Karat damals der grösste Diamant); Münzen in Silber und Gold. Aus dem Zelt des Herzogs der Ring, der Hosenbandorden, das goldene Privatsiegel, das Schwert (mit 7 Diamanten, 7 Rubinen und 15 Perlen), der Thronsessel (vollständig vergoldet), der Hut (über und über mit Diamanten besetzt). Die Schlacht bei Grandson 2. März 1476 16. Februar 1476 Die Berner Hauptstreitmacht setzt sich Richtung Murten mit 7�00 Mann unter der Führung von Niklaus von Scharnachtal und Hans von Hallwyl in Bewegung. Die Berner vermuten, dass Karls Angriff von Payerne her erfolgen wird. In Murten stossen die Verbündeten aus der Niederen Vereinigung und die österreichischen Reiter unter Graf Oswald von Thierstein zum Heer der Berner. 18. Februar 1476 Die Tagsatzung beschliesst den Bernern, Freiburgern, Neuenburgern und Solothurnern ihre Zuzüge zu schicken. 19. Februar 1476 Karl der Kühne trifft mit seinem Heer vor Grandson ein. Hauptmann Wyler von Bern führt die rund 500-Mann-Verteidigungstruppe. 21. Februar 1476 Hauptmann Wyler kann dem Ansturm der Burgunder nicht stand- halten und beschliesst sich in die Burg zurückzuziehen. In der Eile kann er jedoch nicht genügend Nahrungsmittel mitnehmen. Karl dringt ins Städtchen ein und errichtet dort seinen Lagerplatz. Aus nächster Nähe kann er nun die Burgmauern beschiessen. Die Belagerten senden einen Boten nach Bern um die missliche Lage zu schildern. Die Berner versuchen vom Wasser her zusätzliche Truppen und Nahrungsmittel in die Burg zu bringen. Die Artillerie von Karl vereitelt diese Versuche mühelos. Die Besatzungstruppen verlieren den Mut und treten in Verhandlungen mit Karl. 22. Februar 1476 Bern ist über die Truppenstärke von Karl im Ungewissen. Der französische König eilt nicht wie versprochen mit Hilfstruppen zu den Eidgenossen. Die Berner drohen König Ludwig XI sich mit Karl zu verständigen, wenn er ihnen nicht zu Hilfe kommt. Der König verweilt jedoch in Lyon hüllt sich in Schweigen und wartet in Ruhe die Ereignisse ab 23. Februar 1476 Die Zuzüge aus den 6 Alten Orten setzen sich in Bewegung um Bern zu helfen. 27. Februar 1476 Die Berner erhalten die Nachricht, dass Karl in Grandson sei und verlagern ihre Streitmacht mit ihren Verbündeten nach Neuenburg. 28. Februar 1476 Die eingeschlossenen Berner in der Burg versuchen mit Karl einen Übergabevertrag auszuhandeln welcher ihnen das Weiterleben garantiert. Karl jedoch besteht darauf die Burg zu nehmen. Gegen Gnad oder Ungnad, schliesslich ergeben sich die Berner völlig ausgehungert. Die 412 Mann werden sogleich gefangen genommen und an den Bäumen aufgehängt oder im See ersäuft. Nun machte auf Schweizerseite das Gerücht die Runde, dass Karl sein Wort gebrochen habe. Karl habe versprochen, sie am Leben zu lassen und nur deshalb hätten sich die Berner ergeben. Zudem hätten Überlebende aus Estavayer Karl noch zusätzlich aufgestachelt. Eine antibur- gundische Werbekampagne, welche sich durch die Jahrhunderte erhalten hat. Zudem, Berner ergeben sich nicht. Dieses Image wäre im weiteren Kriegsverlauf verheerend gewesen. Karl hatte absolut keinen Grund, irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Er brauchte bloss lange genug zu warten, die Burg hätte so oder so ihm gehört. Spätestens nach dem Massaker in Dinant, welches Karl angerichtet hatte, musste jedem klar sein, was mit der gefangenen Burgbesatzung geschehen würde. 1. März 1476 Die Verbündeten aus den alten Orten treffen in Neuenburg ein. Gerade rechtzeitig, um zu erfahren, dass Grandson bereits gefallen ist. Karl beschliesst die eidgenössischen Truppen zu suchen und auszukundschaften. Mit einer Vorhut reitet er bis Vaumarcus und besetzt die Burg. Die Burg sichert den Engpass am Neuenburgersee zwischen den Rebbergen und dem See. 2. März 1476 Während die Eidgenossen das vom Feind besetzte Schloss Vaumarcus belagern, hat eine Abteilung unter Umgehung des Engpasses bei La Lance die bewaldete Höhe hinter dem Schlosse überquert. Auf eine Lichtung hinaustretend, sieht sie zu Füssen das burgundische Heer, das die feste Stellung über dem Arnonflüsschen verlassen hat und soeben auf der Terrasse längs des Sees aufmarschiert. Ohne zu zaudern, schreiten die Eidgenossen von der Höhe herab zum Angriff. Karl schickt ihnen seine Reiter entgegen. Tapferkeit des Adels und zähe Hartnäckigkeit des eidgenössischen Fusssoldaten messen sich, ohne eine Entscheidung erzwingen zu können. In der Meinung, diese mit Hilfe seines Feldgeschützes herbeizuführen, nimmt Karl seine Reisigen zurück. Die nun erfolgende Umgruppierung wird von dem rückwärtigen Fussvolk und dem Trosse als Auftakt zur Flucht ausgelegt. So bleibt dem eben erst anrückenden Haupthaufen der Eidgenossen wenig mehr zu tun. Unter «Sauve-qui-peut»-Rufen hat Karls Heer sich auf und davon gemacht und seine gesamte Ausrüstung zurückgelassen. In tausend Krambuden fanden die Sieger zunächst, was Herz und Gaumen erfreute. Unermesslich war der Vorrat an Kriegsgerät, an Büchsen, Feldschlangen, Spiessen, Mordäxten, Armbrüsten und die Beute an Pannern. Von märchenhafter Pracht aber waren all die Dinge, die man in den Prunkzelten Karls und seiner Grossen vorfand. Da stand in einem der kostbare Thronsessel, von dem aus der Herzog die Gesandten empfing; ein anderes enthielt die Hofkapelle mit einem kunstvoll gearbeiteten Flügelaltar, einer schweren goldenen Monstranz und Karls handgemaltem Gebetbuch mit goldenen Spangen und edelsteinverziertem Einband; in einem weitern, für die Hofkanzlei bestimmten, war das Hauptsigill des herzoglichen Hauses, an purem Gold und ein Pfund schwer, zurückgeblieben. Das Innere der Speisezelte erglänzte von edel geformten Pokalen und ganzen Stapeln silbernen und goldenen Tafelgeschirrs. 400 Reisekisten enthielten bestickte Kleider und die feinsten flandrischen Stoffe. Sammet und Seide wurde von den Kriegern wie grobes Tuch zerschnitten, das Geld aus den Kriegskassen in Hüten verteilt. Und da man ihrer wunderbewirkenden Kraft zuliebe auch die allerkostbarsten Kleinode ins Feld mitzunehmen pflegte, so fanden sich unter der Beute auch die seltensten Diamanten. Indes geschah es, dass ein Stück, dessen Wert eine Provinz aufwog, von einem für Glas genommen und um geringes Geld wieder losgeschlagen wurde.Im fluchtartig verlassenen Heerlager von Karl dem Kühnen wurden als Beute zusammengetragen: • rund 400 Kanonen, darunter die Orgelstube mit ihren 3 Rohren • 800 Hakenbüchsen • 300 Fass Schiesspulver • 573 Fahnen und 27 grosse Hauptbanner • 4000 Streitkolben • 400 Zelte • 3000 Säcke Hafer • 2000 Wagen voll Heringe für die Freitage, welche Fastenzeiten waren • Lebensmittel wie Brot, Getreide, Fleisch und Wein • die Kriegskasse mit Edelsteinen, Teppiche, den Hut von Karl dem Kühnen Auch bei Murten: Kein Glück für Herzog Karl Vor den Toren Murtens flieht das Burgunder-Heer vor den heranstürmenden Eidgenossen Angriff auf Bern? Nach 6 Stunden im Regen Ein Jahr nach der Schlappe von Grandson bedrohte Herzog Karl der Kühne erneut die Stadt Bern. Diesmal kam er vom Genfersee her gegen Murten zu, das die Berner zu ihrem Sperrfort gemacht hatten: Es war schwierig, sich den Mauern der Stadt zu nähern, denn die Berner hatten Schanzen gebaut, die Verbindung vom See her war durch die Ausrüstung schneller Boote gesichert. Adrian von Bubenberg kommandierte die 2�00 Mann Besatzung von Murten. Nach dem Einzug der Zürcher, die in drei Tagen die 145 Kilometer von Zürich nach Ulmiz zu Fuss zurückgelegt hatten, zogen die eidgenössischen Truppen Richtung Murten, um die Stadt von der burgundischen Belagerung zu erlösen. Ein Überraschungsangriff war nicht mehr möglich, denn das Heer Karls des Kühnen war in Alarmbereitschaft versetzt worden und stand bereit. Nachdem es aber bereits sechs Stunden lang geregnet hatte, ohne dass die Eidgenossen zu sehen gewesen wären oder gar angegriffen hätten, brachen die Burgunder den Alarmzustand ab. Die Söldner machten es sich in ihren Zelten gemütlich und vergassen den Krieg. Auf diesen Moment hatten die «Bauern» gewartet: Sie griffen an. Nach den ersten Kampfhandlungen am Grünhag gab der Herzog den Befehl, sich in die Ebene zurückzuziehen. Diese Kehrtwendung war wie bei Grandson für viele Burgunder das Zeichen zum Rückzug, zur Flucht! Murten wird belagert Als sich Karl mit etwa 20�00 Mann der Stadt Murten näherte, begrüssten ihn die Geschütze, die er vor Jahresfrist über den Jura nach Grandson gebracht hatte. Seine Absicht war es, Murten zu erobern und dann gegen Bern vorzustossen, noch bevor der gesamte eidgenössische Auszug ins Feld gerückt war. Doch die Vorwerke hielten seinen ununterbrochenen Angriffen stand. In der zweiten Belagerungswoche traten seine schweren Bombarden in Aktion: Ein mörderisches Feuern bei Tag und bei Nacht begann. Grosse Stücke der Mauer brachen nieder. Auch von der Seeseite her war die Stadt jetzt praktisch abgeriegelt. Und Verstärkung oder Ersatz der Verteidiger war nicht in Sicht. Am 18. Juni setzten die Belagerer, wie sie meinten, zum entscheidenden Sturm an. Doch erneut gelang die Eroberung nicht. Bevor der Herzog zu einem neuen Angriff ansetzen konnte, wurde das Herannahen der Berner gemeldet. Zwar dauerte es noch einige Tage, bis sich der Zuzug aus den übrigen Orten und der Verbündeten am Besammlungsort in Gümmenen eingefunden hatte. Doch nun musste sich Herzog Karl auf eine Feldschlacht vorbereiten. Und diese Schlacht sollte für den mächtigen Herzog von Burgund zu einer Katastrophe werden. Si wuoten drin bis an das kinn, dennocht schoss man vast zuo in als ob si enten weren, man schift zuo in und sluogs ze tod, der se der wart von bluote rot, jemerlich hort man si pleren. Gar vil die klummen uf die böum, wiewol ir nieman mocht haben göum, man schos si als die kregen, man stachs mit spiessen über ab, ir gefider in kein hilfe gab, der wint mocht si nit wegen. 20500 Tote? Diesmal schlugen die Eidgenossen erbarmungslos, ja brutal zu: Von den rund 36�00 Mann des burgundischen Heeres sollen etwa 20�00 ihr Leben verloren haben! Andere Quellen sprechen von 10�00 Toten. Auf Seite der Eidgenossen beklagte man den Tod von rund 500 Kriegern. Der herzog von Burgunnen genant, der kam für Murten hin gerant, sin schaden wolt er rechen, den man im vor Granson hat getan, sin zelten spannt er uf den plan, Murten wolt er zerbrechen. Einer floch har, der ander hin do er wol meint verborgen sin, man tot si in den hürsten, kein grösser not sach ich nie me, ein gross schar lüff in den se, wie wol si nit was dürsten. Heer der Eidgenossen Truppen aus Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Biel, Neuenstadt, aus dem Thurgau, aus dem Freiamt und von Baden; Verstärkung durch die Truppen der Bischöfe von Basel und von Strassburg; Truppen des Herzogs Renatus von Lothringen; Österreicher; Truppen des Grafen von Greyerz Im Anmarsch ist im weiteren «viel Volk» von der Niederen Vereinigung, von Schaffhausen, St. Gallen, Appenzell, Neuenburg und aus dem Wallis «Je lay emprins»: Das Ende vom Mittelreich Trauriges Ende eines grossen Traumes: Herzog Karl der Kühne stirbt in der Schlacht bei Nancy Bien en advienne Winter, eine dritte Schlacht gegen ein weit überlegenes Heer von 20�00 Mann aus der Niederen Vereinigung (inbegriffen 8400 eidgenössische Söldner). Hier wurde Burgunds Macht endgültig vernichtet. Als sich Karl der Kühne 1464 damals noch als Graf von Charolais aufmachte, an der Rebellion der grossen Vasallen gegen den französischen König teilzunehmen, versuchte seine Frau, ihn von diesem Vorhaben abzu- René gegen den Wütrich halten. Er aber stellte fest: «Je lay emprins!» Das heisst in heuti- Nachdem Herzog Karl bei Murgem Französisch: «Je lai entre- ten derart vernichtend geschlapris!» «Ich hab es unternom- gen worden war, konnte es der men!» Und damit wollte Karl sa- junge Herzog Renatus von Lothgen: «Ich bleibe dabei!» Unheil ringen, ein Verbündeter der Eidahnend erwiderte die Gräfin: genossen, endlich wagen, gegen «Bien en advienne!» «Es möge den «Wütrich von Burgund» zu rüsten und sein Herzogtum wiegut herauskommen!» der zurückzugewinnen. Er suchte Dieses «Je lay emprins» ist zum (und fand) Hilfe bei König LudLeitspruch für Karls Leben ge- wig XI. von Frankreich, bei der worden. Er hat dieses Wort auf Niederen Vereinigung, den ElMünzen und Medaillen prägen sässern und Lothringern, bei einilassen und auf seine Fahnen ge- gen elsässischen Reichsstädten, schrieben. Überall begegnet uns bei den Bischöfen von Strassdas «Je lay emprins» zusammen burg und Basel und bei den Eidmit dem Symbol des von Karls genossen. Die eidgenössischen Vater gestifteten Ritterordens Söldner versammelten sich um vom Goldenen Vlies, der die er- Weihnachten 1476 in Basel und lesenste Ritterschaft der burgun- zogen unter Führung des Zürdischen Länder vereinigte. Die- chers Hans Waldmann gegen ses Symbol ist der Feuerstrahl, Nancy. der aus einem Feuerstein Feuer schlägt. Karl verwendet das Zei- Die Schlacht bei Nancy chen in Verbindung mit gekreuz- Schon lange hatte Karl der Kühten Ästen oder Pfeilen, bisweilen ne die Stadt Nancy belagert, momit den gegeneinander gestellten natelang, ohne dass sich die Buchstaben C, dem Anfangs- Stadt ergeben hätte. Schnee, entbuchstaben seines Namens setzliche Kälte und Hunger (Charles le Téméraire). machten ihm die Truppen mürbe und kampfunfähig: Allein in der Karl gibt nicht auf Weihnachtsnacht erfroren vor Karl der Kühne ist seinem ritter- Nancy 400 Mann und gingen lichen Wahlspruch treu geblie- 1�00 Pferde ein. Das Belageben bis zum bitteren Ende. Was rungsheer war der Auflösung er begonnen hatte, das gab er nahe. Mit 20�00 Mann rückten nicht auf. So hat er auch nach nun die Lothringer, Eidgenossen der fürchterlichen Niederlage und ihre Verbündeten gegen von Murten den Krieg nicht auf- Nancy. Herzog Renatus griff zu gegeben. Statt Frieden zu zu su- einer Kriegslist: Am Waldrand chen und seine Politik zu über- sollten einige Söldner einen prüfen, sammelte er noch ein- Grossangriff vortäuschen; die mal, was von seinem Heer übrig- Hauptmacht sollten dann den geblieben war: Mit etwa 12�00 Truppen Karls in die Flanke falMann belagerte dann Nancy, in len. Die List gelang. das Herzog Renatus von Lothringen wieder zurückgekehrt war. Karls trauriges Ende Hier wagte Karl der Kühne am Erst als seine Leibwachen gefal5. Januar 1477, also mitten im len waren, dachte Herzog Karl auch an sich und floh. Aber diese späte Flucht wurde ihm zum Verhängnis: Ein paar Verfolger waren ihm dicht auf den Fersen. Als Karls Pferd beim Übespringen eines Baches zögerte, durchbohrte ein Speer den Leib des Herzogs und tötete ihn. Beim Aufräumen der Umgebung des Schlachtfeldes fand man Karl zwei Tage später, eingefroren in den sumpfigen Wiesen von Voilay. Am 12. Januar 1477 wurde er feierlich beigesetzt in der St.-Georgs-Kirche von Nancy. Grafen und Fürsten trugen seinen Sarg. Um 1550 wurden seine Überreste nach Luxemburg gebracht, später nach Brügge in Flandern, wo er in der Kirche Notre-Dame an der Seite seiner Tochter Maria von Burgund seine letzte Ruhestätte fand. Warum sind die Eidgenossen in diesen Krieg getreten? • Die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft war, auf lange Sicht, bedroht durch das «Mittelreich» Karls. •Karls Vorstoss zum Oberrhein und das Bündnis mit Mailand bedrohte die Gotthardpolitik der Eidgenossen. • Geld: Die Parteinahme für Ludwig XI. brachte Geld ein zur Kriegsführung. • Friede mit Österreich, dem alten «Erbfeind» der Eidgenossen. • Ausdehnung der Eidgenossenschaft: Grandson, Murten, Orbe, Echallens, Erlach, Aigle und das Unterwallis blieben in der Hand von Bern, Freiburg und des Wallis; Freiburg und Solothurn wurden eidgenössisch; engere Verbindung mit Basel; freier Weg zum Gotthard (Tessin) wegen der Niederlage Mailands.