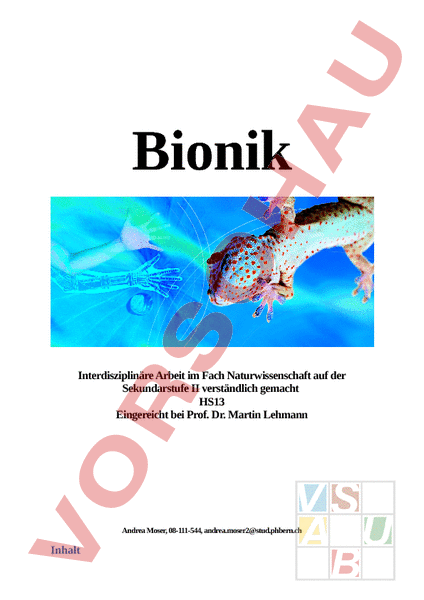Arbeitsblatt: Bionik: Interdisziplinärer Unterrichtsentwurf
Material-Details
Das Dokument beschreibt eine Unterrichtseinheit zum Thema Bionik.
Biologie
Gemischte Themen
klassenübergreifend
8 Seiten
Statistik
128589
1355
18
23.02.2014
Autor/in
Andrea Moser
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Bionik Interdisziplinäre Arbeit im Fach Naturwissenschaft auf der Sekundarstufe II verständlich gemacht HS13 Eingereicht bei Prof. Dr. Martin Lehmann Andrea Moser, 08-111-544, Inhalt 2 1. Unterrichtsrahmen Im Rahmen der MINT-Offensive an vielen Gymnasien der Schweiz werden der Einbezug von technischen Sachverhalten in den Unterricht und die Interdisziplinarität immer wichtiger. Beim Planen solcher Unterrichtseinheiten ist darauf zu achten, dass die Disziplinen nicht künstlich in einen Zusammenhang gesetzt werden. Vielmehr bietet es sich an, nach einem Phänomen zu suchen, das in sich schon diverse MINT-Disziplinen vereint. Die Bionik scheint hier ein sehr passendes Unterrichtsthema zu liefern. Hier verschmelzen Biologie, Chemie und Physik auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, dass es leicht fällt, motivierenden Unterricht zu planen. Dabei kommen nicht zuletzt die Aspekte der Forschung und des Experimentierens zur Anwendung. Viele Experten bezeichnen die Bionik als Schlüsseldisziplin zwischen Technik und Naturwissenschaften (vgl. Bionik Zentrum, Luzern). Die Verbindung von naturwissenschaftlichem und technischem Denken und Arbeiten ist für viele Lebensbereiche nützlich. Die Lernenden erkennen anhand der Beispiele aus der Bionik, wie Erkenntnisse aus der Biologie auf technische Anwendungen übertragen werden. Sie erfahren, dass die Evolution technische Lösungen hervorgebracht hat, die nun auf viele unserer alltäglichen Probleme übertragen werden können. Die präsentierte Unterrichtsidee spricht Lernende auf verschiedenen Ebenen an und kann auch an Berufsmaturitätsschulen verwendet werden. Um tiefer in das Thema abtauchen zu können, würden sich Blocktage besonders eignen (12-14 Lektionen). Ansonsten können auch die Lektionen des Ergänzungs- oder Schwerpunktfachs genutzt werden. Wünschenswert wäre eine Beteiligung von Lehrpersonen aus den Bereichen Biologie, Physik, Chemie und eventuell Mathematik. Denkbar ist aber auch eine Verbindung zu den Fächern Geographie und Geschichte. 1.1. Lernziele Die Lernenden • erhalten einen ersten Einblick in die Bionik, das technisches Nachahmen der Natur • können die physikalischen Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien, nach denen bionische Strukturen funktionieren, erläutern • zählen Beispiele auf, wo Bionik unser Leben beeinflusst und • können die Funktionsweisen davon erklären und den biologischen Bezug darlegen • verbessern ihre Fertigkeiten im Bereich der Partner- oder Gruppenarbeit • entwickeln Ideen für Anwendungen im Bereich der Bionik • präsentieren ausgewählte Beispiele der Bionik und erläutern daran das Zusammenspiel der Bezugsdisziplinen • führen Experimente durch und verarbeiten die Resultate zu einem Bericht 1.2. Lernvoraussetzungen Das Thema Bionik lässt sich gut durch entdeckendes und forschendes Lernen erschliessen. Entdeckendes Lernen fordert die Kreativität und den Ideenreichtum der Lernenden. Sie sollen auf eine definierte Fragestellung eine technische Lösung erarbeiten. Dabei soll ihnen die Biologie als Vorlage dienen. Während dieser Phase des Unterrichts gibt die Lehrperson keine Lösungswege vor. Die Lernenden erhalten die Gelegenheit, das Ursache-Wirkungs-Prinzip kennenzulernen und sich geeignete Modellvorstellungen zu erarbeiten. Im nächsten Schritt befinden wir uns im Bereich des erfindenden Lernens. Hier geht es nun darum, dass die Lernenden bereits existierende Anwendungen der Bionik nachvollziehen können. Auch eigenen Erfindungen können hier entwickelt werden. Die 3 Beschäftigung mit der Bionik erleichtert es den Lernenden Analogien zwischen biologischen und technischen Systemen zu schliessen. Diese hohen Ansprüche an das Unterrichtssetting könnte die Durchführbarkeit dieser Unterrichtseinheit beschränken. Möglich wäre aber auch eine Zusammenarbeit mit Stellen wie zum Beispiel dem BIONIK Zentrum Luzern oder Regine Schwilch von evosolutions in Luzern. 2. Definition Bionik Das Wort BIONIK entsteht aus einem Zusammenzug von BIOlogie und TechNIK. Es bedeutet „Lernen von der Natur (Cerman et al.; 2011). Bionik beschreibt ein Wissensgebiet an der Schnittstelle von Biologie und Technik. Funktionsprinzipien aus der Natur werden analysiert und gezielt in technischen Produkten oder Verfahrensweisen umgesetzt (Bionik Zentrum Luzern). Die Evolution liefert also gewissermassen die erprobte Vorlage für die Entwicklung praktischer Lösungen für alltägliche Probleme wie Reinigung, Logistik, Statik, Haftfähigkeit, Aerodynamik, Design und vieles mehr (evosolution, Luzern). Die Natur dient als Inspiration für die technische Problemlösung. 3. Anwendungen Das wohl bekannteste Beispiel einer bionischen Problemlösung stellen der allseits bekannte Klettverschluss (Abb.1) und der Lotus-Effekt dar. Das Kletten-Labkraut (Galium aparine) und die Mariendistel (Silybum marianum) lieferten hier die Vorlage für das Prinzip des Verhakens mittels Widerhaken. Die Lotusblume hingegen stand Pate für den Selbstreinigungseffekt von vielen Oberflächen (Cerman et al.; 2011). Daneben gibt es vielseitige Anwendungsbereiche der Bionik, die uns nicht sofort auffallen. Viele Architekten bedienen sich bei Ihren Entwürfen bei der Natur (Abb. 2 und 3). Schon Antonio Gaudi studierte Pflanzenstrukturen und übertrug diese auf seine Gebäude. Seine baumartig verzweigten Stützpfeiler in der Sagrada Familia (Kirche in Barcelona) sind weltberühmt. Auch Gebäude wie das Olympiastadion in Peking, Vogelnest genannt, ist durch Inspiration aus der Natur entstanden. Haihaut (Abb. 4) wird imitiert, damit Flugzeuge und Schiffe weniger Strömungswiederstand erfahren, die Haftstrukturen von Geckofüssen und Insektenbeinen (Abb. 5) werden in der Klebemittelindustrie als Vorlage verwendet (Forbes P.; 2006). Kletterroboter für die Kanalreinigung werden den flinken Ratten nachempfunden und sollen bald an Stellen Verstopfungen lösen, die bislang ausserhalb unserer Reichweite waren. Auch Solarzellen sollen durch Bionik effizienter gemacht werden. Dies mit Hilfe des Photosynthese-Mechanismus. 4 Abbildung Klettverschluss als Klassiker der Bionik Abbildung Brücke nach dem Vorbild eines Knochen Abbildung Algenskelett als Dachvorbild 5 Abbildung Haihaut-Struktur verbessert Strömung Abbildung Haftstrukturgrösse und Körpergewicht -- je kleiner desto klebriger 4. Experimente Mittels einfachen Experimenten erleben die Lernenden direkt, welche Lösungen die Natur entwickelt hat, um bestimmte Probleme zu lösen. Hier sind einige Anregungen gegeben, die den Zugang zur Bionik im Unterricht erleichtern können. 4.1. Versuche zum Thema Lotus-Effekt Die Lernenden erhalten den Auftrag rund um das Schulhaus nach Pflanzen zu suchen, welche verschiedene Blattoberflächenstrukturen aufweisen. Durch Aufsprühen von Wasser kann ein erster Eindruck gewonnen werden, wie die Oberfläche beschaffen ist. Die mitgebrachten Blätter werden im Schullabor systematisch darauf untersucht, wie schnell ihre Oberfläche von Asche und Lehm befreit werden kann. Dazu wird zum Beispiel Asche oder Lehmpulver auf die trockenen Blätter gebracht. Nun wird kontrolliert Wasser auf die Oberfläche geträufelt. Alle Beobachtungen werden schriftliche festgehalten. Die Lernenden sollen ihre Versuchsanordnung selber bestimmen und ihrer genauen Fragestellung anpassen. 6 4.2. Versuche mit Flugobjekten Die Lernenden stellen Untersuchungen an Objekten aus der Natur an, die durch den Wind befördert werden. Dazu bieten sich zum Beispiel die Samen des Löwenzahns oder Ahorns an (Lütting und Kasten; 2003). Die Lernenden führen einfache Experimente in einem improvisierten Windkanal durch. Sie stellen Hypothesen auf und stellen entsprechende Beobachtungen an. Denkbar ist auch ein Flugwettbewerb mit Flugobjekten, die anhand von natürlichen Vorbildern konstruiert wurden. Alternativ können auch Versuche mit Jungspinnen gemacht werden. Diese nützen den Wind als Fortbewegungsmittel indem sie einen Seidenfaden in den Wind spinnen (Dingle; 1980). 4.3. Versuche mit chemisch erzeugtem Licht Natürlich spielt auch die Chemie in der Bionik eine Rolle. Dies kann den Lernenden anhand einfacher chemischer Experimente mit Luciferin und Luciferase erläutert werden. Diese beiden Chemikalienverwenden zum Beispiel Glühwürmchen der Art Lampyris noctiluca benützt, um Licht zu erzeugen (Wöhrle et al. 1998). 5. Unterrichtsgestaltung Neben den oben erwähnten Experimenten müssen sich die Lernenden in die Anwendungen der Bionik einarbeiten können. Es gibt interessante Dokumentationen zum Thema Bionik, welche auch schon didaktisch aufbereitet wurden (srf, myschool; Das Genie der Natur). Darin wird die Vielfalt des Themas veranschaulicht und die Lernenden erfahren viel über das Potential der Bionik. Die so erarbeiteten Grundlagen zusammen mit den Erfahrungen aus den Experimenten können genutzt werden, um nun einen Blick in die aktuelle Forschung zu werfen. Dazu kann die Klasse in Gruppen eingeteilt werden, die sich dann auf ein Thema der Bionik konzentriert. Dabei werden die Recherchekompetenzen und auch die Kommunikationsfähigkeiten gefördert. Die Resultate werden in Rahmen einer Präsentation (Vortrag, Poster, Demonstration) der Klasse zugänglich gemacht. Die Interdisziplinarität des Themas erfordert die Beteiligung von Lehrpersonen aus den Gebieten Biologie, Physik, Chemie und Mathematik. Somit kann auch eine enge Begleitung der einzelnen Gruppen gewährleistet werden. Ist die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit Experten gegeben, können die Projekte entsprechend ausgeweitet werden. Die Lernenden sollen ihre Kreativität entfalten und ihre Erfindungen wenn möglich auch technisch umsetzen können. 6. Fazit Das Thema Bionik ist aktuell sehr präsent. Nicht nur die Wissenschaftlichen Publikationen thematisieren die technischen Lösungen, die uns die Natur bietet. Immer häufiger findet man auch in der Tagespresse oder den Wissensmagazinen interessante Artikel zum Thema. Die Bionik ist uns oft näher als wir vermuten. Der Bau einer Brücke, die Beschichtung einer Kloschüssel oder unsere Bekleidung sind Produkte der Bionikforschung. Daher hat das Thema eine hohe Alltagsrelevanz und es bietet sich an, im Rahmen der naturwissenschaftlichen Bildung darauf einzugehen. Die Lernenden erfahren die Verschmelzung der verschiedenen Disziplinen an konkreten Phänomenen, die von der Natur in die Technik übertragen wurden. Sie lernen, dass die Evolution geniale Lösungen hervorgebracht hat, die wir Menschen für unser tägliches Leben verwenden. Das Thema hat das Potential, die Kreativität und den Erfindergeist zu wecken. Nebenbei wird das technische Verständnis gefördert und potentielle Barrieren in Bereich Naturwissenschaften und Technik abgebaut. Wird diese Unterrichtseinheit von externen Experten begleitet, haben die Lernenden zusätzlich die Gelegenheit, einen Einblick in die Berufswelt der/des Ingenieurin/Ingenieurs zu erhalten. Diese 7 Komponente ist keinesfalls zu unterschätzen und folgt den Forderungen von Wirtschaft und Politik, dem Fachkräftemangel auf diesem Gebiet entgegenzuwirken. Das hier angedachte Unterrichtssetting präsentiert sich noch sehr rudimentär. Die Entwicklung geeigneter Unterrichtsmaterialien ist zeitintensiv und erfordert fundierte Recherchen zum Thema und die Zusammenarbeit mit entsprechenden Experten. Die Aufgabe dieser Arbeit war es, Themen zu bearbeiten, die nicht explizit im Lehrplan aufgeführt sind. Die Relevanz des Themas scheint mir unbestritten, jedoch bezweifle ich, Angesichts der verschiedenen Sparmassnahmen (siehe Kanton Bern und Luzern), dass Mittel und Raum für dieses Setting bereitgestellt werden können. Das Thema müsste also in bestehende Unterrichtsgefässe integriert werden. Passend wären naturwissenschaftliche Sonderwochen, wie sie im Gymnasium Kirchenfeld durchgeführt werden. Auch die Robotik-Woche am Gymnasium Alpenquai in Luzern würde sich ausgezeichnet dafür eignen. 8 7. Referenzen und Quellen 7.1. Publikationen Cerman Z., Barthlott W., Nieder J.: 2011; Erfindungen der Natur. Bionik – Was wir von Pflanzen und Tieren lernen können. 3. Auflage. Rowohlt Taschenbuch Dingle, H. 1980: Ecology and evolution of migration. In Animal Migration, Orientation, and Navagation. (S. A. Gautreaux, Jr., ed.). Academic Press, New York, pp. 1-101 Forbes P.; 2006: The Geckos Foot: Bio-inspiration: Engineering New Materials from Nature. W. W. Norton Lüttig A. Kasten J.; 2003: Hagebutte Co Blüten, Früchte und Ausbreitung europäischer Pflanzen. Fauna Verlag, Nottuln Wöhrle D., Tausch M. W., Stohrer W. D.; 1998: Photochemie, Wiley-VCh, 7.2. Internetquellen 7.3. Bildnachweis Titelbild: K. Leitl 9