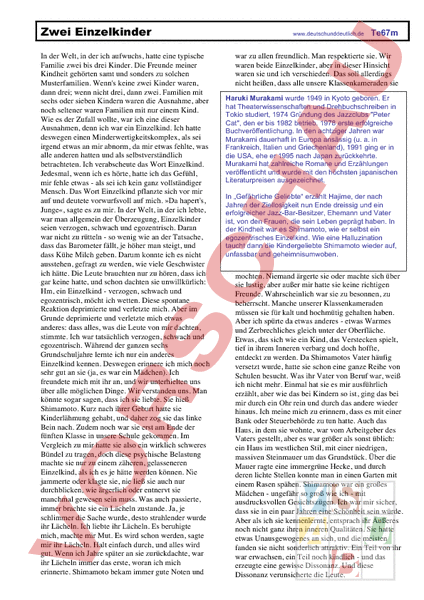Arbeitsblatt: Zwei Einzelkinder
Material-Details
Leseverstehen (Text und Fragen)
Deutsch
Textverständnis
6. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
128752
976
13
28.02.2014
Autor/in
BenutzerInnen-Konto gelöscht (Spitzname)
Land:
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Zwei Einzelkinder In der Welt, in der ich aufwuchs, hatte eine typische Familie zwei bis drei Kinder. Die Freunde meiner Kindheit gehörten samt und sonders zu solchen Musterfamilien. Wenn keine zwei Kinder waren, dann drei; wenn nicht drei, dann zwei. Familien mit sechs oder sieben Kindern waren die Ausnahme, aber noch seltener waren Familien mit nur einem Kind. Wie es der Zufall wollte, war ich eine dieser Ausnahmen, denn ich war ein Einzelkind. Ich hatte deswegen einen Minderwertigkeitskomplex, als sei irgend etwas an mir abnorm, da mir etwas fehlte, was alle anderen hatten und als selbstverständlich betrachteten. Ich verabscheute das Wort Einzelkind. Jedesmal, wenn ich es hörte, hatte ich das Gefühl, mir fehle etwas als sei ich kein ganz vollständiger Mensch. Das Wort Einzelkind pflanzte sich vor mir auf und deutete vorwurfsvoll auf mich. »Da hapert, Junge«, sagte es zu mir. In der Welt, in der ich lebte, war man allgemein der Überzeugung, Einzelkinder seien verzogen, schwach und egozentrisch. Daran war nicht zu rütteln so wenig wie an der Tatsache, dass das Barometer fällt, je höher man steigt, und dass Kühe Milch geben. Darum konnte ich es nicht ausstehen, gefragt zu werden, wie viele Geschwister ich hätte. Die Leute brauchten nur zu hören, dass ich gar keine hatte, und schon dachten sie unwillkürlich: Hm, ein Einzelkind verzogen, schwach und egozentrisch, möcht ich wetten. Diese spontane Reaktion deprimierte und verletzte mich. Aber im Grunde deprimierte und verletzte mich etwas anderes: dass alles, was die Leute von mir dachten, stimmte. Ich war tatsächlich verzogen, schwach und egozentrisch. Während der ganzen sechs Grundschuljahre lernte ich nur ein anderes Einzelkind kennen. Deswegen erinnere ich mich noch sehr gut an sie (ja, es war ein Mädchen). Ich freundete mich mit ihr an, und wir unterhielten uns über alle möglichen Dinge. Wir verstanden uns. Man könnte sogar sagen, dass ich sie liebte. Sie hieß Shimamoto. Kurz nach ihrer Geburt hatte sie Kinderlähmung gehabt, und daher zog sie das linke Bein nach. Zudem noch war sie erst am Ende der fünften Klasse in unsere Schule gekommen. Im Vergleich zu mir hatte sie also ein wirklich schweres Bündel zu tragen, doch diese psychische Belastung machte sie nur zu einem zäheren, gelasseneren Einzelkind, als ich es je hätte werden können. Nie jammerte oder klagte sie, nie ließ sie auch nur durchblicken, wie ärgerlich oder entnervt sie manchmal gewesen sein muss. Was auch passierte, immer brachte sie ein Lächeln zustande. Ja, je schlimmer die Sache wurde, desto strahlender wurde ihr Lächeln. Ich liebte ihr Lächeln. Es beruhigte mich, machte mir Mut. Es wird schon werden, sagte mir ihr Lächeln. Halt einfach durch, und alles wird gut. Wenn ich Jahre später an sie zurückdachte, war ihr Lächeln immer das erste, woran ich mich erinnerte. Shimamoto bekam immer gute Noten und www.deutschunddeutlich.de Te67m war zu allen freundlich. Man respektierte sie. Wir waren beide Einzelkinder, aber in dieser Hinsicht waren sie und ich verschieden. Das soll allerdings nicht heißen, dass alle unsere Klassenkameraden sie Haruki Murakami wurde 1949 in Kyoto geboren. Er hat Theaterwissenschaften und Drehbuchschreiben in Tokio studiert, 1974 Gründung des Jazzclubs Peter Cat, den er bis 1982 betrieb. 1978 erste erfolgreiche Buchveröffentlichung. In den achtziger Jahren war Murakami dauerhaft in Europa ansässig (u. a. in Frankreich, Italien und Griechenland), 1991 ging er in die USA, ehe er 1995 nach Japan zurückkehrte. Murakami hat zahlreiche Romane und Erzählungen veröffentlicht und wurde mit den höchsten japanischen Literaturpreisen ausgezeichnet. In „Gefährliche Geliebte erzählt Hajime, der nach Jahren der Ziellosigkeit nun Ende dreissig und ein erfolgreicher Jazz-Bar-Besitzer, Ehemann und Vater ist, von den Frauen, die sein Leben geprägt haben. In der Kindheit war es Shimamoto, wie er selbst ein egozentrisches Einzelkind. Wie eine Halluzination taucht dann die Kindergeliebte Shimamoto wieder auf, unfassbar und geheimnisumwoben. mochten. Niemand ärgerte sie oder machte sich über sie lustig, aber außer mir hatte sie keine richtigen Freunde. Wahrscheinlich war sie zu besonnen, zu beherrscht. Manche unserer Klassenkameraden müssen sie für kalt und hochmütig gehalten haben. Aber ich spürte da etwas anderes etwas Warmes und Zerbrechliches gleich unter der Oberfläche. Etwas, das sich wie ein Kind, das Verstecken spielt, tief in ihrem Inneren verbarg und doch hoffte, entdeckt zu werden. Da Shimamotos Vater häufig versetzt wurde, hatte sie schon eine ganze Reihe von Schulen besucht. Was ihr Vater von Beruf war, weiß ich nicht mehr. Einmal hat sie es mir ausführlich erzählt, aber wie das bei Kindern so ist, ging das bei mir durch ein Ohr rein und durch das andere wieder hinaus. Ich meine mich zu erinnern, dass es mit einer Bank oder Steuerbehörde zu tun hatte. Auch das Haus, in dem sie wohnte, war vom Arbeitgeber des Vaters gestellt, aber es war größer als sonst üblich: ein Haus im westlichen Stil, mit einer niedrigen, massiven Steinmauer um das Grundstück. Über die Mauer ragte eine immergrüne Hecke, und durch deren lichte Stellen konnte man in einen Garten mit einem Rasen spähen. Shimamoto war ein großes Mädchen ungefähr so groß wie ich mit ausdrucksvollen Gesichtszügen. Ich war mir sicher, dass sie in ein paar Jahren eine Schönheit sein würde. Aber als ich sie kennenlernte, entsprach ihr Äußeres noch nicht ganz ihren inneren Qualitäten. Sie hatte etwas Unausgewogenes an sich, und die meisten fanden sie nicht sonderlich attraktiv. Ein Teil von ihr war erwachsen, ein Teil noch kindlich und das erzeugte eine gewisse Dissonanz. Und diese Dissonanz verunsicherte die Leute. Wahrscheinlich weil wir so nah beieinander wohnten buchstäblich einen Steinwurf voneinander entfernt wurde sie, als sie an unsere Schule kam, neben mich gesetzt. Ich erklärte ihr, was für Bücher sie brauchen würde, wie die wöchentlichen Klassenarbeiten abliefen, wie viel wir in den einzelnen Fächern schon durchgenommen hatten, wie der Putzdienst und die Arbeit in der Essensausgabe geregelt waren. In unserer Schule hielt man es so, dass das Kind, das einem Neuzugang am nächsten wohnte, sich in der Anfangszeit um diesen zu kümmern hatte; mein Lehrer nahm mich beiseite und teilte mir mit, er erwarte, dass ich mich der gehbehinderten Shimamoto ganz besonders annehmen würde. Wie bei allen Elf- oder Zwölf jährigen, die zum erstenmal mit einer Person des anderen Geschlechts reden, waren unsere Gespräche während der ersten paar Tage recht verkrampft. Als wir aber herausfanden, dass wir beide Einzelkinder waren, wurden wir lockerer. Beide lernten wir zum erstenmal ein anderes Einzelkind kennen, und es gab soviel über unser jeweiliges Einzelkinddasein zu erzählen, was wir bis dahin für uns behalten hatten. Oft gingen wir von der Schule zusammen nach Hause. Langsam, wegen ihres Beins, gingen wir den einen Kilometer und unterhielten uns dabei über vielerlei. Je mehr wir redeten, desto mehr Gemeinsamkeiten entdeckten wir: unsere Liebe zu Büchern und Musik; von Katzen ganz zu schweigen. Es fiel uns beiden schwer, anderen unsere Gefühle begreiflich zu machen. Beide hatten wir eine lange Liste von Gerichten, die uns nicht schmeckten. Bei den Schulfächern kannten wir nur zwei Kategorien: solche, die uns Spaß machten, auf die wir uns mühelos konzentrieren konnten und solche, die wir auf den Tod nicht ausstehen konnten. Ein wichtiger Unterschied bestand allerdings zwischen uns: in weit stärkerem Maße als ich umgab sich Shimamoto bewusst mit einem schützenden Panzer. Im Gegensatz zu mir strengte sie sich in den Fächern, die sie hasste, besonders an und bekam darin gute Noten. Wenn es in der Schule mittags etwas gab, das sie nicht ausstehen konnte, aß sie es trotzdem. Mit anderen Worten: Sie errichtete eine weit höhere Schutzmauer um sich, als es mir je gelungen war. Was jedoch hinter dieser Mauer lag, unterschied sich kaum von dem, was hinter meiner lag. Bei Shimamoto konnte ich mich entspannen; in Gesellschaft anderer Mädchen nicht. Es gefiel mir sehr, zusammen mit ihr nach Hause zu gehen. Beim Gehen hinkte sie leicht. Manchmal hielten wir auf halbem Weg bei einer Parkbank an, aber das störte mich nicht. Im Gegenteil, ich war dankbar für die zusätzliche gemeinsame Zeit. Bald sah man uns immer häufiger zusammen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass sich jemand deswegen über uns lustig gemacht hätte. Damals fiel mir das nicht weiter auf, aber jetzt finde ich es schon merkwürdig. Schließlich neigen Kinder in diesem Alter dazu, über solche angehenden Pärchen zu spotten und zu witzeln. Es könnte an Shimamotos Art gelegen haben; etwas an ihr schüchterte andere ein, ließ sie denken: Mann vor dem Mädchen sagst du besser keine Dummheiten! Selbst unsere Lehrer wirkten im Umgang mit ihr leicht nervös; es mag auch an ihrem gelähmten Bein gelegen haben. Jedenfalls fanden die meisten, Shimamoto sei nicht von der Sorte, die man hänselt, und mir konnte das nur recht sein. Während des Sportunterrichts saß sie am Rand, und wenn unsere Klasse eine Wanderung oder eine Bergtour unternahm, blieb sie zu Hause. Genauso, wenn wir im Sommer ins Schwimmlager fuhren. Bei unserem jährlichen Sportfest wirkte sie zwar nicht besonders glücklich, aber sonst führte sie in der Schule ein ganz normales Leben. Von ihrem Bein sprach sie fast nie. Ja, wenn ich mich recht erinnere, überhaupt nie. Niemals entschuldigte sie sich auf dem Nachhauseweg dafür, dass ich ihretwegen langsamer gehen musste, oder ließ auch nur zu, dass dieser Gedanke sich in ihrem Gesicht abzeichnete. Ich wusste jedoch, dass sie ihr gelähmtes Bein nie erwähnte, gerade weil es ihr sehr zu schaffen machte. Sie ging nicht gern zu anderen nach Hause, weil sie dann gezwungen gewesen wäre, wie in Japan üblich, ihre Schuhe in der Diele auszuziehen. Sie hatte unterschiedlich hohe Absätze, und auch die zwei Schuhe waren unterschiedlich geformt was sie unter allen Umständen zu verbergen versuchte. Es waren bestimmt Maßanfertigungen. Wenn wir bei ihr zu Hause ankamen, warf sie als erstes ihre Schuhe so schnell wie möglich in den Schrank. Im Wohnzimmer von Shimamotos Haus stand eine brandneue Stereoanlage, und ich kam oft zu ihr, um Musik zu hören. Die Anlage war wirklich gut, die dazugehörige Plattensammlung nahm sich dagegen eher bescheiden aus. Shimamotos Vater besaß, wenn hoch kam, fünfzehn LPs, hauptsächlich mit leichterer klassischer Musik. Wir müssen uns diese fünfzehn Platten tausendmal angehört haben, und noch heute kann ich mich an alle Stücke erinnern Note für Note. Für die Schallplatten war Shimamoto verantwortlich. Sie nahm eine aus der Hülle, legte sie behutsam auf den Plattenteller, ohne die Rillen mit den Fingern zu berühren, und nachdem sie die Nadel mit einer winzigen Bürste von jeglichem Staub befreit hatte, setzte sie mit allergrößter Vorsicht den Tonarm auf. Wenn die Platte zu Ende war, besprühte sie sie mit einem Spray, wischte sie mit einem Reinigungstuch ab, steckte sie in ihre Hülle zurück und stellte sie an ihren Platz im Regal. Ihr Vater hatte ihr dieses Vorgehen beigebracht, und sie befolgte seine Anweisungen mit beängstigend ernstem Gesicht, leicht zusammengekniffenen Augen und fast, ohne zu atmen. Währenddessen saß ich auf dem Sofa und beobachtete jede ihrer Bewegungen. Erst wenn die Schallplatte wieder sicher im Regal stand, wandte sie sich mir zu und schenkte mir ein kleines Lächeln.