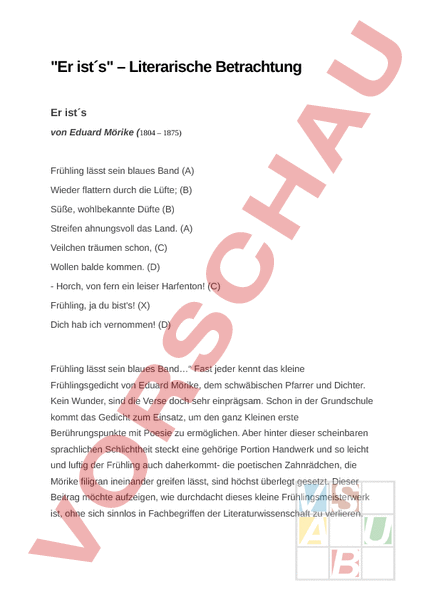Arbeitsblatt: Gedichtbetrachtung
Material-Details
Tipps auf 4 Seiten, zusätzliche Idee: Rap daraus machen mithilfe der CD "Junge Dichter und Denker.
Deutsch
Leseförderung / Literatur
6. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
129485
544
2
26.03.2014
Autor/in
Rolf Steinmann
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Er ists – Literarische Betrachtung Er ists von Eduard Mörike (1804 – 1875) Frühling lässt sein blaues Band (A) Wieder flattern durch die Lüfte; (B) Süße, wohlbekannte Düfte (B) Streifen ahnungsvoll das Land. (A) Veilchen träumen schon, (C) Wollen balde kommen. (D) Horch, von fern ein leiser Harfenton! (C) Frühling, ja du bist! (X) Dich hab ich vernommen! (D) Frühling lässt sein blaues Band Fast jeder kennt das kleine Frühlingsgedicht von Eduard Mörike, dem schwäbischen Pfarrer und Dichter. Kein Wunder, sind die Verse doch sehr einprägsam. Schon in der Grundschule kommt das Gedicht zum Einsatz, um den ganz Kleinen erste Berührungspunkte mit Poesie zu ermöglichen. Aber hinter dieser scheinbaren sprachlichen Schlichtheit steckt eine gehörige Portion Handwerk und so leicht und luftig der Frühling auch daherkommt- die poetischen Zahnrädchen, die Mörike filigran ineinander greifen lässt, sind höchst überlegt gesetzt. Dieser Beitrag möchte aufzeigen, wie durchdacht dieses kleine Frühlingsmeisterwerk ist, ohne sich sinnlos in Fachbegriffen der Literaturwissenschaft zu verlieren. Das formale Grundgerüst 9 kleine Verse voller Kunst, zentriert in einer Strophe! Wer den Text laut liest, dem wird gleich der Rhythmus auffallen, der den Worten innewohnt. Um genau zu sein, wird jeweils die erste Silbe betont, daraufhin folgt eine unbetonte Silbe. Ein Schema, das sich durch das ganze Gedicht zieht. Das kann kein Zufall sein und in der Tat kennt die Literaturwissenschaft für dieses Versmaß (betont-unbetont) einen Begriff. Man nennt dieses Versmaß „Trochäus. Die Anzahl der betonten Silben innerhalb eines jeden Verses nennt man Hebungen. Wer die einzelnen Hebungen durchzählt wird feststellen, dass sie keine Regelmäßigkeiten aufweisen. Hier steckt ein erstes kleines sprachliches Geheimnis. Obwohl das Metrum durchweg eingehalten und immer im Trochäus gehalten ist, schafft die variierende Anzahl von Hebungen eine gewisse Leichtigkeit, die jedoch nicht in Willkür ausartet, weil das Metrum vorgegeben ist. Auf der einen Seite haben wir also die strenge Form. Auf der anderen Seite jedoch einen lebhaften Wechsel von Hebungen, der schon auf formaler Ebene für die nötige Leichtigkeit sorgt, die man braucht, um das Frühlingserwachen glaubhaft zu vermitteln. Schaut man sich die Reime an, so fällt etwas Ähnliches auf. Zwar sind die Reime vorhanden und sorgen für Struktur, aber ein durchgehendes Schema fehlt. Würde man gleiche Reime mit dem gleichen Buchstaben versehen und diese dann Vers für Vers anordnen, entstände folgendes Reimschema: ABBACDCXD. Sie finden die Buchstaben zur Veranschaulichung auch oben neben den Versen. Was soll das X? Es fällt auf, dass sich alle Verse bis auf den Vorletzten reimen. Ihm fehlt ein Reimpartner. Die Literaturwissenschaft nennt solche Ausreißer „Waisen und wir können davon ausgehen, dass unser kleiner Waisenknabe bewusst gewählt wurde, weil hier ein formaler Aspekt den Inhalt betonen soll. Dieser Vers sagt uns quasi, ohne es auszusprechen: „Ich passe nicht ins Schema. Leser, pass auf! Hier ist eine wichtige Stelle Auch hier können wir also wieder feststellen: Es gibt sehr wohl eine Reimstruktur, aber sie ist nicht übertrieben starr, sondern lässt einen Spielraum, der für Lebhaftigkeit beim Lesen sorgt. Der Inhalt Fangen wir beim Titel an. Er ist bewusst so gewählt, dass er Neugierde weckt. Er ists! Ja wer ist es denn, von dem da die Rede ist? Man liest also weiter und erfährt: Aha, der Frühling. Schnell wird aber klar, dass der Frühling hier nicht nur eine Ansammlung biologischer Prozesse ist. Kein Photosynthesefeuerwerk von Herbstzeitlosen und Maiglöckchen. Nein, vielmehr wird der Frühling hier mit menschlichen Eigenschaften versehen. Er hat ein blaues Band, das er durch die Lüfte flattern lässt und wird im vorletzten Vers sogar geduzt. Abstrakten Dingen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben ist ein sehr wirksamer Trick, um etwas anschaulich darzustellen. Was vorher noch gestaltlos in unseren Köpfen schwirrte, konkretisiert und manifestiert sich jetzt in Gestalt einer Person. Wir können uns den Frühling jetzt also besser vorstellen. Das schafft Nähe zum Sprachbild und sichert zudem, dass der Leser nicht aussteigt, weil ihm das Gedicht zu abstrakt gehalten ist. Die Literaturwissenschaft kennt diesen Vorgang der Vermenschlichung auch als Personifizierung. Was in den ersten Zeilen im großen Stil geschieht, finden sein Pendant im Kleinen wieder, denn auch die Veilchen werden personifiziert. Im Text können sie nämlich träumen, irgendwo tief unter der Erde und voller Sehnsucht auf den Moment wartend, an dem sie sich in Richtung Erdoberfläche aufmachen. Man kann das auch als eine Art Kamerazoom verstehen, der vom großen Frühlingsbild immer kleiner wird, auf die Veilchen Schwenkt und dann mit dem Harfenton die große Erkenntnis einläutet: Jawohl! Das ist der Frühling! Wir haben dich vernommen! Das Band, das der Frühling wehen lässt, ist blau und somit eine Spiegelung des Himmels. Diese Farbwahl schafft Assoziationen im Kopf des Lesers. In unserem inneren Auge öffnet sich die Weite des Himmels. Grandios! Lesen mit allen Sinnen Wer sich beim Lesen in das sprachliche Bild hineindenkt, der wird vielleicht die wehenden Lüfte auf seiner Haut spüren, die süßen, wohlbekannten Blütendüfte riechen, die die Frühjahrsblumen mit sich bringen, den Harfenton vernehmen und das blaue Band bewundern, das vor dem inneren Auge vorüberzieht. Es werden also fast alle Sinne in neun kleinen Versen angesprochen. Wenn etwas auf so kleinem sprachlichen Raum passiert, kann das kein Zufall sein. Es ist vielmehr der bewusste Versuch, den Leser in das Frühlingsbild noch stärker hineinzuziehen und es anschaulich zu machen. Auch hier kennt die Literaturwissenschaft wieder ein passendes Wort. Nämlich die „Synästhesie, die immer dann auftritt, wenn mehrere Sinne gleichzeitig und kombiniert angesprochen werden. Horch! In Vers 7 ändert sich die „Kameraeinstellung wieder und schwenkt direkt zum Leser. „Horch! Heißt es da und der Appell ist unmissverständlich. „Lausche dem Harfenton, lieber Leser! Es folgt die Hauptaussage des Gedichts: „Frühling, ja du bists! Und voller Freude können wir sagen: „Ja, wir haben den Frühling vernommen! Erinnern wir uns noch einmal ein wenig zurück, fällt auf, dass genau diese Stelle der Erkenntnis die Waise ist, die ganz ohne Reimpartner für sich und in vollem Glanz steht und wirkt. Was für eine Kunstfertigkeit! Und das alles in gerade mal 9 kleinen Zeilen. Manch ein Film schafft in zwei Stunden weniger!