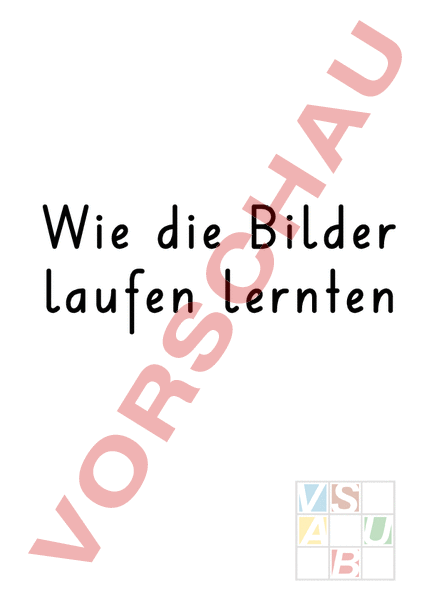Arbeitsblatt: Wie die Bilder laufen lernten
Material-Details
Arbeitsmappe zur Entstehung des Films
Geschichte
Anderes Thema
5. Schuljahr
30 Seiten
Statistik
130372
931
7
14.08.2014
Autor/in
Tamara Grob
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Wie die Bilder laufen lernten M&U „Wie die Bilder laufen lernten 2 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Das Kino mit der Magischen Laterne Bevor die Bilder laufen lernten, lernten sie erst einmal flackern. Schon Mitte des 17. Jahrhunderts brachte die Laterna Magica (Zauberlaterne) die Menschen zum Staunen: Einer der Vorfahren des modernen Projektors war die Laterna magica, mit der unter anderem auf Rummelplätzen kleine Geschichten vorgeführt wurden. Die Laterna magica funktioniert ähnlich wie ein moderner Diaprojektor, allerdings ohne Strom. Der Vorführer warf Bilder, die auf Glas gemalt waren, mit Hilfe einer Kerze als Beleuchtungsquelle auf die Leinwand. Dazu bewegte er vor der Kerze zwei Glasbilder gleichzeitig. Das Bild veränderte sich wie durch Zauberei und dazu erzählte der Vorführer eine Geschichte. Auch damals war Gruseln sehr beliebt und viele dieser kleinen Bildgeschichten handelten von Geistern und Teufeln. bpk, Berlin Der Jesuit Athanasius Kircher wollte mit der Hilfe der Zauberlaterne Werbung für den Glauben machen und Menschen religiös erziehen. Doch statt in der Kirche trat die Laterna Magica ihren Siegeszug auf Jahrmärkten und später in bürgerlichen Haushalten an. Die Kirche dagegen verurteilte den Apparat bald als Teufelswerk. Erkläre die Funktion der Laterna Magica in wenigen Stichworten: 3 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Bildverarbeitung im Gehirn Deine Augen sind ständig in Bewegung und nehmen andauernd neue Bilder auf. Jedes davon bleibt nur für den Bruchteil einer Sekunde auf der Netzhaut, dann wird es durch das nächste Bild ersetzt. Im Gehirn werden alle Bilder verarbeitet und die wichtigsten in deinem Gedächtnis gespeichert. Das Sehen bewegter Bilder kommt von zwei Besonderheiten: 1. Das Nachbild Wird ein Bild dem Auge mit kurzen Unterbrechungen gezeigt, so sehen wir diese Unterbrechungen nicht. Walbild Rollbild Wunderscheibe durch drehendes Rad sehen: Speichen sieht man nicht) 2. Der stroboskopische Effekt Werden dem Auge schnell hintereinander Phasenbilder (gezeichnet oder fotografiert) eines Bewegungsablaufes (zum Beispiel ein Vogel der fliegt) gezeigt, dann sind nicht die Einzelbilder, sondern ein Dauerbild zu sehen. Lebensrad Vom Einzelbild zur Bewegung Dass du keine Einzelbilder im Film siehst, sondern Bewegung, hat damit zu tun, wie das Auge funktioniert und wie dein Gehirn die Bilder verarbeitet. Einer, der das entdeckt hat, war der englische Arzt Peter Marc Roget. Er sah eines Tages zufällig durch einen dunklen Zaun auf einen sonnigen Weg. Auf dem Weg fuhr gerade eine Kutsche vorüber. Die Bewegung ihrer Räder wirkte beim Blick durch die Lücke im Zaun merkwürdig verzerrt und abgehackt. Das gab Roget zu denken. Mit Hilfe einer Reihe von Experimenten rechnete er schliesslich aus, dass es von der Geschwindigkeit abhängt, ob du Bewegung siehst oder einzelne Bilder. Ab etwa zwölf einzelnen Bildern in einer Sekunde hast du den Eindruck, dass sich etwas bewegt. Sind es weniger als zwölf Bilder, siehst du sie einzeln – wie Fotografien. Daumenkino Du kannst das prima mit dem Daumenkino ausprobieren. Blätterst du die Seiten langsam um, dann siehst du jede Zeichnung einzeln. Blätterst du sie aber mit dem Daumen ganz schnell durch, denkst du, dass sich das Bild bewegt. Das ist der Daumenkino-Effekt. Daumenkino 4 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Wundertrommeln und Zauberscheiben Nach den Berechnungen von Peter Roget entwickelten Techniker und Tüftler neue Spielzeuge und aufregende Jahrmarktattraktionen. Die Leute kannten noch keine bewegten Bilder und staunten, wie das möglich ist. Sie kauften sich optische Zauberscheiben (sie werden auch Lebensrad genannt) für die Familie oder sahen sich Wundertrommeln und andere Geräte auf dem Jahrmarkt an. Sie funktionierten alle nach dem gleichen Prinzip: Mit Hilfe von Kurbeln, Spiegeln und Sehschlitzen wurden einzelne Bilder vor den Augen bewegt. Wundertrommel Lebensrad Die Wundertrommel Public Domain Die Zauberscheibe das Lebensrad Auf einer Scheibe sind kreisförmig Bilder angeordnet, die jeweils unterschiedliche Phasen einer Bewegung zeigen. Zwischen den Bildern befinden sich Sehschlitze. Betrachtet man das sich drehende Rad durch diese Schlitze in einem Spiegel, entsteht der Eindruck von Bewegung. Auf einer Zauberscheibe sind die Bilder in einem Kreis angeordnet. Jedes Bild sieht dabei etwas anders als das folgende aus. Zwischen den Bildern befinden sich Schlitze, durch die man gucken kann. Mit einem Lebensrad stellt man sich vor den Spiegel, dreht die Scheibe und sieht durch die Schlitze. Im Spiegel sieht man dann den Bewegungsablauf. 5 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Wie die Bilder laufen lernten Der Fotograf Edward Muybridge bekam 1872 den Auftrag, mit Hilfe von Fotos zu zeigen, wie ein Pferd galoppiert. Es galt zu beweisen, dass ein Pferd beim Galopp mit allen vier Beinen vom Boden abhebt. Muybridge baute eine komplizierte Anlage mit erst zwölf, dann 24 und schliesslich 36 Fotoapparaten, die er der Reihe nach auf die Erde stellte. Den Auslöser jeder Kamera verband er mit einer Schnur. Muybridge liess ein Pferd über die Schnüre galoppieren und dabei löste das Pferd mit seinen Hufen bei jeder Schnur ein Foto aus. Das Pferd machte dabei in kürzester Zeit 12, 24, 36 Fotos von sich selbst. Ein paar davon siehst du hier: Muybridges Serienfotografie Public Domain Edward Muybridge war damit der Erfinder der Serienfotografie und ein wichtiger Wegbereiter für Filme. 6 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Anfänge des Films Um „lebende Bilder auf die Kino-Leinwand zu bringen, mussten technische Apparate erfunden werden, für die Aufnahme von Bewegungen – die Kamera, für die Wiedergabe von Bewegungen – der Projektor. Die Idee, eine Anzahl Fotos nacheinander aufzunehmen, machte viele Erfinder neugierig und bis zur Erfindung des Films dauerte es jetzt nicht mehr lange. Sie tüftelten Apparate aus, mit denen Fotos auf eine Art Filmband aufgenommen werden konnten. Gleichzeitig überlegten sie, wie sich diese Bilder später projizieren liessen. Fotografen und Erfinder in aller Welt arbeiteten an Kameras und Projektoren. Zu ihnen gehörten auch zwei Fotografen, die als die Brüder Lumière berühmt wurden. Auguste Marie Louis Nicolas Lumière und sein Bruder Louis Jean entwickelten eine Filmkamera und einen Projektor und führten am 28. Dezember 1885 in Frankreich zum ersten Mal öffentlich Filme auf. Dieser Tag gilt als die Geburtsstunde des Kinos. Die Zuschauer hatten so etwas noch nie gesehen und waren total verblüfft. Heute kommen dir die frühen Filme sicherlich ziemlich komisch vor. Aber damals strömten die Leute in Scharen in die neu eröffneten Kinematographentheater, um die Kunst der bewegten Fotografie (so hiess das damals) anzusehen. Einer der berühmtesten Filme der Lumières heisst Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciolat (1895) und zeigt einen Zug, der in einen Bahnhof einfährt. Der Zug fährt genau auf den Zuschauer zu, denn direkt am Rand des Bahnsteigs stand die Kamera. Als dieser Film zum ersten Mal gezeigt wurde, rannten Leute angeblich aus dem Kino, weil sie befürchteten, gleich überrollt zu werden. Public Domain Der Apparat, den die Brüder Lumière benutzten, wurde von ihnen Cinématographe genannt. Deshalb hiessen die Theater, in denen die Filme gezeigt wurden, Kinematographentheater. Aus diesem Wort entstand der Begriff Kino. Public Domain 7 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Vom bewegten Foto zur Geschichte Zu Beginn reichte die Wiedergabe kurzer, alltäglicher Ereignisse auch aus, um die Leute für das neue Medium Film zu begeistern. Auf den Inhalt der Filme kam es dabei gar nicht so sehr an. Neben Alltagsszenen standen vor allem gesellschaftliche Ereignisse wie Paraden, Ausstellungen oder Begräbnisse und gefilmte Varieténummern mit Akrobaten, Tänzern oder Tieren auf dem Programm. Die kurzen Filme der Anfangszeit bestanden fast immer aus nur einer Einstellung, die Kamera war unbeweglich und die Perspektive war die eines Theaterzuschauers. Doch schon bald wurde im Film die Möglichkeit gefunden, eine Geschichte zu erzählen. Ungefähr ab 1903 wurden die Filme länger, verwendeten mehrere Einstellungen und erzählten vor allem erfundene Themen, statt reale Ereignisse abzubilden. Ein Landsmann der Lumières, Georges Méliès, hatte zudem eine weitere Möglichkeit des Films erkannt: die Veränderung der Realität, die Magie. Der Zauberer und Theaterbesitzer experimentierte mit Stopptrick, Mehrfachbelichtungen und Überblendungen und gilt heute als Erfinder der Filmtricks. Andere Filmemacher testeten, welche Mittel dem Geschichtenerzählen dienten. Sie spielten mit Schnitten und dem Wechsel von Einstellungsgrössen, um etwa zeitliche oder räumliche Bezüge klarer zu machen. So entstanden nach und nach filmische Abmachungen, die sich zu einem grossen Teil bis heute in fast jedem Film finden. Vom Stummfilm zum sprechenden Bild Theater wurden zu den ersten Kinos, in denen diese ersten Filme gezeigt wurden. Sie gewannen schnell an Popularität und der Zustrom war gross. Ganze Orchester begleiteten die Filme, ein Erzähler belebte die Geschichte und ein begeistertes Publikum lauschte. Charlie Chaplin war einer der ganz grossen Pioniere des Films und wirkte in zahlreichen Stummfilmen mit. Sein kreatives Genie und sein schauspielerisches Talent gab ihm die erste Star-Aura. Er blieb dem Stummfilm treu, denn er glaubte, die Sprache lenke nur von den schaupielerischen Fähigkeiten ab. Public Domain Erst um 1920 kam der erste Synchron-Ton zu den Bildern und man gelang vom Stummfilm zum prechenden Bild. 8 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Entwicklung des Films im letzten Jahrhundert Seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat die Filmindustrie enorm an Beliebtheit gewonnen und ist heute eines der wichtigsten Kulturelemente eines Landes. Die Genres wechselten in den Jahren, während des Krieges sollten sie ablenken, fröhlich stimmen, aber auch oftmals informieren. In den 60/70 Jahren entwickelte sich eine neue Welle, viele Probleme wurden in Filmen aufgearbeitet. In den 90er Jahren kamen die ersten computer-animierten Filme auf den Markt und die grossen Filmen wurden zusehends mehr technisch unterstützt. Mit Filmen wie Matrix oder auch Star Wars revolutionierte sich die ganze Branche. Hollywood, Cinnecittà und Bollywood sind grosse Filmzentren. Heute ist Indien der grösste Kinofilmproduzent. In den 30er Jahren hätte wohl auch niemand für möglich gehalten, dass die Produktionskosten für Kinofilme einmal grosse Dimensionen annehmen werden. Ein kleines Beispiel? Der Film Avatar (2009) kostete in der Produktion 237 Mio. Der Kinofilm Der weisse Hai (1975) hingegen gerade einmal 7 Mio. Man darf gespannt sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt. 24 Bilder Spannung pro Sekunde Im Kino werden keine bewegten Bilder gezeigt. Das ist eine Täuschung. In Wirklichkeit gleiten am Auge in einer Sekunde 24 Phasenbilder (einzelne Bilder einer Bewegung) vorbei. Wir haben dann den Eindruck, dass sich etwas bewegt. Wichtig beim Filmen ist, dass die Bilder gleichmässig aufgenommen und in derselben Geschwindigkeit wieder abgespielt werden. Sonst wirkt die Bewegung abgehackt oder sprunghaft. Das Aufnehmen war damals gar nicht so einfach, denn die Filme wurden noch mit der Hand durch die Kamera gekurbelt. Bei den ersten Filmen nahm die Kamera 16, später 18 Bilder in einer Sekunde auf und entsprechend spielten die Projektoren in einer Sekunde 16 oder 18 Bilder wieder ab. Modernere Kameras machen für Kinofilme 24 Aufnahmen pro Sekunde und die Projektoren werfen sie in der gleichen Geschwindigkeit später auf die Leinwand. Bei Filmen, die im Fernsehen ausgestrahlt werden, sind es technisch bedingt 25 Bilder pro Sekunde. 9 M&U „Wie die Bilder laufen lernten So läuft der Film im Kino Auf der Kinoleinwand siehst du ein riesiges Bild, dabei ist das ursprüngliche Bild nur dreieinhalb Zentimeter breit. Es wird von einem Filmprojektor über ein Linsensystem und mit einer starken Lampe auf die Leinwand projiziert und dabei wie beim Schattenspiel vergrössert. Jeder Kinosaal hat einen Vorführraum, in dem dieser Projektor steht. Der Kinofilm, ein langes Filmband, von mehreren Tausend Meter Länge, das aus zigtausenden einzelner Bilder besteht, wird auf einen grossen flachen Teller gelegt oder mit einer Spule hochkant auf den Projektor gesteckt und über viele Zahnräder und Rollen hinweg eingefädelt. Eine Mechanik zieht dann den Film – Bild für Bild – an einem kleinen Fenster vorbei. Dabei fällt jedes Mal kurz Licht durch das Fenster und projiziert das Bild auf die Leinwand im Saal. Diese Technik ist allerdings bald überholt. Sie wird in einigen Jahren mit Ausnahmen in Filmmuseen und Filmkunstkinos ganz verschwinden. Schon heute wird der gesamte Film ähnlich wie bei der Digitalfotografie Bild für Bild gleich digitalisiert. Er liegt also nicht mehr als schweres Filmband, sondern nur noch elektronisch als riesige Datenmenge auf einer Festplatte oder einem anderen Speichermedium vor. Im Vorführraum der Kinos steht dann eine Computeranlage, die den Beamer gleich mit dabei hat. Einen Beamer kennst du sicher aus der Schule. Im Kino allerdings stehen Hochleistungsbeamer, denn die Leinwand ist dort viel grösser und weiter entfernt als im Klassenzimmer. Dieser Beamer muss deshalb eine sehr starke Lampe und auch ein grösseres Objektiv haben. Mit Hilfe des Beamers werden die elektronischen Impulse von der Festplatte wieder in sichtbare Bilder zurückverwandelt, die dann ebenfalls auf die Leinwand geworfen und dabei vergrössert werden. 10 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Wie ein Film entsteht Ein gutes Drehbuch ist der halbe Film Um einen Spielfilm zu drehen, braucht man zuerst eine Geschichte, die später in Bilder und Töne umgesetzt wird. Profis schreiben deshalb ein Drehbuch, damit sie den Herstellungsprozess eines Films genau planen können. Bevor du drehst, musst du also schreiben: Wann sich der Teil der Geschichte abspielt (die Tageszeit), wo er stattfindet (der Drehort), was passiert (die Handlung), was die Schauspieler sagen (die Dialoge) und welche Stimmung sie spielen sollen (ob sie in ihrer Rolle fröhlich, nachdenklich, traurig, sauer sind und so weiter). So ein Drehbuch will gut überlegt sein. Ganz am Anfang wissen auch Profis nicht, wie der fertige Film aussehen wird. Zuerst gibt es immer eine Idee, worum es überhaupt gehen soll. Diese Idee fassen Profis in einem Plot zusammen und verfeinern dann diesen Plot so lange, bis der genaue Handlungsablauf feststeht. Erst dann kann das Drehbuchschreiben beginnen. Drehbücher für lange Kinofilme sind ziemlich dick. Denn jede Geschichte eines Films besteht aus vielen kleineren. Zum Beispiel aus der kleinen Geschichte, wie jemand auf dem Weg zur Arbeit auf einer Bananenschale ausrutscht. In der Film-Fachsprache heissen diese Teilgeschichten oder. Jede Sequenz enthält eine Reihe von , die inhaltlich zusammengehören: Beispielsweise, wie der Hase seine Wohnung verlässt, wie jemand die Bananenschale wegwirft, wie der Hase um die Ecke biegt, wie jemand oben aus dem Fenster ruft und der Hase nach oben sieht, so dass er auf der Schale ausrutscht. Szene sagt man zu einer, die am gleichen Ort zur gleichen Zeit spielt. nennt man die zusammenhängenden Bilder, die eine Kamera Unterbrechung filmt. Ein anderes Wort dafür ist . Aufnahme Einstellung Sequenz – Geschichten – Situation – Episode – Szenen ohne 11 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Schreibe dein eigenes Drehbuch Was: Wann: Wo: Stimmung: Darsteller: Inhalt der Geschichte: Inhalt der Dialoge: 12 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Botschaft eines Filmes Filme erzählen spannende, lustige oder auch nachdenkliche Geschichten von Abenteuern, Freundschaften oder Beziehungen in der Familie. Dabei können Filme in uns sehr unterschiedliche Gefühle hervorrufen: Freude, Mitleid, Angst, Wut oder sogar Hass. Wir fiebern mit den Heldinnen und Helden mit, wir leiden mit ihnen, wir freuen uns mit ihnen. Filme können auch unsere Meinung über andere Menschen, über andere Länder und Lebensweisen beeinflussen. Wie aber gelingt es dem Film, so stark auf uns zu wirken? Der Film ist eine Kunstform, in der Bilder, Sprache, Ton und Musik zusammenwirken. Wenn wir wissen, wie diese Bausteine gestaltet sind und miteinander verknüpft werden können, verstehen wir den Film und seine Botschaft besser. Zum Beispiel wecken die verschiedenen Bildausschnitte, sogenannte Kameraeinstellungen, in uns bestimmte Gefühle und Erwartungen. Wenn du einen Menschen im Film in einer Nahaufnahme siehst, lenkt der Regisseur deine Aufmerksamkeit auf dessen Gesichtsausdruck und auf dessen Gefühle. Würde die gleiche Person in einer Totalen, das heisst viel kleiner inmitten einer Landschaft oder in einem Zimmer, gezeigt werden, würde dieser Mensch weniger im Mittelpunkt deiner Wahrnehmung stehen. Stattdessen bekommst du einen Gesamtüberblick über das Geschehen und bist gespannt, was als Nächstes passiert. Die Wahl der Kameraposition und des Bildausschnittes geben dir bestimmte Informationen und rufen gleichzeitig bestimmte Gefühle hervor Auch die Lichtsetzung (hell und dunkel), die Farbgebung (warme, kalte Farben), der Ton, die Musik und vieles mehr werden im Film gezielt eingesetzt, um eine bestimmte Wirkung auszulösen. 13 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Die Kameraperspektiven Die Wahl des Kamerastandpunkts, die Kameraperspektive, trägt dazu bei, unterschiedliche Eindrücke in uns hervorzurufen. Wenn die Kamera einen Menschen von unten aufnimmt und du zu ihm hinaufsehen musst, wirkt er mächtig, mitunter sogar bedrohlich. Das nennt man auch Froschperspektive. Nimmt die Kamera einen Menschen von oben auf, aus der sogenannten Vogelperspektive, dann wirkt dieser Mensch auf dich klein, wenig mächtig und auf keinen Fall bedrohlich. 14 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Der Schnitt des Filmmaterials Heute werden die meisten Filme bereits digital gedreht und gespeichert. Daher wird auch der Schnitt am Computer vorgenommen. Dafür gibt es verschiedene Schnittprogramme. Aber warum wird überhaupt geschnitten? Beim Dreh kommt die Geschichte durcheinander Filme werden nicht chronologisch gedreht (also nicht in der Reihenfolge der Geschichte). Manchmal wird sogar das Ende gleich am ersten Tag gefilmt. Warum? Wenn man im Drehbuch sieht, dass mehrere Szenen am gleichen Ort spielen, dreht man sie direkt nacheinander. Denn jede Einstellung und jede Szene macht viel Arbeit: Die Schauspieler ziehen Kostüme an, sie werden geschminkt, der Raum wird eingerichtet, überall werden Lampen aufgestellt, die Kamera muss am richtigen Platz stehen, manchmal werden für den Dreh auch Strassen und Plätze gesperrt. Das alles dauert eine Weile, auch wenn die Aufnahme nur kurz ist. Man spart also viel Arbeit, Zeit und Geld, wenn man alles, was dort irgendwann in der Geschichte passiert, gleich nacheinander filmt. Weil diese Aufnahmen in der Geschichte an verschiedenen Stellen auftauchen, werden sie später geschnitten und richtig aneinandergehängt. Das Schneiden ist aber auch ein Gestaltungsmittel, um Abwechslung und Tempo in den Film zu bringen und noch mehr Spannung zu erzeugen. Oft werden verschiedene Einstellungen von der gleichen Situation gedreht. Die Schauspieler müssen diese also mehrmals spielen und zwar immer wieder auf die gleiche Art. Denn manchmal geht zwischendurch etwas schief und der Regisseur ist nicht zufrieden. Dann muss die Szene wiederholt werden, manchmal Stunden später. Da passiert es schnell, dass sich ein Filmpärchen zwanzig Mal küssen muss! Damit in der Szene auch wirklich alles gleich bleibt, sorgt ein Mitglied aus dem Filmteam dafür, dass sich zum Beispiel die Kostüme und der Raum bei den verschiedenen Einstellungen nicht verändern. Ein anderes Wort für Filmschnitt ist Montage (das ist Französisch und bedeutet unter anderem Aufbau), denn beim Schnitt werden Filme zusammengebaut. Die Person, die das macht, wird Cutter genannt. To cut ist Englisch und bedeutet schneiden. 15 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Der Rhythmus des Films Jeder Film hat einen Rhythmus. Das ist wie bei der Musik. Mal erzählt der Film etwas langsam, mal schneller – so wie es am besten zur Geschichte passt. Eine Verfolgungsjagd zum Beispiel ist schnell geschnitten, damit der Zuschauer gefühlsmässig mitrennt. Eine ruhige Liebesszene dagegen versetzt ihn in eine romantische Stimmung, die eher einen langsamen Rhythmus braucht. Der Rhythmus eines Films wird schon während des Drehens beachtet. Aufnahmen, die zur gleichen Szene gehören, werden zum Beispiel aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt: von vorne, von der Seite, von hinten, von oben oder unten – so als schauten viele Augen gleichzeitig zu. Stell dir zum Beispiel eine Verfolgungsjagd vor: Alles, was dafür gefilmt wurde, kann der Cutter beim Schnitt benutzen, um das Tempo dieser Szene zu steigern. Erst wurde die gejagte Person eine Weile beim Weglaufen gefilmt, dann die Person, die sie jagt, genauso lange beim Hinterherrennen. 16 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Einige dieser Aufnahmen hat der Kameramann in der Totalen (eine Person oder auch Gruppe wird ganz, auch in ihrer Umgebung gezeigt) gedreht, andere halbnah (eine Person wird vom Kopf bis zur Hüfte abgebildet). Ausserdem hat er noch ein paar Grossaufnahmen gemacht: von dem schwitzenden Gesicht der einen und von den rennenden Beinen der anderen Person. Am Schneidetisch bringt der Cutter Spannung hinein, in dem er all diese Bilder geschickt verbindet. Totale der Strasse – Schnitt – Grossaufnahme der Beine – Schnitt – halbnahe Aufnahme des Verfolgten – Schnitt – Grossaufnahme seines Gesichts – Schnitt – halbnahe Aufnahme des Verfolgers – Schnitt – und so weiter. Je kürzer jede Einstellung zu sehen ist, desto schneller wirkt die Verfolgungsjagd und hat mehr action, wie die Profis sagen würden. Die Zeit zurückdrehen? Kein Problem In manchen Geschichten spielen Erinnerungen oder Träume eine wichtige Rolle. Um die Handlung zu verstehen, muss man vielleicht sehen, was vor drei Jahren geschah. Solche Teile eines Films nennt man Rückblende. Damit der Zuschauer versteht, dass sich die Zeit verändert, wird ein solcher Schnitt besonders gekennzeichnet. Manchmal steht im Bild einfach eine Einblendung: vor drei Jahren oder Mexiko 1999. 17 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Ich sehe was, das du nicht siehst Manchmal ist es für eine Geschichte wichtig, dass der Zuschauer erfährt, was verschiedene Personen gleichzeitig tun. Wenn zum Beispiel ein Einbrecher ins Haus steigen will, in dem die Bewohner friedlich schlafen, ist es spannend, wenn man abwechselnd den Einbrecher und die Schlafenden sieht. Denn beides gehört zusammen. Wenn so etwas im Film vorkommt, nennt man das Parallelaufbau (Parallelmontage). Der Einbrecher nähert sich dem Haus – Schnitt – die schlafende Person dreht sich um – Schnitt – der Einbrecher macht sich an der Tür zu schaffen – Schnitt – die Schläferin schnarcht kurz laut auf. Durch geschickte Schnitte kann man so die Spannung erhöhen. Als Zuschauer wirst du dabei ganz aufgeregt, weil du möchtest, dass die Schlafenden wach werden. Auch die Verfolgungsjagd von vorhin ist ein gutes Beispiel für die Parallelmontage. Natürlich können Ereignisse, die gleichzeitig geschehen, auch weit auseinanderliegen. Jemand in der Antarktis entdeckt ein Dino-Ei, während ein Forscher in Deutschland gerade frühstückt. Wenn solche Szenen im Schnitt miteinander verbunden werden, haben sie natürlich etwas miteinander zu tun. Denn als Zuschauer vermutest du dabei gleich einen Zusammenhang. Erst einmal bleibt dieser Zusammenhang aber ein Geheimnis, das die Spannung erhöht, wie es weitergeht. 18 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Arten des Filmes Ungekürzte Handlung: Parallelaufbau: Rückblende: Einblendung: Filmformen 1 Spielfilm: 2 Trickfilm: 3 Dokumentarfilm: 19 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Die Tonmischung Was beim Film zum guten Ton gehört: 1. 2. 3. 4. ist da die : Die Personen unterhalten sich. gibt es meistens: Sie betont die Gefühle und beeinflusst dich beim Filmsehen ganz stark. gibt es viele , die an bestimmten Stellen im Film zu hören sind, wie zum Beispiel Züge und Meeresrauschen, Durchsagen am Flughafen. Diese Töne nennt man . Sie geben die Atmosphäre wieder, die dieser Ort ursprünglich hat. sind da noch Geräusche, die für die besonders wichtig sind: Ein lauter Pistolenschuss zum Beispiel, Schritte im Schnee oder das Knarren einer Tür. Diese Geräusche werden nicht beim Drehen aufgenommen, sondern später dazu gemischt. Jeder einzelne dieser Töne wird, genau wie jedes Bild, sorgfältig geplant. Original-Ton (O-Ton) Es soll eine Busfahrt gefilmt werden, bei der eine Szene an der Haltestelle spielt. Im Film hörst du dann die quietschenden Reifen beim Halten des Busses, das Geräusch der Bustür, wenn sie aufgeht, das Scharren der Füsse und einige Leute die miteinander quatschen. Damit das so klingt wie im wirklichen Leben, müssen all die Geräusche extra aufgenommen und dann gemischt werden. Denn das Mikrofon der Kamera reicht dafür nicht aus. Für die Tonaufnahme befestigen Profis in der Regel das Mikro an einer Art Angel. Natürlich müssen sie aufpassen, dass es im Bild nicht zu sehen ist. Auch wichtige Gespräche der Hauptpersonen werden beim Drehen mit einem Extramikrofon aufgenommen. Die Aufnahme der Unterhaltung nennt man O-Ton (das ist die Abkürzung für Original-Ton). 20 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Synchronsprechen Wenn das, was die Personen sagen, nicht laut genug geworden ist, wird die Unterhaltung später noch einmal im Studio aufgenommen. Das nennt man Nachsynchronisation. Bei der Nachsynchronisation müssen die Schauspieler genau darauf achten, dass sie ebenso schnell sprechen wie im Film, damit ihre Lippenbewegungen zum Ton passen. Tontechniker mischen die Studioaufnahmen später mit der Atmo zusammen – dann klingt es, als fände das Gespräch auf der Strasse statt. Geräusche Geräusche, die man im Film besonders deutlich hören soll, werden im Studio nach dem Dreh von einem Geräuschemacher hergestellt. Der sieht sich die Bilder an und macht an der passenden Stelle das richtige Geräusch. Kaum ein grosser Film kommt ohne zusätzliche Geräusche aus. Knirschende Schritte im Schnee sind einfach zu leise, auch das Rascheln von Kleidern hört man sonst kaum. Selbst Pistolenschüsse und Explosionen entstehen extra im Tonstudio. Off-Ton In manchen Filmen hörst du die Gedanken einer Hauptperson. Du erkennst das daran, dass sie dabei die Lippen nicht bewegt. Filmleute nennen das einen Off-Ton (off ist Englisch und bedeutet unter anderem nicht anwesend). Auch Geräusche kommen manchmal aus dem Off, zum Beispiel hörst du den Knall von einem Auffahrunfall, ohne die Autos im Bild zu sehen. Ein Puzzle aus Tönen Wenn alle Töne und die Musik aufgenommen sind, beginnt die Arbeit des Toningenieurs. Ein Toningenieur ist ein Künstler, der den Ton für den Film neu zusammenstellt. Bei der Tonmischung bestimmt der Toningenieur, welche Töne leiser sein sollen und welche lauter und wie die Töne ineinander übergehen. Er macht dies natürlich in Absprache mit dem Filmemacher. Die Stimmung, die sich durch den Ton auf die Zuschauer überträgt, ist immer sehr sorgfältig gestaltet. Das gilt besonders für die Musik. Wenn es romantisch wird, hörst du vielleicht Geigenklänge. Wenn jedoch ein Bote eilig durch einen finsteren Wald reitet, klingt die Musik eher nach Gefahr. Als Zuschauer gehst du innerlich immer mit der Musik eines Films mit. Das gilt für dramatische Situationen genau so wie für lustige. 21 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Deine eigene Geräuschekiste So kannst du mit einfachen Mitteln eindrucksvolle Töne zaubern: Füll eine Hand voll Erbsen in ein längeres Papprohr (zum Beispiel von einer Küchenrolle) und klebe die beiden Enden des Rohres zu. Wenn du es langsam hin- und herbewegst, klingen die Erbsen in der Pappe wie Regen. Bei schnelleren Bewegungen pladdert es richtig. Der Wind weht leise oder lauter, wenn du vorsichtig in eine Flasche pustest. Du kannst dabei ganz unterschiedliche Töne erzeugen. Probier aus, was dir am besten gefällt. Mit der Küchenmaschine oder einem Mixer kannst du fabelhafte Geräusche machen. Der Mixer zum Beispiel hört sich wie eine Säge an, wenn du seine Geräusche mit dem Mikrofon aufnimmst. Mit Wasser zauberst du herrliche Töne. Wie sie klingen, hängt davon ab, wohin du es giesst: Auf Metall, auf Holz oder auf Porzellan hören sich Wassertropfen jeweils anders an. Auch die Geschwindigkeit spielt eine Rolle: Du kannst langsam tröpfeln oder einen dicken Strahl laufen lassen – zum Beispiel für einen Wasserfall. Füll Reis in eine Tüte und schüttele sie rhythmisch. Schon hörst du bei der Aufnahme Schritte – je nach Tüte und Schnelligkeit beim Schütteln knirschen sie einen Waldweg entlang oder marschieren flott über ein Kiesgelände. Wenn du Zellophan oder Alufolie immer wieder zusammendrückst, hört sich das an, als ob Feuer knistert. Probier aus, wie dicht du dabei ans Mikrofon herangehen musst. Auch mit diesen Dingen kannst du fantastische Geräusche machen: Fahrradklingel, Trillerpfeife, Murmeln, Luftballon . 22 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Drei Stufen beim Filmemachen Zu jedem Film gehört eine gute Planung. Das Drehbuch ist nur der erste Schritt. Wenn es fertig ist, beginnt die Arbeit am Film. Filme entstehen in drei grossen Schritten: 1. Die Vorbereitung Die Vorbereitung eines Films heisst in der Fachsprache Präproduktion (prä ist ein lateinisches Wort, das vor bedeutet). Dazu gehören: • die Finanzierung des Films, denn jeder Film kostet Geld; bei grösseren Produktionen können das leicht mehrere Millionen Euro sein, • die Suche nach geeigneten Drehorten und der Bau von Kulissen (in der Filmsprache spricht man von Locations, das ist das englische Wort für Orte), • die Suche nach Schauspielern (das nennt man Casting), • die Auswahl der Kostüme und Requisiten (was haben die Helden des Films an, was steht in den Räumen, welche Autos werden gebraucht? und so weiter), • technische Entscheidungen (mit welcher Kamera wird gefilmt, welche Objektive braucht man?), • die Planung der Special Effects (das Wort ist Englisch und bedeutet Spezialeffekte, also Tricks im Film, zum Beispiel, wenn Harry Potter auf einem Besen fliegt) • ein genauer Zeitplan (Drehplan), was wann wo und mit wem gefilmt werden soll. 23 M&U „Wie die Bilder laufen lernten 2. Der Dreh Mit Hilfe des Drehplans wird bestimmt, wann welche Szene des Films gefilmt wird. Das richtet sich nach den Drehorten und nicht nach dem chronologischen Handlungsablauf. Natürlich muss man manchmal auch den Drehplan umstellen, weil ein Schauspieler krank wird oder es regnet, obwohl in einer Aussenaufnahme die Sonne scheinen soll. Das Produktionsteam sorgt dafür, dass beim Drehen alles reibungslos läuft: • dass die Technik an Ort und Stelle ist (und funktioniert), • dass alle Requisiten dort sind, wo sie hingehören, • dass Stuntmen (oder Stuntwomen übernehmen in gefährlichen Szenen die Rolle der Schauspieler/innen zum Beispiel bei rasanten Verfolgungsjagden)vor Ort sind, wenn sie gebraucht werden, • dass die Schauspieler rechtzeitig am Drehort sind, • dass Komparsen (Laienschauspieler) pünktlich da sind, • dass auch an die Verpflegung (Essen und Trinken) bei den Dreharbeiten gedacht wird; in der Fachsprache heisst das Catering, • dass alle Teammitglieder wissen, wenn etwas geändert wird 24 M&U „Wie die Bilder laufen lernten 3. Postproduktion Wenn alles gedreht ist, ist der Film noch nicht fertig. Jetzt beginnt die Phase der Postproduktion (post ist Latein und bedeutet nach ). Das sind Arbeiten, die nach dem Drehen gemacht werden: • die Sichtung, Auswahl und Archivierung des Filmmaterials, denn oft wird dieselbe Szene mehrfach und in verschiedenen Kamerapositionen gedreht, um bei der Endauswahl das beste Ergebnis zu erzielen, • der Schnitt des Filmmaterials, • die Komposition der Filmmusik, • separate Tonaufnahmen im Studio (zum Beispiel Geräusche, Musik und Sprache) und die Mischung der Töne zum fertigen Filmton, • die Herstellung der Filmkopien bzw. die Digitalisierung des Films, damit er in den Kinos gezeigt werden kann • die Werbung für den Film in verschiedenen Medien 25 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Filmindustrie und Werbung: Produkte aus der Traumfabrik Kinofilme herzustellen, kostet sehr viel Geld. Für Harry Potter und der Stein der Weisen zum Beispiel brauchten die Produzenten 150 Millionen Dollar. So teure Filme will und muss man natürlich auch gut verkaufen. Genau wie für andere Waren gibt es auch für Filme einen Markt. Filmproduzenten verkaufen sie auf Messen und Festivals an Verleiher und andere Filmeinkäufer. Damit diese und auch die Kinobetreiber durch den Film Geld einnehmen können, bist du wichtig. Denn du bezahlst im Kino oder in der Videothek dafür, dass du Filme sehen kannst. Damit du dir den Film auch ansiehst, wird die Werbetrommel gerührt. Das fängt schon an, wenn der Film gedreht wird. In den Zeitungen steht etwas über die Dreharbeiten, im Fernsehen läuft vielleicht ein Bericht dazu. Auch auf Plakaten und im Internet wird für den Film geworben. Für manche Filme werden sogar eigene Websites hergestellt. Dort erfährst du dann viele Hintergrundinformationen zu den Filmen. Kinos, Fernsehen und DVDs zeigen Trailer mit Filmausschnitten, die Schauspieler geben Interviews und der fertige Film wird häufig vor dem Start auf Filmfestivals gezeigt. Werbung findet aber auch durch bestimmte Produkte statt, wie zum Beispiel durch T-Shirts oder Taschen mit Harry-Potter-Motiven. Das nennt man dann Merchandising (to merchandise ist Englisch und heisst handeln, vermarkten). Durch den Verkauf dieser Produkte kann der Filmverleiher zusätzlich Geld einnehmen. 26 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Berufe beim Film 27 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Was haben Comics mit Filmen zu tun? Wer klare Vorstellungen im Kopf hat, kann seine Bilder gut beschreiben. Aber wie genau sieht jede Aufnahme aus? Um die Bilder einer vor dem Drehen noch genauer zu planen, entwickeln Profis ein Storyboard. Im sind alle schon so gezeichnet, wie du sie später siehst. Diese Zeichnungen heissen; das ist Englisch und bedeutet Kritzelei. Denn sehr genau müssen die Bilder nicht sein, wichtig ist nur, dass jeder erkennt, was im Film zu sehen sein soll. Hier siehst du, wie man die Szene mit Hase Meier und der Bananenschale filmen könnte. Daswurde in ein Storyboard umgesetzt. Sieht doch aus wie ein kleiner Comic, oder? Hier sieht man auch, wie die Kamera die Bilder aufnehmen soll. Jedes Bild steht für eine. Im Storyboard kann man sofort sehen, ob die der Bilder stimmig ist. Es ist wichtig, dass alle das Storyboard kennen, die für die Aufnahmen verantwortlich sind. Einstellung Scribbles Storyboard – Abfolge Aufnahmen – Szene – Drehbuch Die Bananenschale Szene 1 (Morgens/Aussen/Vor dem Haus) Hase Meier ist auf dem Weg zur Arbeit. Er ist guter Dinge und geht pfeifend die Strasse entlang. Er trägt einen Mantel und einen Hut und hat eine Aktentasche in der rechten Hand. Hase Meier (pfeift) Szene 2 (Morgens/Aussen/Auf dem Gehweg) Ein Auto fährt die Strasse entlang. Aus dem Beifahrerfenster fliegt eine Bananenschale. Diese landet auf dem Fussweg, unter dem Fenster von Frau Lilo Müller. 28 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Szene 3 (Morgens/Innen/Küche) Frau Lilo Müller steht am Fenster und guckt hinaus. Dann öffnet sie das Fenster und beugt sich hinaus. Szene 4 (Morgens/Aussen/Auf dem Gehweg) Frau Lilo Müller lehnt sich aus dem Fenster und Hase Meier sieht hinauf zu ihr. Frau Lilo Müller (fröhlich): Guten Morgen, Hase Meier. Einen schönen Tag! Hase Meier (fröhlich): Morgen, Frau Lilo Müller, das wünsch ich Ihnen au. Szene 5 (Morgens/Aussen/Auf dem Gehweg) Abgelenkt durch Frau Lilo Müller, achtet Hase Meier nicht auf den Fussweg. Er tritt auf die Bananenschale und rutscht aus. Szene 6 (Morgens/Aussen/Auf dem Gehweg) Frau Lilo Müller lehnt sich weit aus dem Fenster. Frau Lilo Müller (erschrocken): Haben Sie sich verletzt? Soll ich den Krankenwagen rufen? 29 M&U „Wie die Bilder laufen lernten Trixomat Möchtest du wissen, wie ein Trickfilm entsteht? Und möchtest du mal einen eigenen Trickfilm machen? Mit dem Trixomat geht das kinderleicht. Das ist eine Software, mit der du kleine oder auch grössere Trickfilme herstellen kannst. Du kannst selbst gemachte Figuren, deine Fotos oder auch Figuren aus dem Trixomat zum Laufen bringen. Und wenn du mal nicht weiter weisst, gibt es eine Anleitung, die dir die einzelnen Schritte erklärt und dir weiterhilft. Und es ist ein grosser Spass, die eigenen Trickfilme zu sehen und anderen vorzuführen! Zum Tixomat gehts hier lang: Quellen: Praxis Grundschule, 101 Ideen zum Kinderfilm (Heft 4, 1991) (enthält Texte gekürzt und leicht überarbeitet aus dem Buch: Clever einschalten! Wie Film und Fernsehen funktionieren. Herausgegeben von Sandra Dujmovic und Joachim Lang. Texte: Rotraut Greune. SWR 2008) 30