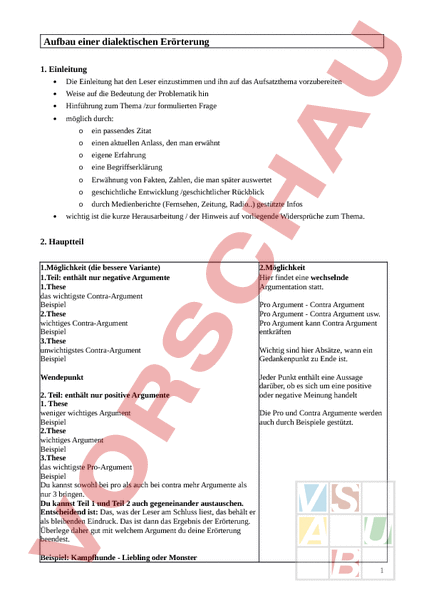Arbeitsblatt: Aufbau einer dialektischen und linearen Erörterung
Material-Details
Das Dossier gibt Hinweise über das WIE einer dialektischen und linearen Erörterung und vergleicht sie miteinander.
Deutsch
Texte schreiben
9. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
131733
1114
11
06.05.2014
Autor/in
Katharina Rüegger
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Aufbau einer dialektischen Erörterung 1. Einleitung • Die Einleitung hat den Leser einzustimmen und ihn auf das Aufsatzthema vorzubereiten • Weise auf die Bedeutung der Problematik hin • Hinführung zum Thema /zur formulierten Frage • möglich durch: • ein passendes Zitat einen aktuellen Anlass, den man erwähnt eigene Erfahrung eine Begriffserklärung Erwähnung von Fakten, Zahlen, die man später auswertet geschichtliche Entwicklung /geschichtlicher Rückblick durch Medienberichte (Fernsehen, Zeitung, Radio) gestützte Infos wichtig ist die kurze Herausarbeitung der Hinweis auf vorliegende Widersprüche zum Thema. 2. Hauptteil 1.Möglichkeit (die bessere Variante) 1.Teil: enthält nur negative Argumente 1.These das wichtigste Contra-Argument Beispiel 2.These wichtiges Contra-Argument Beispiel 3.These unwichtigstes Contra-Argument Beispiel 2.Möglichkeit Hier findet eine wechselnde Argumentation statt. Wendepunkt Jeder Punkt enthält eine Aussage darüber, ob es sich um eine positive oder negative Meinung handelt Pro Argument Contra Argument Pro Argument Contra Argument usw. Pro Argument kann Contra Argument entkräften Wichtig sind hier Absätze, wann ein Gedankenpunkt zu Ende ist. 2. Teil: enthält nur positive Argumente 1. These weniger wichtiges Argument Die Pro und Contra Argumente werden Beispiel auch durch Beispiele gestützt. 2.These wichtiges Argument Beispiel 3.These das wichtigste Pro-Argument Beispiel Du kannst sowohl bei pro als auch bei contra mehr Argumente als nur 3 bringen. Du kannst Teil 1 und Teil 2 auch gegeneinander austauschen. Entscheidend ist: Das, was der Leser am Schluss liest, das behält er als bleibenden Eindruck. Das ist dann das Ergebnis der Erörterung. Überlege daher gut mit welchem Argument du deine Erörterung beendest. Beispiel: Kampfhunde Liebling oder Monster 1 Bist du für Liebling oder Monster? Dann beginnst du mit dem, was deiner Meinung nicht stimmt und endest mit dem, wovon du überzeugt bist, dass es richtig ist. 3. Schlussteil möglich ist: • Appell an den Leser richten • ungelöste Probleme aufzeigen • Einleitung aufgreifen, so dass um den Hauptteil ein Rahmen entsteht • (möglich, wenn man in der Einleitung Zahlenmaterial verwendet oder wenn die Einleitung auf Informationen aus den Medien beruht, dann kann man am Ende darauf Bezug nehmen) Vermutungen über Ausblick für die Weiterentwicklung anstellen • mögliche Grenzen aufzeigen • wichtige Ergebnisse zusammenfassen • eigenen Standpunkt/persönliche Meinung kurz formulieren Aufbau einer linearen Erörterung (Argumentationskette) Normalerweise werden in einer Erörterung das Für und Wider (Pro und Kontra) einander gegenübergestellt und abgewägt, um schlussendlich ein Fazit zu ziehen und eine Meinung bilden zu können. Bei der linearen Erörterung hingegen (lineargradlinig) soll nur der eigene Standpunkt begründet werden, und zwar mit dem Anreihen von Argumenten, mit einer Argumentationskette. Die Argumente können nach ihrer Wichtigkeit geordnet werden. Damit man das Interesse des Lesers wach hält, steigert man die Gewichtung der Argumente und bewahrt das stärkste für den Schluss auf. Gegenargumente werden nur am Rande eingebracht. Die lineare Erörterung bietet sich besonders dann an, wenn ein Thema als Frage formuliert ist. Warum ist eine gute Schulbildung heute wichtiger denn je? Was können wir gegen eine überhand nehmende Fremdenfeindlichkeit tun? Wie können wir unseren Pausenplatz mit einfachen Mitteln freundlicher gestalten? Wieso sollte jede Schülerin und jeder Schüler einen Internetzugang haben? 2 Aufbau einer linearen Erörterung 1. Einleitung: Aktualität Wichtigkeit der Problematik Erklärung der Fragestellung 2. Hauptteil: Formulierung der eigenen These (Grundhaltung) Argumentation für die These Argument 1 Argument 2 Argument 3 3. Schluss: Zusammenfassung, abschließendes Gesamturteil Ausblick (wie es weiter gehen könnte, was man auch noch tun müsste) Der Unterschied zwischen linearer und dialektischer Erörterung Lineare oder steigernde Erörterung • • Beispielthemen Was macht einen guten Lehrer aus? Warum ist eine gute Schulbildung heute wichtiger denn je? • Warum Jugendliche nicht zur Zigarette greifen sollten? Meist als Frage formuliert. Es kann auch ein Zitat sein zu dem man Stellung beziehen soll. • Diese Art von Erörterung verlangt begründete Sachurteile zu einem Sachverhalt, der vorgegeben ist. (siehe Beispielthemen) Der Sachverhalt ist unstrittig. Man zweifelt die Aussage nicht an sondern sucht nach Argumenten, die die Aussage im Thema unterstreichen. Die eigene Meinung ist besonders wichtig. Unterschied zwischen den beiden Erörterungstypen • die einzelnen Arbeitsschritte (Checkliste) zur Vor- 1. Thema erfassen Worum geht es? 2. Argumente/ Ideen auf einem Blatt sammeln (noch nicht ordnen) Überlege auch Beispiele, die die Argumente belegen /persönliche Erfahrungen ev, Dialektische Erörterung • Kampfhunde Liebling oder Monster • Sollten Computer bereits im Kindergarten eingeführt werden? • Er ist Fluch und Segen zugleich, der Fernseher. Typische Aufgabenstellung: Erörtern Sie die Vor- und Nachteile Nehmen Sie Stellung dazu Es kann auch ein Zitat sein • Bei dieser Art von Erörterung werden unterschiedliche Ansichten/ Meinungen zu einem Thema dargestellt. • Der Sachverhalt ist immer strittig. d.h. man streitet sich, ob die gemachte Aussage (das Thema richtig ist oder nicht, daher gibt es pro und contra Argumente. • man kann unterschiedliche Argumente entkräften oder auch bekräftigen. 1. Thema erfassen Worum geht es? Das Thema zur Frage machen. 2. Argumente Ideen auf einem Blatt sammeln Fertige dir eine Tabelle mit pro und contra 3 bereitung der Erörterung historischer Rückblick /ev. Zahlenmaterial ein Mind- Map macht sich für deine Ideen gut. Überlege auch Unterpunkte 3. Argumente nach Wichtigkeit ordnen (wichtig -wichtiger- am wichtigsten)Zumeist steigert man sich in der Auseinandersetzung mit dem Thema. 4. Finde eine Einleitung und einen Schluss -Argumenten an Überlege auch Beispiele, die deine Argumente belegen. 3. Ordne die Argumente nach Wichtigkeit, nach überzeugender Reihenfolge Nimm kritisch Stellung und fälle ein Urteil 4. Finde eine Einleitung und einen Schluss Mache logische Absätze beim Schreiben. Möglicher Wortschatz für Erörterungen Einleitung • Daraus ergibt sich die Frage • Dies führt zur Frage • Daher ergibt sich die Frage, ob • Ich möchte untersuchen, ob Hauptteil Pro-Argumentation Dafür spricht, dass Außerdem kommt hinzu, dass Das Hauptargument dafür ist Hinzu kommt, dass Wenn du etwas hervorheben möchtest: vor allem hauptsächlich insbesondere besonders meistens, ich möchte betonen/hervorheben, dass Besonders wichtig aber erscheint, Man darf auch nicht übersehen, dass, entscheidend ist jedoch, Außerdem spielt noch eine wichtige Rolle, Allerdings muss man auch sehen, dass Weitaus wichtiger ist aber noch, Wenn du etwas wiederholen musst: Wie bereits erwähnt, wie bereits beschrieben Contra-Argumentation Gegenspricht Ein weiteres Argument dagegen ist Dagegen spricht, dass Wenn du ergänzen möchtest: außerdem, darüber hinaus, sowie, ferner, zusätzlich, ergänzend, auch, weiterhin, ebenfalls, schließlich, nicht zuletzt nicht nur sondern auch, anschließend, Schlussfolgerungen ziehen demnach, also, somit, daher, deshalb, so dass, folglich, deswegen, darum trotz allem, trotzdem Schlussteil • Ich bin der Meinung, dass • Meiner Meinung Einschätzung nach • Mich überzeugen am stärksten die Gründe • Ich vertrete den Standpunkt, dass Quelle: www.lernen-mit-spass.ch 4 Mögliche Themen für Erörterungen Schreibe mögliche Themen für Erörterungen auf. Welche Themen lassen sich besser für eine lineare Erörterung verwenden (L), welche für eine dialektische (D)? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5