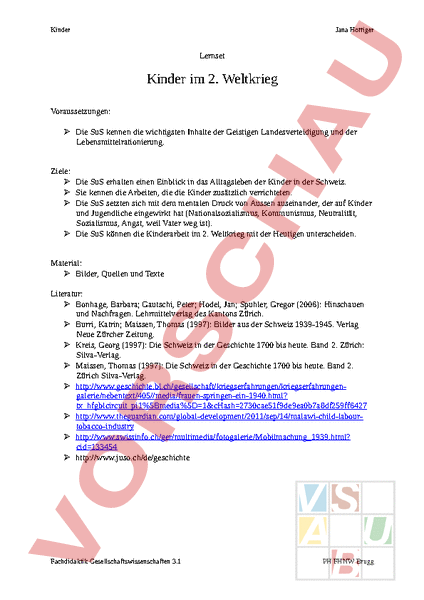Arbeitsblatt: Kinder im 2. Weltkrieg
Material-Details
Lernset:
Die SuS erarbeiten das Thema anhand von Bildern (Originalquellen).
Geschichte
Neuzeit
8. Schuljahr
9 Seiten
Statistik
133397
877
7
27.08.2014
Autor/in
Jana Hottiger
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Kinder Jana Hottiger Lernset Kinder im 2. Weltkrieg Voraussetzungen: Die SuS kennen die wichtigsten Inhalte der Geistigen Landesverteidigung und der Lebensmittelrationierung. Ziele: Die SuS erhalten einen Einblick in das Alltagsleben der Kinder in der Schweiz. Sie kennen die Arbeiten, die die Kinder zusätzlich verrichteten. Die SuS setzten sich mit dem mentalen Druck von Aussen auseinander, der auf Kinder und Jugendliche eingewirkt hat (Nationalsozialismus, Kommunismus, Neutralität, Sozialismus, Angst, weil Vater weg ist). Die SuS können die Kinderarbeit im 2. Weltkrieg mit der Heutigen unterscheiden. Material: Bilder, Quellen und Texte Literatur: Bonhage, Barbara; Gautschi, Peter; Hodel, Jan; Spuhler, Gregor (2006): Hinschauen und Nachfragen. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. Burri, Katrin; Maissen, Thomas (1997): Bilder aus der Schweiz 1939-1945. Verlag Neue Zürcher Zeitung. Kreis, Georg (1997): Die Schweiz in der Geschichte 1700 bis heute. Band 2. Zürich: Silva-Verlag. Maissen, Thomas (1997): Die Schweiz in der Geschichte 1700 bis heute. Band 2. Zürich Silva-Verlag. tx_hfgblcircuit_pi1%5Bmedia%5D1&cHash2730cae51f9de9ea0b7a8df259ff6427 cid133454 Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Kinder Jana Hottiger Arbeitsauftrag Kinder im 2. Weltkrieg Beantwortet folgende Fragen in euer Geschichtsheft (PA): 1) Führt in Einzelarbeit eine Bildbetrachtung durch, nach dem Vorgehen, das auf der nächsten Seite aufgezeigt ist. Vergleicht anschliessend eure Resultate. 2) Recherchiert in Lexika oder dem Internet was Ährenlesen genau bedeutet. 3) Beschreibt zu jedem Bild die Situation, in der sich die Kinder befinden. 4) Warum müssen sie so viel arbeiten? 5) Betrachtet alle Bilder gut und lest die Texte. Überlegt euch, wie es den Kindern zu dieser Zeit ging. Was war anders als vor dem Krieg? Welche äusseren Einflüsse wirkten auf sie ein? 6) Wähle dir ein Foto aus. Schreibe aus der Sicht eines Kindes einen Tagebucheintrag über die Situation auf dem Foto. 7) Vergleiche dieses Bild mit dem, das Frauen und Kinder beim Verarbeiten von Tabakblättern, ca. 1942 zeigt. Was unterscheidet die Arbeit voneinander? Wie unterscheiden sich die Gründe der Arbeit? Kinderarbeit auf einer Tabakfarm in Malawi, 21.Jh Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Kinder Jana Hottiger Methodisches Vorgehen Es ist notwendig, beim Interpretieren von Fotografien systematisch vorzugehen. Folgende fünf Schritte sind im Umgang mit Fotografien sinnvoll: Wer oder was ist auf der Fotografie abgebildet? Welche Personen und Gegenstände kannst du erkennen? Beschreibe das Bild, indem du sowohl eine Gesamtgliederung vornimmst als auch Details erwähnst. Was fühlst du beim Anblick der Fotografie? Woran erinnert sie dich? Was könnte die Fotografie darstellen? Hast du Vermutungen dazu oder weisst du dank der Legende Genaueres? Was erfährst du dank des Fotos über die Vergangenheit? Was kannst du über die Fotografie sagen? Welchem Zweck diente sie wohl? Was möchtest du aufgrund der Fotografie über die Vergangenheit wissen? Was möchtest du zur Fotografie selber wissen? Suche allenfalls Informationsmaterial, das dir Antworten auf deine Frage geben kann. (Bonhage, Barbara; Gautschi, Peter; Hodel, Jan; Spuhler, Gregor (2006): Hinschauen und Nachfragen. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich) Analysiere das Bild anhand des oben genannten Vorgehens. Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Kinder Jana Hottiger tx_hfgblcircuit_pi1%5Bmedia%5D1&cHash2730cae51f9de9ea0b7a8df259ff6427 Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Kinder Jana Hottiger Schulklasse beim Einsammeln von Getreideähren. Kartoffeln blieben währen des ganzen Krieges von der Rationierung ausgenommen. (Kreis 1997) http ://www.geschichte.bl.ch/gesellschaft/kriegserfahrungen/kriegserfahrungen-galerie/nebentext/405//media/frauen-springen-ein-1940.html? tx_hfgblcircuit_pi1%5Bmedia%5D1&cHash2730cae51f9de9ea0b7a8df259ff6427 Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Kinder Jana Hottiger tx_hfgblcircuit_pi1%5Bmedia%5D1&cHash2730cae51f9de9ea0b7a8df259ff6427 Im Februar 1941 wird beschlossen, dass Studenten und Schüler beiderlei Geschlechts ab 16 Jahren während der Ferien in der Anbau- und Erntezeit, andere gleichaltrige Jugendliche 3-4 Wochen in der Landwirtschaft helfen müssen. Es wurde jedoch meistens nach leistungsfähigen Jugendlichen gesucht, die sich freiwillig für den Mehranbau meldeten. (Burri, 1997) Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Kinder Jana Hottiger (Burri, 1997) Das Zürcher Kriegs-, Industrie- und Arbeits-Amt führt zur besseren Organisation der Landwirtschaftshilfe Befragungen durch. Die Antworten dieses Fragbogens beziehen sich auf den Einsatz von 3321 Helfer und Helferinnen und 1506 Angehörigen von Schulklassen oder andern Gruppen. Er ist vom Jahr 1941. (Burri, 1997) Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Kinder Jana Hottiger Die Abwesenheit vieler Väter und die hohe Arbeitsbelastung der Mütter führten zu einer starken Zunahme der Disziplinlosigkeit der Jugend. Da kam der Einsatz der Oberstufenschüler als Helfer bei der Kartoffel- und Obsternte nicht ungelegen. Häufig fiel Unterricht aus, weil Lehrer Militärdienst leisten mussten und kein Vikar verfügbar war, und 1945 störten häufige Fliegeralarme den Schulalltag. Eher als willkommene Abwechslung empfanden die Kinder das obligatorische Maikäfersammeln im Frühling 1942 und im Herbst die Wildfrüchte-Sammlungen. Als nationale Pflicht galt der tatkräftige Einsatz während der jährlichen Altstoffsammlung. Im Rahmen der „Anbauschlacht diente ein Grossteil der Wiesen und Rasenplätze dem Gemüseanbau. Kohlenmangel: Während der kalten Jahreszeit wurden die beiden Schulen im Westen und Osten ins Schreiberschulhaus verlegt. Die Kinder wurden halbtags unterrichtet und der Samstag war unterrichtsfrei. Zulasten der Herbstferien wurden die Winterferien („Kälteferien genannt) verlängert. Die Stundenpläne änderten sich immer wieder, und am Jahresende entfielen zum Teil Schulexamen und die Ausstellung der Handarbeiten. Besonders beansprucht wurden die Oberstufenschüler: Wanderungen (Mädchen und Knaben getrennt) ersetzten einen Teil der Turnstunden, Handarbeitskurse wurden als Gartenbaukurs geführt . und immer wieder erfolgten Hilfseinsätze unterschiedlichster Art, vorwiegend in der Landwirtschaft. Militärische Einquartierungen verunmöglichten immer wieder die Benutzung der Turnhallen. Auch nahm die Schweiz während einiger Jahre ausländische Ferienkinder auf, die dann für 2 bis 3 Monate in einer hiesigen Familie lebten und hier auch die Schulen besuchten. (Kurt Fillinger, Kreuzlingen 2013: Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Kinder Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 Jana Hottiger PH FHNW Brugg Kinder Jana Hottiger Abb. Jungsozialisten Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg