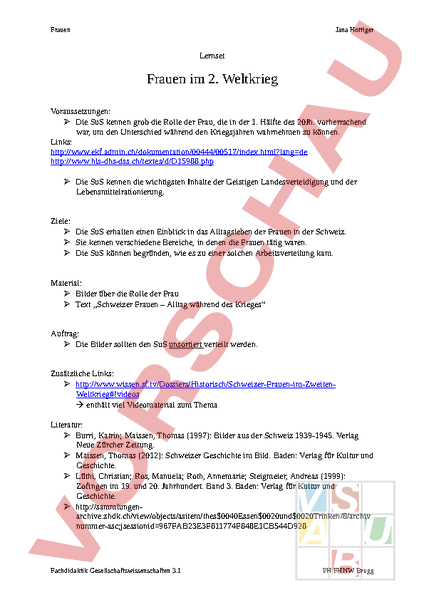Arbeitsblatt: Frauen im 2. Weltkrieg (CH)
Material-Details
Lernset:
Die SuS erarbeiten das Thema anhand von Bildern (Originalquellen).
Geschichte
Neuzeit
8. Schuljahr
11 Seiten
Statistik
133398
883
6
27.08.2014
Autor/in
Jana Hottiger
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Frauen Jana Hottiger Lernset Frauen im 2. Weltkrieg Voraussetzungen: Die SuS kennen grob die Rolle der Frau, die in der 1. Hälfte des 20Jh. vorherrschend war, um den Unterschied während den Kriegsjahren wahrnehmen zu können. Links: Die SuS kennen die wichtigsten Inhalte der Geistigen Landesverteidigung und der Lebensmittelrationierung. Ziele: Die SuS erhalten einen Einblick in das Alltagsleben der Frauen in der Schweiz. Sie kennen verschiedene Bereiche, in denen die Frauen tätig waren. Die SuS können begründen, wie es zu einer solchen Arbeitsverteilung kam. Material: Bilder über die Rolle der Frau Text „Schweizer Frauen – Alltag während des Krieges Auftrag: Die Bilder sollten den SuS unsortiert verteilt werden. Zusätzliche Links: enthält viel Videomaterial zum Thema Literatur: Burri, Katrin; Maissen, Thomas (1997): Bilder aus der Schweiz 1939-1945. Verlag Neue Zürcher Zeitung. Maissen, Thomas (2012): Schweizer Geschichte im Bild. Baden: Verlag für Kultur und Geschichte. Lüthi, Christian; Ros, Manuela; Roth, Annemarie; Steigmeier, Andreas (1999): Zofingen im 19. und 20. Jahrhundert. Band 3. Baden: Verlag für Kultur und Geschichte. nummer-asc;jsessionid967FAB23E3F811774F848E1CB544D928 Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Frauen Jana Hottiger Arbeitsauftrag Frauen im 2. Weltkrieg 1) Lies den Text durch und schlage die Wörter nach, die du nicht verstehst. (EA) 2) Betrachtet die Bilder und unterstreicht im Text die Informationen, die du auf den Bildern findest. (PA) 3) Versucht die Bilder nach den unterschiedlichen Tätigkeiten der Frau zu ordnen. (PA) 4) Beantwortet die folgenden Fragen schriftlich in euer Heft (PA). a. In welchen Bereichen waren die Frauen tätig? b. Betrachtet die Bilder genau: Was hatten sie in den unterschiedlichen Bereichen genau zu tun? c. Überlegt euch, welche Arbeiten auch noch zu den Bereichen gehören könnten, die nicht auf den Bildern gezeigt werden. d. Welche Tätigkeiten mussten die Frauen zusätzlich abdecken, verglichen mit der Zeit vorher (wo kein Krieg war)? e. Weshalb mussten sie so viel arbeiten? f. Wie sieht die Situation heute aus? Was hat sich verändert? Was war ähnlich? Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Frauen Jana Hottiger Schweizer Frauen – Alltag während des Krieges Bereits vor dem Kriegsausbruch 1939 liefen die Vorbereitungen für die Rationierung von Lebensmitteln auf Hochtouren. Die Hausfrauen wurden angewiesen, einen Notvorrat an Lebensmitteln anzuschaffen, der für zwei Monate ausreichen sollte. 1939 wurden dann die Lebensmittelkarten eingeführt, welche eine gerechte Verteilung der verfügbaren Lebensmittel gewährleisten sollten. Die Frau sah sich mit der Rationierung konfrontiert – eine Rationierung, die für beinahe alles galt. So wurden unter anderem auch Textil-, Schuh-, Seifen-, Einmachzucker-, und Brennstoffcoupons herausgegeben. Diese Verknappung von beinahe sämtlichen Gütern des täglichen Bedarfs stellte eine Herausforderung für die Frauen dar, zumal die Rationierung im Verlaufe des Krieges noch strenger wurde. Ideenreichtum war beim Kochen gefragt. Hilfestellung bot zum Beispiel das „Sprechende Menü, eine vom Bund eingerichtete Telefonlinie, über die man Auskünfte über abwechslungsreiche und günstige Menüs bei relativ geringem Gasverbrauch erhalten konnte, an. Lebensmittel konnten aber nicht mehr ausschliesslich im Laden bezogen werden – jeder zweite Haushalt der Nicht-Bauern sicherte sich den Eigenbedarf an Gemüse und Kartoffeln selber. Das alltägliche Leben vieler Schweizer Frauen gestaltete sich durch den Krieg schwieriger. Das Fehlen der Ehemänner, die Aktivdienst leisteten, stellte die Frauen zusätzlich vor eine Herausforderung. Frauen und Mädchen übernahmen häufig Männerarbeit. Viel Verantwortung lastete auf den Schultern der Frauen; eine Last, die durch Angst und Ungewissheit noch grösser wurde. Es gab aber auch Frauen, vor allem junge Frauen, die dem Aufruf der Regierung folgten und sich zum Militärischen Frauenhilfsdienst (FHD) meldeten. „Schweizer Frauen, die Heimat braucht euch dringend. Meldet euch zum Militärischen Frauenhilfsdienst, liess die Regierung verlauten, als die Armee auf mehr Hilfskräfte angewiesen war. Dieser Aufruf kam vielen jungen Schweizerinnen, die das Bedürfnis hatten aktiv für ihr Land im Dienst zu sein, gelegen – ein Bedürfnis, das sehr verbreitet war, wie die Mitgliedszahlen des FHDs ausweisen. Während dem Zweiten Weltkrieg dienten 23‘000 Schweizerinnen in der Armee. Der Militärische Frauenhilfsdienst deckte Bereichen der Gesundheit, Verwaltung, Übermittlung, Transport, Fürsorge, Motorwagendienst, Fliegerbeobachtung, Küche und Feldpost ab. Dadurch standen mehr Männer für die Kampftruppen zur Verfügung. Es galt die gleiche militärische Disziplin wie bei den Soldaten, was die Frauen bereits früh morgens zum Appell antreten liess. Es wurde Sport getrieben und gesungen, die Frauen wurden ihren Fähigkeiten entsprechend den verschiedenen Einsatzgebieten des FHDs zugeteilt. Manche leisteten wertvolle Mithilfe im Sanitätsdienst, andere arbeiteten im administrativen Bereich der Armee und waren so zum Beispiel für das Postwesen des Generalstabes zuständig, wieder andere betätigten sich als Späherinnen. Den Frauen wurde auch ein kleiner Sold zugestanden. Neben dem Militärischen Frauenhilfsdienst wurde auch der zivile FHD geschaffen. Jene Frauen arbeiteten z.B. für Kriegswäscherei und Soldatenfürsorge. Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Frauen Jana Hottiger Auf dem Acker Abb. Kartoffelernte, Zofingen zwischen 1942 und 1945 (Lüthi 1999) Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Frauen Jana Hottiger Hausfrau Abb. Einkauf mit Lebensmittelmarken, 1944 (Maissen 2012) Abb. Werbeplakat Das sprechende Menu, 1943 (Männer)Berufe Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Frauen Jana Hottiger Abb. Schuhladen (Burri 1997) Soldatenfürsorge Abb. Soldatenwäsche, 1941 (Burri 1997) Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 Abb. Soldatenwäsche, 1941 (Burri 1997) PH FHNW Brugg Frauen Jana Hottiger Abb. Der Wäschesack, 1944 (Burri 1997) Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Frauen Jana Hottiger Nähatelier Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Frauen Jana Hottiger Medizinische Betreuung Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Frauen Jana Hottiger Militärischer Frauenhilfsdienst (FHD) Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg Frauen Jana Hottiger LÖSUNGSVORSCHLAG Schweizer Frauen – Alltag während des Krieges Bereits vor dem Kriegsausbruch 1939 liefen die Vorbereitungen für die Rationierung von Lebensmitteln auf Hochtouren. Die Hausfrauen wurden angewiesen, einen Notvorrat an Lebensmitteln anzuschaffen, der für zwei Monate ausreichen sollte. 1939 wurden dann die Lebensmittelkarten eingeführt, welche eine gerechte Verteilung der verfügbaren Lebensmittel gewährleisten sollten. Die Frau sah sich mit der Rationierung konfrontiert – eine Rationierung, die für beinahe alles galt. So wurden unter anderem auch Textil-, Schuh-, Seifen-, Einmachzucker-, und Brennstoffcoupons herausgegeben. Diese Verknappung von beinahe sämtlichen Gütern des täglichen Bedarfs stellte eine Herausforderung für die Frauen dar, zumal die Rationierung im Verlaufe des Krieges noch strenger wurde. Ideenreichtum war beim Kochen gefragt. Hilfestellung bot zum Beispiel das „Sprechende Menü, eine vom Bund eingerichtete Telefonlinie, über die man Auskünfte über abwechslungsreiche und günstige Menüs bei relativ geringem Gasverbrauch erhalten konnte, an. Lebensmittel konnten aber nicht mehr ausschliesslich im Laden bezogen werden – jeder zweite Haushalt der Nicht-Bauern sicherte sich den Eigenbedarf an Gemüse und Kartoffeln selber. Das alltägliche Leben vieler Schweizer Frauen gestaltete sich durch den Krieg schwieriger. Das Fehlen der Ehemänner, die Aktivdienst leisteten, stellte die Frauen zusätzlich vor eine Herausforderung. Frauen und Mädchen übernahmen häufig Männerarbeit. Viel Verantwortung lastete auf den Schultern der Frauen; eine Last, die durch Angst und Ungewissheit noch grösser wurde. Es gab aber auch Frauen, vor allem junge Frauen, die dem Aufruf der Regierung folgten und sich zum Militärischen Frauenhilfsdienst (FHD) meldeten. „Schweizer Frauen, die Heimat braucht euch dringend. Meldet euch zum Militärischen Frauenhilfsdienst, liess die Regierung verlauten, als die Armee auf mehr Hilfskräfte angewiesen war. Dieser Aufruf kam vielen jungen Schweizerinnen, die das Bedürfnis hatten aktiv für ihr Land im Dienst zu sein, gelegen – ein Bedürfnis, das sehr verbreitet war, wie die Mitgliedszahlen des FHDs ausweisen. Während dem Zweiten Weltkrieg dienten 23‘000 Schweizerinnen in der Armee. Der Militärische Frauenhilfsdienst deckte Bereichen der Gesundheit, Verwaltung, Übermittlung, Transport, Fürsorge, Motorwagendienst, Fliegerbeobachtung, Küche und Feldpost ab. Dadurch standen mehr Männer für die Kampftruppen zur Verfügung. Es galt die gleiche militärische Disziplin wie bei den Soldaten, was die Frauen bereits früh morgens zum Appell antreten liess. Es wurde Sport getrieben und gesungen, die Frauen wurden ihren Fähigkeiten entsprechend den verschiedenen Einsatzgebieten des FHDs zugeteilt. Manche leisteten wertvolle Mithilfe im Sanitätsdienst, andere arbeiteten im administrativen Bereich der Armee und waren so zum Beispiel für das Postwesen des Generalstabes zuständig, wieder andere betätigten sich als Späherinnen. Den Frauen wurde auch ein kleiner Sold zugestanden. Neben dem Militärischen Frauenhilfsdienst wurde auch der zivile FHD geschaffen. Jene Frauen arbeiteten z.B. für Kriegswäscherei und Soldatenfürsorge. Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften 3.1 PH FHNW Brugg