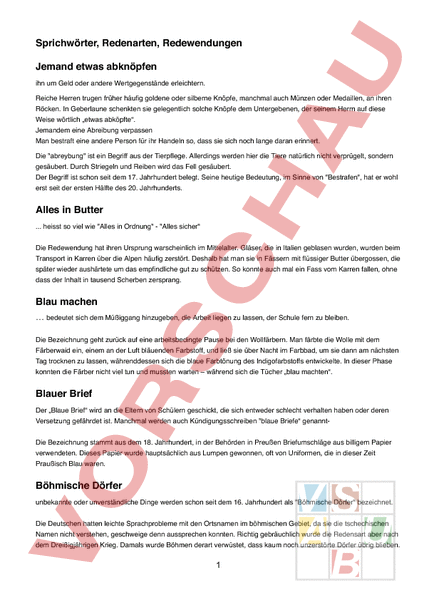Arbeitsblatt: Sprichwörter, Redewendungen, Redensarten
Material-Details
Sprichwörter, Redewendungen, Redensarten der deutschen Sprache mit Erklärungen
Deutsch
Wortschatz
9. Schuljahr
16 Seiten
Statistik
135114
1118
11
13.08.2014
Autor/in
Alexander Mori
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Sprichwörter, Redenarten, Redewendungen Jemand etwas abknöpfen ihn um Geld oder andere Wertgegenstände erleichtern. Reiche Herren trugen früher häufig goldene oder silberne Knöpfe, manchmal auch Münzen oder Medaillen, an ihren Röcken. In Geberlaune schenkten sie gelegentlich solche Knöpfe dem Untergebenen, der seinem Herrn auf diese Weise wörtlich „etwas abköpfte. Jemandem eine Abreibung verpassen Man bestraft eine andere Person für ihr Handeln so, dass sie sich noch lange daran erinnert. Die abreybung ist ein Begriff aus der Tierpflege. Allerdings werden hier die Tiere natürlich nicht verprügelt, sondern gesäubert. Durch Striegeln und Reiben wird das Fell gesäubert. Der Begriff ist schon seit dem 17. Jahrhundert belegt. Seine heutige Bedeutung, im Sinne von Bestrafen, hat er wohl erst seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Alles in Butter . heisst so viel wie Alles in Ordnung Alles sicher Die Redewendung hat ihren Ursprung warscheinlich im Mittelalter. Gläser, die in Italien geblasen wurden, wurden beim Transport in Karren über die Alpen häufig zerstört. Deshalb hat man sie in Fässern mit flüssiger Butter übergossen, die später wieder aushärtete um das empfindliche gut zu schützen. So konnte auch mal ein Fass vom Karren fallen, ohne dass der Inhalt in tausend Scherben zersprang. Blau machen bedeutet sich dem Müßiggang hinzugeben, die Arbeit liegen zu lassen, der Schule fern zu bleiben. Die Bezeichnung geht zurück auf eine arbeitsbedingte Pause bei den Wollfärbern. Man färbte die Wolle mit dem Färberwaid ein, einem an der Luft bläuenden Farbstoff, und ließ sie über Nacht im Farbbad, um sie dann am nächsten Tag trocknen zu lassen, währenddessen sich die blaue Farbtönung des Indigofarbstoffs entwickelte. In dieser Phase konnten die Färber nicht viel tun und mussten warten – während sich die Tücher „blau machten. Blauer Brief Der „Blaue Brief wird an die Eltern von Schülern geschickt, die sich entweder schlecht verhalten haben oder deren Versetzung gefährdet ist. Manchmal werden auch Kündigungsschreiben blaue Briefe genanntDie Bezeichnung stammt aus dem 18. Jahrhundert, in der Behörden in Preußen Briefumschläge aus billigem Papier verwendeten. Dieses Papier wurde hauptsächlich aus Lumpen gewonnen, oft von Uniformen, die in dieser Zeit Praußisch Blau waren. Böhmische Dörfer unbekannte oder unverständliche Dinge werden schon seit dem 16. Jahrhundert als Böhmische Dörfer bezeichnet. Die Deutschen hatten leichte Sprachprobleme mit den Ortsnamen im böhmischen Gebiet, da sie die tschechischen Namen nicht verstehen, geschweige denn aussprechen konnten. Richtig gebräuchlich wurde die Redensart aber nach dem Dreißigjährigen Krieg. Damals wurde Böhmen derart verwüstet, dass kaum noch unzerstörte Dörfer übrig blieben. 1 Als Böhmisches Dorf galt daher auch etwas, das es eigentlich nicht mehr gab. Böses im Schilde wer „Böses im Schilde führt, verfolgt einen schlimmen Plan und hat etwas Böses vor. Da die alten Rittersleut durch ihre Visiere schlecht zu erkennen waren, musste man sie an den Wappen auf ihren Schilden identifizieren. Ein Feind führte demnach Böses im Schilde. Bratkartoffelverhältnis Bezeichnet die „wilde Ehe – das eheähnliche Verhältnis ohne Trauschein. Der Ausdruck stammt noch aus dem ersten Weltkrieg und bezeichnete damals eine kurzfristige Liebesbeziehung, die besonders wegen der besseren Verpflegungsverhältnisse eingegangen wird. Buch mit sieben Siegeln Wenn etwas nur schwer zu erklären ist und geheimnisvoll bleibt, so ist dies ein „Buch mit sieben Siegeln Das Buch mit sieben Siegeln ist ein Begriff aus der Bibel, welcher der Offenbarung des Johannes entstammt, Kapitel 5, Vers 1. Dort heißt es: „Und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle; sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Dem Bericht in den folgenden Bibelversen nach, ist kein Mensch auf der Erde und kein Engel im Himmel für Gott würdig, die Siegel der Buchrolle zu öffnen. Die volle Breitseite abbekommen Jemand, der ungebremsten, schonungslosen Attacken ausgesetzt wird, kriegt bekanntlich die volle Breitseite ab. Der Begriff stammt aus dem vielseitigen Sprachschatz der Kriegsmarine, als die Kanonen eines Schiffes noch unter Deck aufgestellt waren. Eine Breitseite (Englisch: broadside) bezeichnet das gleichzeitige Abfeuern aller Geschütze auf der dem Gegner zugewandten Seite des Schiffes. Wie ein Berserker wüten Wer wie ein Berserker wütet, zerstört ohne Rücksicht auf Verluste. Im Altnordischen beizeichnete man jemanden voller ungezügelter Angriffswut als Berserker. Eigentlich meinte man damit anfangs nur das Bärenhemd, das der durchschnittliche skandinavische Krieger trug (serkr Hemd, ber Bär). Die Recken wollten damit die Kraft des getöteten Tieres auf sich übertragen. Gelungen ist es ihnen am ehesten mit dem Gestank. Allerdings ist auch eine etwas andere Herleitung möglich, und zwar aus den Begriffen ber bar, bloß und serkr Hemd, Waffenrock, also jemand der ohne Hemd, d. h. ohne Rüstung, in den Kampf zieht. Jemandem einen Denkzettel verpassen Als Denkzettel bezeichnet man entweder eine Strafe, die eine Person zum Nachdenken bringen soll oder aber eine unangenehme Erfahrung, die jemandem als Lehre dient oder dienen sollte (einen Denkzettel bekommen). 2 Das Wort stammt aus dem Rechtsvokabular des Mittelniederdeutschen denkcëdel, was so viel wie Urkunde oder schriftliche Nachricht aber auch Vorladung bedeutete. Im 16. Jahrhundert hängte man Schülern in den Klosterschulen und anderen Ausbildungsstätten bei mehrmaligen Vergehen gegen die Ordnung des jeweiligen Instituts so genannte Schandzettel an einer Schnur um den Hals, auf denen die Vergehen gelistet waren. Je nach Art der Verfehlung hatten die Schüler diese Denkzettel mehrere Tage bei ihren Freigängen und während des Unterrichts zum Gespött der Mitschüler (auf dem Rücken) zu tragen. Daraus leitet sich der heutige Sinn des Begriffs Denkzettel, eine (auch körperliche) Strafe zur Erinnerung, ab. Keinen Deut wert sein Eine Sache, die keinen Deut wert ist, wird sehr gering geschätzt. „Seine Meinung ist mir keinen Deut wert heißt also, dass man kein Interesse an den Worten hat. Ein Deut, oder niederländisch Duit, ist eine Münze, die seit dem 14. Jahrhundert bis zum Ende des 18. Jahrhunderts geprägt wurde. Sie war anfangs aus Silber, dann ließ man nach und nach immer mehr Silber weg und ersetzte es durch ein billigeres Material. Ab 1573 bestand sie dann nur noch aus Kupfer. Den Faden verlieren Jemand hat den Faden verloren bedeutet, dass jemand eine Argumentationskette nicht zu Ende führen kann oder sich nicht mehr erinnert, was er zuletzt gesagt hat. Bezieht sich auf den Ariadnefaden. Der Ariadnefaden war der griechischen Mythologie zufolge ein Geschenk der Prinzessin Ariadne an Theseus. Mit Hilfe des Fadens fand Theseus den Weg durch das Labyrinth, in dem sich der Minotaurus befand. Nachdem Theseus den Minotaurus getötet hatte, konnte er mit Hilfe des Fadens das Labyrinth wieder verlassen. Farbe bekennen Farbe bekennen ist eine deutsche Redensart und bedeutet so viel wie: sich zu einer Sache bekennen oder seine Meinung offen sagen. Der Ausdruck kommt aus dem Bereich des Kartenspiels und ist seit dem 18. Jahrhundert gebräuchlich. In verschiedenen Kartenspielen, zum Beispiel Doppelkopf, müssen beim Anspielen einer Karte die Mitspieler eine Karte der gleichen Farbe spielen. Die Mitspieler müssen also bekennen, dass sie diese Farbe auf der Hand hatten. Fersengeld Wer Fersengeld gibt macht sich aus dem Staub, das heißt, er flüchtet. Die Redewendung ist zwar seit dem 13. Jahrhundert bezeugt, ihre Herkunft hingegen ist unklar. Eine mögliche Herkunft ließe sich aus dem Sachsenspiegel herleiten, wo das Verlassen des Mannes bei den Wenden durch die Ehefrau mit der Zahlung eines versne pennige abgegolten werden konnte. Nach anderer Ansicht könnte sich hier der alemannische Rechtsbrauch des Strafgeldes für Flüchtlinge aus der Schlacht widerspiegeln, da man von diesen nur noch die Fersen zu sehen bekam. Fuchsteufelswild Fuchsteufelswild ist jemand, der aufs höchste aufgebracht, wütend ist. 3 Das Adjektiv fuchswild ist schon im 16. Jahrhundert belegt (unter anderem bei Hans Sachs). Auf eine Erklärung verzichtet das Wörterbuch, es liegt aber nahe, an das wilde Verhalten eines Fuchses, der tollwütig ist oder sich aus einer Falle zu befreien versucht, zu denken. Fuchsteufelswild ist eine Verstärkung und Versteigerung von fuchswild. Wer fuchsteufelswild ist, wäre geradezu teuflisch fuchswild. Ins Fettnäpfchen treten Umgangssprachlich bedeutet die Redewendung: unabsichtlich jemandes Unwillen erregen, es mit jemandem verderben. Die Wendung „keinen Fettnapf auslassen meint, dass man von einem Fauxpas in den nächsten stolpert und falsch macht, was nur falsch zu machen ist. Die Redewendung Ins Fettnäpfchen oder in den Fettnapf treten bezieht sich auf den Umstand, dass früher in Bauernhäusern (in der Nähe des Ofens) für die Eintretenden ein Topf mit Stiefelfett stand. Damit konnten sie sogleich die nass gewordenen Stiefel einreiben. Wer nun versehentlich in den Topf mit dem Fett trat und Flecken auf den Dielen machte, verärgerte damit naturgemäß die Hausfrau. Ach du grüne Neune Die Redewendung „Ach du grüne Neune! als Ausruf der Verwunderung oder des Erschreckens bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Übertragung der französischen Spielkarten auf das deutsche Blatt. Die Pik-Neun entspricht der Gras-Neun, also dem Grünen Neuner bzw. der Grünen Neune. Beim Kartenlegen gilt die Pik Neun traditionell als Karte, die nichts Gutes verheißt (schwere Unannehmlichkeiten, Krankheit, Vermögensverluste). Als alternative Erklärung wird häufig die im Volksmund verbreitete Bezeichnung Grüne Neune für das Vergnügungslokal Conventgarten in Berlin (Blumenstraße 9 mit Haupteingang am Grünen Weg) angeführt, das ab Mitte des 19. Jahrhundert immer stärker ins Zwielicht geriet. Ein Geschäft machen . meint liebevoll den Gang zur Toilette. Warum verbinden wir den Gang zum stillen Örtchen mit der Redewendung Ein Geschäft machen? Tja, weil es früher so war. Im alten Rom traf man sich in den öffentlichen Toiletten und machten unter anderem auch gute Geschäfte. Ins Gras beißen ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für „sterben. Ins Gras beißen mussten Krieger, die verwundet auf dem Schlachtfeld lagen. Man konnte nach der Schlacht oft feststellen, dass die Sterbenden vor Schmerzen in den Untergrund gebissen hatten. Im Englischen sagt man dazu to bite the dust und französisch heißt es mordre la poussière, was beides in den Staub beißen bedeutet. Belegt ist das Grasbeißen bereits seit der Antike, wo in der Ilias (2, 418) und in der Aeneis (11, 118) davon gesprochen wird, dass die Helden im Todeskampf ins Gras bissen. (Quelle: Duden 11, 1992, 273) 4 Auf den Hund gekommen . Früher haben Könige und Fürsten auf den Grund der Schatztruhe ein Beschützer- Tier gemalt, welches den Reichtum schützen sollte. War einmal alles Geld ausgegeben und die Truhe leer, so sah man den Hund und war leider auf den Hund gekommen. Da liegt der Hund begraben Wenn man plötzlich hinter einer Geschichte etwas ganz Neues entdeckt und plötzlich der Hintergrund oder ein Vorhaben, welches verschleiert war, völlig klar wird, weiß man „wo der Hund begraben liegt. Diese Redewendung hat nichts mit dem Haustier zu tun, sondern kommt vielmehr vom mittelhochdeutschen hunde, das Beute, Raub, Schatz bedeutet, also somit: „Da also liegt der Schatz begraben. Die Hand ins Feuer legen Man legt für jemanden die „Hand ins Feuer, wenn man für ihn bürgt, wenn man ganz sicher ist, das es sich um einen guten Menschen handelt. Stammt noch aus dem Mittelalter. Bei einem mittelaterlichen Gottesurteil musste der Angeklagte eine Zeitlang die Hand ins Feuer halten; der Grad der Verbrennung entsprach dem Grad des Verschuldens. Wunden wurden stets sofort verbunden. Als unschuldig hat nur der gegolten, der in kürzester Frist wiederhergestellt war. Haare auf den Zähnen haben Wenn jemand Haare auf den Zähnen hat, ist diese Person besonders bissig, schroff und oft auch rechthaberisch. Früher galt starke Behaarung als Zeichen großer Männlichkeit, für Kraft und große Couragiertheit. Hat jemand Haare an Stellen an denen gewöhnlich keine wachsen, so sind diese Eigenschaften besonders ausgeprägt. Früher gab es auch die Redensart Haare auf der Zunge haben. Die Wendung wurde dann auf die bissige, schroffe Art einer Frau bezogen. Hals- und Beinbruch Die Redewendung Hals- und Beinbruch stellt eine Verballhornung eines ursprünglich hebräischen Ausdrucks dar und bedeutet eigentlich „Viel Glück als Wunsch an jemanden, dem eine Prüfung oder eine nicht leicht zu bewältigende Aufgabe bevorsteht. Die jiddische Form „Hasloche un Broche des als Glück- und Segenswunsch (besonders bei Geschäftsabschlüssen) benutzten Ausdrucks mit der Bedeutung „Erfolg (Glück) und Segen leitet sich von „hazlacha uwracha aus dem Hebräischen ab von lehazliach gelingen lassen und lewarech segnen). Möglicherweise wurden diese Worte von deutschsprachigen Zuhören als Hals- und Beinbruch verstanden. Die englische Redewende „break leg stammt möglicherweise aus der Übersetzung des deutschen „Hals- und Beinbruch. Hansdampf in allen Gassen Als „Hansdampf in allen Gassen wird umgangssprachlich ein aktiver, vielseitiger und umtriebiger Mensch bezeichnet, ein Tausendsassa bzw. Allerweltskerl. Gelegentlich ist die Bezeichnung jedoch auch abwertend gemeint, im Sinne von Unruhestifter und „Tunichtgut. Weiterhin werden Personen, die etwas ungestüm und dabei ungeschickt sind, als 5 Hansdampf bezeichnet. In englischsprachigen Ländern ist der „Jack of all trades das Pendant zum „Hansdampf in allen Gassen. Will man ihn heutzutage jedoch negativ darstellen, erweitert man den Begriff einfach auf seine ursprüngliche Form: „Jack of all trades – and master of none. Neuerdings versteht man darunter auch eine Person, die glaubt, über alles Bescheid zu wissen. Von seiner Umwelt wird der Hansdampf daher manchmal als Besserwisser wahrgenommen. Der Name Hans (von Johannes) war im 16. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum so häufig, dass er sprichwörtlich „in jeder Gasse zu finden war Hinter die Ohren schreiben „Schreib dir das hinter die Ohren bedeutet, derjenige solle sich etwas gut merken. Die Aufforderung, man solle sich etwas hinter die Ohren schreiben, wird heute meistens im Zusammenhang mit einer Rüge oder Standpauke verwendet. Die Redewendung geht auf einen alten Rechtsbrauch zurück: Im Mittelalter hatte man bei wichtigen Regelungen wie z.B. der Festlegung von Grenzen die Kinder der Verhandlungspartner dazu geholt, damit sie notfalls noch in der nächsten Generation als lebende Zeugen aussagen konnten. Damit sie die Lage der Grenzpunkte auch nicht vergaßen, gab man ihnen an jedem Punkt ein paar Ohrfeigen. Man schrieb ihnen also die Position der Grenzpunkte hinter die Ohren. Dieser Brauch ist bereits bei den ripuarischen Franken belegt und soll noch im Bayern des 18. Jahrhunderts ausgeübt worden sein. Noch im 19. Jahrhundert nahm man in Schwaben bei der jährlichen Feldbegehung Knaben mit, denen man an wichtigen Grenzpunkten Ohrfeigen verabreichte, damit sie sich möglichst lange an die Grenzen des Dorfes erinnern können. Jemanden unter die Haube bringen Umgangssprachlich für (Ver)kuppelei und (ver)heiraten. Im Mittelalter und der Frühen Neuzeit verlangte die Norm von verheirateten Frauen das Tragen einer Haube, während unverheiratete ihr Haupt unbedeckt lassen durften. Die Redensart unter die Haube kommen (heiraten) leitet sich davon ab. Die Haube galt als Zeichen der Frauenwürde und der Wohlanständigkeit; eine Frau ohne Haube galt als loses Frauenzimmer. In ganz Europa ist sie fester Bestandteil fast aller Frauentrachten. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ein typischer Satz mit dem jemand seine Unschuld beteuert. Entgegen aller Vermutungen stammt dieses Sprichwort nicht von Bugs Bunny, sondern es handelt sich um einen Ausspruch eines gewissen Jurastudenten Victor Hase, als er 1854 beschuldigt wurde (wohl durch absichtliches Verlieren seines Studentenausweis) einem Kommilitonen, der einen anderen im Duell getötet hatte, die Flucht nach Frankreich ermöglicht zu haben. Seine Aussage (Mein Name ist Hase, ich verneine alle Generalfragen, ich weiß von nichts.) vor dem Universitätsgericht wurde in abgespeckter Form bald sprichwörtlich. 6 Innerer Schweinehund Die Bezeichnung innerer Schweinehund umschreibt oft als Vorwurf die Willensschwäche, die eine Person daran hindert, unangenehme Tätigkeiten auszuführen, die entweder als ethisch geboten gesehen werden (z.B. Probleme anzugehen, sich einer Gefahr auszusetzen etc.), oder die für die jeweilige Person sinnvoll erscheinen (z.B. eine Diät einzuhalten). Der Wortbestandteil Schweinehund ist schon in der Studentensprache des 19. Jahrhunderts als grobes Schimpfwort bekannt und geht auf den zur Wildschwein-Jagd eingesetzten Sauhund zurück. Dessen Aufgaben Hetzen, Ermüden und Festhalten wurden auf die Charaktereigenschaften bissiger Menschen übertragen. Das Wort innerer Schweinehund war bereits im und nach dem 1. Weltkrieg im Gebrauch. Vom 23. Februar 1932 datiert ein Tondokument einer Rede des SPD-Reichtagsabgeordneten Kurt Schumacher, in der er diesen Begriff verwendet. Im Zweiten Weltkrieg war es allgemeines Landserdeutsch und danach bei Trainern und Turnlehrern noch lange in Gebrauch. Das Wort gibt es nur im Deutschen und kann nicht wörtlich übertragen werden. Das sind doch olle Kamellen Wenn jemand Neuigkeiten mitbringt, die schon längst bekannt sind, sagt man „das sind doch olle Kamellen – man weiß dies schon längst. Die Kamellen haben nichts mit Süßigkeiten zu tun, sondern beziehen sich wahrscheinlich auf die Kamillenpflanzen. Wenn man Kamille zu lange lagert gehen Aroma und Heilkraft verloren. Mit den alten Kamillen kann der Apotheker nichts mehr anfangen. Einen Korb bekommen Der Korb ist hier sprichwörtlich eine Abfuhr, die ein liebestoller Jüngling von seiner Angebetenen bekommt, da diese überhaupt kein Interesse an ihm hat. Zu Zeiten als Ritter noch in die Ferne zogen, um Gott und der Welt zu zeigen wofür Ritterrüstungen eigentlich gefertigt wurden, ließen sie nicht selten ihre Burgfräuleins in den damals modischen Wehrtürmen zurück. Die um die Gunst der daheimgebliebenen edlen Fräuleins buhlenden Männer (so war dies Brauch) stellten sich unter das Fenster der Angebeteten um ihrer Liebsten ein Ständchen zu singen. In fast jedem Falle ließ dieses Fräulein (unterstützt durch ihre Dienerschaft) einen Korb vom Turm herunter. War sie ihm wohl gesonnen konnte er oben angelangt sein ganzes Glück in ihren Armen finden. War sie ihm nicht so sehr zugetan, so konnte man auf halber Höhe an dem Seil so lange rütteln bis der Boden des Korbes durchbrach und der Minnediener in die Tiefe stürzte. Nicht lustig aber wahr. Etwas auf dem Kerbholz haben Von diese uralten Zähl- und Buchhaltungstechnik leitet sich die noch heute gebräuchliche Redewendung etwas auf dem Kerbholz haben her. Dies bedeutet im eigentlichen Sinne Schulden haben und übertragen soviel wie sich schuldig gemacht haben. Ein Kerbholz, oder Zählholz, ist eine frühe Zählliste, wobei für jeden einzelnen Vorgang mit dem Messer eine Kerbe in ein dafür geeignetes, längs gespaltenes Holz geschnitten wurde (sogar Knochen wurden wohl schon in der Altsteinzeit – vor 30.000 Jahren – verwendet). Je eine Hälfte wurde dann meist vom Gläubiger und Handelspartner aufbewahrt. An einem bestimmten Termin (Zahltag) wurde das Kerbholz präsentiert, mit dem Gegenstück verglichen und zur Zahlung aufgefordert. 7 In England war es bis ins 19. Jahrhundert üblich Steuerquittungen in Form von Kerbhölzern (exchequer tallies) auszustellen. Im Jahr 1834 wurde dieses altertümliche Verfahren durch eine Steuerreform schließlich abgeschafft. Eine gewaltige Zahl von Kerbhölzern war nun überflüssig geworden und am 16. Oktober 1834 entschloss man sich fahrlässigerweise diese im Hof des Parlamentsgebäudes (Westminster-Palast) zu verbrennen, welches daraufhin selbst von den Flammen des riesigen Feuers erfasst wurde und größtenteils abbrannte. Jemanden auf dem Kieker haben In der heutigen, übertragenen Bedeutung steckt dahinter, dass jemandem genau auf die Finger gesehen wird, in der Hoffnung, dass dieser etwas falsch macht und dann kritisiert werden kann. Ein Kieker ist speziell in Norddeutschland ein Fernrohr oder ein Fernglas. Das Wort ist ein Fremdwort aus der plattdeutschen Sprache. Während es in der eigentlichen Bedeutung nur selten im Hochdeutschen benutzt wird, ist es in der Redewendung „Jemanden auf dem Kieker haben weit verbreitet. Ursprünglich bedeutet diese Redewendung, dass jemand durch ein Fernrohr oder Fernglas genau beobachtet wird. Kind und Kegel „Kind und Kegel bezeichnet die gesamte Familie, Bekannte und Freunde einer Person. Man unternimmt z.B. einen Ausflug mit „Kind und Kegel Der veraltete Begriff „Kegel stammt aus der Ritterzeit und steht dabei für ein uneheliches Die Redewendung Kind und Kegel bedeutete demnach eigentlich alle ehelichen und unehelichen Kinder. Heute steht der Begriff für die gesamte Verwandtschaft oder auch teilweise für Kinder, Haustiere und Gepäck. Wenn jemand mit Kind und Kegel reist, so ist der Ausdruck scherzhaft zu verstehen und derjenige hat die gesamte Familie dabei. Kopf in den Sand stecken Den Kopf in den Sand stecken ist eine Redewendung und bedeutet so viel wie: Eine Gefahr nicht sehen wollen, die Augen vor unangenehmen Realitäten verschließen oder bestimmte Tatsachen einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Bereits im Altertum sagte man dem Vogel Strauß fälschlicherweise nach, dass er bei Gefahr seinen Kopf unter die Flügel oder in den Sand stecke, um so einer Gefahr zu entgehen. Dieses, sich immer noch hartnäckig haltende Gerücht geht darauf zurück, dass, wenn Strauße in ihrer natürlichen Umgebung etwas vom Boden aufheben, ihr Kopf gänzlich hinter dem niedrigen Gras verschwindet, oder dass sie sich in Gefahrensituationen flach auf ihr Nest legen, um es zu tarnen. Dies sieht dann aus gewisser Entfernung so aus, als würde der Strauß seinen Kopf in den Sand stecken. Den Löffel abgeben Die Redewendung den Löffel abgeben wird in der Regel benutzt, um auszudrücken, dass jemand stirbt oder gestorben ist. Die lebenserhaltende und notwendige Tätigkeit des Essens steht bei dieser Redewendung Pate. Ein Ende der Nahrungsaufnahme ist dabei gleichbedeutend mit dem Ende des Lebens. 8 Im Schwarzwald gab es früher die Tradition, dass ein Löffel im persönlichen Besitz war und nach dem Tod nicht weitergegeben, sondern an die Wand des Bauernhauses gehängt wurde. Den Knechten dagegen wurde nicht selten vom Bauern ein Löffel zur Verfügung gestellt, den dieser abgeben musste, wenn er weiterzog oder verstarb. Durch die Lappen gehen . Wenn jemandem etwas „durch die Lappen geht bedeutet dies, dass er etwas verloren hat oder etwas verpasst hat (z.B. ein gutes Geschäft). Früher wurden bei der Treibjagd Tücher und Lappen gespannt, um das Jagdgebiet einzugrenzen. Wenn ein Tier dennoch in der Todesangst „durch die Lappen gegangen ist, dann war es frei und den Jägern durch die Lappen gegangen. Etwas auf die lange Bank schieben „Etwas auf die lange Bank schieben bedeutet, eine möglicherweise sehr schwerwiegende Entscheidung so lange wie irgend möglich hinauszuzögern. Der Ursprung der Redewendung liegt wahrscheinlich im Immerwährenden Reichstag in Regensburg. Die „Lange Bank waren Sitztruhen auf denen die Gesandten etwas abseits des Entscheidungsprozesses warten mussten. Die mitgebrachten Akten wurden in den Truhen verstaut um sie dann später wieder herauszuholen und zu bearbeiten bzw. zur Entscheidung zu bringen. Manchmal dauerte der Prozess so lange, dass die Akten vergessen wurden. Für jemanden eine Lanze brechen . „Die Lanze für jemanden brechen heißt ein gutes Wort für ihn einzulegen – ihn zu beschützen und Kritiker vom Gegenteil zu überzeugen. Dieses Sprichwort hat seinen Ursprung wieder einmal im Mittelalter: beim Lanzenkampf kam es darauf an, die eigene Lanze im vorbeireiten am Körper des Anderen zu brechen. Dafür gab es einen Punkt. Ob der gegnerische Ritter im Sattel blieb oder vom Pferd gestoßen wurde, war uninteressant. War der Ritter verhindert, so konnte ein anderer für ihn einspringen und für ihn eine Lanze brechen. Laufpass Die Redensart jemandem den Laufpass geben stammt aus dieser Zeit und meint jemanden entlassen oder jemanden wegschicken; oft wird die Redensart auch für das Beenden von Beziehungen verwendet oder für die Kündigung von Arbeitsverhältnissen. Laufpass des Landgrafen von Hessen-Darmstadt aus dem Jahr 1792 Einen Laufpass (auch Laufzettel) erhielten Soldaten im 18. Jahrhundert, wenn sie aus dem Militär entlassen wurden. Der Laufpass diente als Nachweis, dass der Inhaber kein Deserteur war. Maulaffen feilhalten Seit dem 15. Jahrhundert wird unter Maulaffe (im 16. Jahrhundert auch Affenmaul) ein Gaffer verstanden, „einer, der mit offenem Maul dasteht und gafft – heute noch gebräuchlich in der Redewendung „Maulaffen feilhalten. Maulaffen oder Gähnaffen waren im Mittelalter tönerne, kopfförmige Halter für Kienspäne, in deren offenes Maul man 9 den Kienspan steckte. Vermutlich liegt dem Ausdruck die mittelalterliche Lebenswirklichkeit zu Grunde: Man klemmte sich bei Arbeiten im Dunkeln, wenn man beide Hände frei haben musste, einen brennenden Kienspan zwischen die Zähne, um ein wenig Beleuchtung zu haben. Gewöhnlich wurde der Kienspan aber auf einem Tonklotz abgelegt und es war wohl naheliegend solchen Tonklötzen das Aussehen menschlicher Gesichter zu geben und den Span in deren ausgearbeiteten Mund zu klemmen. Milchmädchenrechnung Von einer Milchmädchenrechnung wird gesprochen, wenn der noch ausstehende Ertrag bereits für künftige Vorhaben verplant wird, obwohl die Erreichung des Ertrages noch nicht gesichert ist. In einem erweiterten Sinn bezeichnet man damit Vorstellungen, die auf (eventuell bewusst geführten) Trugschlüssen beruhen. Der Begriff geht vermutlich auf die Fabel Die Milchfrau von Johann Wilhelm Ludwig Gleim zurück. Erzählt wird die Geschichte einer Bauersfrau, die sich auf dem Weg zum Markt bereits vorstellt, was mit dem Erlös für die Milch alles machbar wäre, dann aber die Milch verschüttet. Eine andere Herkunftserklärung ist die folgende: Zu der Zeit, als Milch noch in Kannen von Bauernhöfen geholt wurde, sagte man einigen Milchmädchen (Milchverkäuferinnen) nach, die Kannen mit Wasser aufzufüllen, wenn die Milch knapp wurde. Da sie natürlich dennoch die volle Summe als Geldbetrag veranschlagten, entwickelte sich der Begriff Milchmädchenrechnung. Die erste Herkunftserklärung zielt insbesondere auf den Aspekt des Selbstbetruges ab, während letztere einen Betrug gegenüber anderen ausdrückt. Als Prügelknabe herhalten Wenn etwas ungeschicktes passiert, wird häufig ein „Schuldiger gesucht, auf den die ganze Schuld geschoben wird. Derjenige muss dann „als Prügelknabe herhalten, obwohl er selber keine Schuld trägt. An jungen Edelleuten durfte früher die an sich verdiente Prügelstrafe nicht vollzogen werden. An ihrer Stelle mussten arme Kinder, die für diesen Zweck gehalten wurden, die Schläge auf sich nehmen. Die wirklich Schuldigen mussten der Prozedur zusehen, die von Rechts wegen ihnen galt. Jemandem etwas vom Pferd erzählen bedeutet ihm Lügengeschichten aufzutischen. Einst belagerten die Griechen Troja. Um Truppen in die belagerte Stadt einzuschleusen bauten sie das berühmte Trojanische Pferd, in dessen hohlem Körper sich Soldaten versteckten. Die Trojaner waren sich nicht ganz einig, was sie mit dem Gaul, der als ein Opfergeschenk der abgezogenen Griechen an die Göttin Athene angesehen wurde, tun sollten. Dann fanden sie einen Mann, der dem König vorgesetzt wurde, und erzählte, Odysseus habe ihn als Opfer zurückgelassen. Dieser Mann war aber von Odysseus zurückgelassen worden, um dem Trojanern vom Pferd zu erzählen. Er tischte ihnen also eine dreiste Lüge auf und die gutgläubigen Trojaner schafften das Holzpferd in die Stadt. Der Rest ist Geschichte. Persilschein Einen Persilschein zu besitzen oder zu erhalten, bedeutet eine weitreichende Erlaubnis, einen Freibrief, um einem lukrativen Geschäft oder einem zuvor moralisch oder rechtlich angezweifelten Interesse nachgehen zu können. 10 Der Begriff entstammt dem militärischen Sprachgebrauch und ist auf das Waschmittel Persil zurückzuführen. So war es üblich, dass Rekruten einen leeren Karton (oft mit einem Werbe-Aufdruck des weit verbreiteten Waschmittels Persil) für die Rücksendung ihrer Zivilkleidung an ihre Familie zur Kaserne mitbringen mussten. Im Soldatenjargon wurde so aus dem eigentlichen Gestellungsbefehl der Ausdruck Persilschein. Im späteren Sprachgebrauch wurde die Bedeutung des Begriffes Persilschein (in etwa der Bedeutung von Freibrief) auch verallgemeinert für Formulare und Bescheinigungen verwendet, deren Nutzen umstritten sind bzw. deren Beschaffung kein Problem darstellt. Pferdefuß Im deutschen Sprachgebrauch versteht man in der Regel unter einem „Pferdefuß unerwünschte bis unangenehme, z. T. versteckte Begleiterscheinungen bei Vereinbarungen oder Verträgen, die aber in Kauf genommen werden (müssen), da es die Sache nur im Paket mit dem Pferdefuß gibt. In der christlichen Glaubensvorstellung tritt der Teufel immer wieder als Verführer der Menschen auf, um sich ihre Seelen zu sichern. Dies geschieht oftmals durch Verträge, die den Betreffenden allerlei Annehmlichkeiten zusichern, aber ihnen auch Bestimmtes verbieten bzw. gänzlich nach dem Tod die Seele dem Teufel übermacht. Volkstümlich wird ab dem Spätmittelalter der Teufel häufig mit (zumindest) einem Pferdefuß dargestellt. Dies leitet sich aus der Tradition des griechischen Gottes Pan ab, der ebenfalls den Menschen gegenüber als Verführer und Verwirrer auftrat. Der Teufel tritt in vielen Sagen verkleidet auf und wird dann oftmals durch seinen hervorlugenden Pferdefuß entlarvt. Dies hat Eingang in den Sprachgebrauch gefunden, um eine Täuschung zu bezeichnen: Die Sache hat einen Pferdefuß die so bezeichnete Abmachung enthält eine versteckte Falle oder einen unschönen Nebeneffekt Synonym: Die Sache hat einen Haken. Pustekuchen Der Ausruf Pustekuchen bedeutet soviel wie „von wegen oder „mit mir nicht. Der Begriff kommt aus dem Jiddischen wo die Redewendung „Ja cochem verwendet wird. Im frühen 19. Jahrhundert war es in Berlin üblich, die abgewandelte, eingedeutschte Form „Ja Kuchen, womit man „Das ist ja Quatsch bzw. Ich bin anderer Meinung meinte. Aus „cochem war Kuchen geworden, und später benutzte man nur noch die Kurzversion „Kuchen, die im Laufe der Zeit dann mit „Puste vereint zum heute gebräuchlichen „Pustekuchen wurde, was sich als ein Kuchen, aber aus Puste (heiße Luft) verstehen ließ und den ursprünglichen Sinn weiter trug. Von Pontius bis Pilatus laufen bedeutet erfolglos von einem zum anderen laufen. Die Redensart existiert nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und den Niederlanden und ist seit 1704 literarisch belegt. Den Ursprung hat sie in der biblischen Ostergeschichte Jesus wurde von Pilatus zu Herodes und zurück geschickt. In ländlichen Passionsspielen waren auf der Bühne das Haus von P. Pilatus auf der einen, der Palast von Herodes auf der anderen Seite. Das Hin und Her wurde dabei sehr deutlich. In manchen Regionen (z.B. in Dänemark) sagt man übrigens auch einen von Herodes zu Pilatus schicken. Pech gehabt Zur Lagerung von Bier und Wein wurden die Holzfässer früher mit flüssigem Pech ausgestrichen, um sie zu imprägnieren. Je leerer das Fass wurde, desto brüchiger wurde das Pech auf dem Holz. In die letzten Gläser mischten sich dann häufig kleine Pech-Klumpen und machten das Gesöff ungenießbar. Somit hatte man dann eben Pech 11 gehabt. Aus dem Schneider sein Die Redensart Aus dem Schneider sein bedeutet „von allen Sorgen und Schwierigkeiten befreit sein. Der Ausdruck stammt vom Kartenspiel, z. B. Schafkopf und Skat, wo diejenigen Schneider werden, die weniger als dreißig Augen (Punkte), d.h. weniger als die Hälfte der zum Gewinn nötigen Summe erreichen. (Umgekehrt ist man mit mehr als 30 Schneider frei.) Bei jemandem einen Stein im Brett haben . bedeutet man hat noch etwas gut bei dem Anderen, er ist einem wohlgesonnen und wird freundschaftlich unterstützend wirken. Die Redewendung ist schon ziemlich alt. Einen ersten Beleg findet man in Joh. Agricolas Sprichwörtersammlung von 1529. Ich hab eyn guten steyn im brette. Ursprung der Redensart ist ein Brettspiel: das Puffspiel oder auch Tricktrack. Im Spiel hat derjenige einen guten Stein im Brett, der zwei nebeneinander liegende Felder mit seinen Steinen belegt hält, da er dem Mitpieler das Gewinnen erschwert. Ein guter Freund, der einem zur Seite steht wird metaphorisch als guter Stein im Brett bezeichnet Das kommt mir spanisch vor Diese Redewendung besagt, dass jemandem ein Sachverhalt merkwürdig bzw. seltsam erscheint. Wahrscheinlich stammt sie aus der Zeit, als Karl V., der in Spanien aufgewachsen war, deutscher Kaiser wurde. Viele spanische Sitten waren bis dahin unbekannt und wurden zum Teil auch als unerhört empfunden. Im Simplicissimus findet sich folgender literarischer Beleg: »Bei diesem Herrn kam mir alles widerwärtig und fast spanisch vor . Interessant ist vielleicht, zu wissen, dass das spanische Gegenstück zu dieser Redewendung »esto me suena chino« lautet – »das kommt mir chinesisch vor«, im Englisch sagt man aus ähnlichem Anlass: It Greek to me! Es kommt mir griechisch vor. Etwas in den Sand setzen Ein begonnenes Vorhaben kann nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Bei mittelalterlichen Turnieren war es das Ziel, den Gegner aus dem Pferdesattel in den Sand der Wettkampfarena zu stoßen, d.h. ihn in den Sand zu setzen. Herein, wenns kein Schneider ist . Gern gesagter Spruch nach dem Klopfen an der Tür Dabei geht es im ursprünglichen nicht um den Schneider, sondern um den „Schnitter, den „Sensenmann – und den möchte nun wirklich keiner im Haus haben. Mein lieber Scholli Der Ausdruck „Mein lieber Scholli ist eine umgangssprachliche Redewendung, mit der im Allgemeinen eine gewisse Überraschung ausgedrückt wird, im positiven oder im negativen Sinne. 12 Zur Entstehung der Redewendung gibt es zwei Theorien: Eine Möglichkeit ist die Herleitung von dem französischen Adjektiv „joli, das hübsch bedeutet. Dann wäre Mein lieber Scholli eine eingedeutschte Form mit der Bedeutung von „Na, mein Hübscher, da hast du dir was geleistet oder so ähnlich. Die andere Theorie besagt, dass Scholli auf eine reale Person zurückgeht, nämlich auf den Österreicher Ferdinand Joly (1765-1823). Er wurde 1783 von der Universität in Salzburg verwiesen der Grund ist nicht überliefert. Danach soll er ein sehr unstetes Leben geführt und gewisse Eigenheiten kultiviert haben. Er war also gewissermaßen ein Original, und zumindest in Österreich zu Lebzeiten kein Unbekannter. Sauregurkenzeit Sauregurkenzeit (auch Saure-Gurken-Zeit) nennt man unter Geschäftsleuten scherzhaft die Zeit des Hochsommers, in der die meisten Leute Ferien machen und daher stille Geschäftszeit herrscht. Die Herkunft des seit dem späten 18. Jahrhundert aus Berlin belegten Begriffs ist unklar. Eine häufige Erklärung verbindet ihn nahe liegend mit dem spätsommerlichen, also in die Ferienzeit fallendem Angebot frisch eingelegter saurer Gurken. Schema Umgangssprachlich spricht man von Schema F, wenn etwas bürokratisch-routinemäßig, stereotyp, mechanisch oder gedankenlos abläuft. Der Ausdruck geht zurück auf die Vordrucke für die im preußischen Heer seit 1861 vorgeschriebenen so genannten Frontrapporte, auszufüllende Berichte über den Bestandsnachweis der vollen Kriegsstärke. Diese Vordrucke waren mit dem Buchstaben F gekennzeichnet. Bei der Kontrolle der Truppenstärke mussten diese genau mit den Angaben im Vordruck übereinstimmen. Schlawiner Schlawiner (andere Formen: Schlawuzi, Schlawak) ist eine salopp abschätzige Bezeichnung für einen gerissenen oder durchtriebenen Menschen, aber auch für ein fröhliches und listiges Kind. Es wird auch synonym für Schlitzohr verwendet. Im Süddeutschen werden auch pfiffige und durchtriebene Burschen damit bezeichnet. Sprachlich abgeleitet wurde es von Slowene oder Slawonier. Aus Slowenien stammende Hausierer galten in früheren Zeiten als besonders schlau und geschäftstüchtig. Schlitzohr Als „Schlitzohr bezeichnet man einen listigen und durchtriebenen Menschen. Eine verbreitete Art des Schandmals war das Schlitzen der Ohrmuschel, das möglicherweise daher rührt, dass es in einigen Zünften üblich war, ausgestoßenen Mitgliedern den Zunftohring auszureißen. Eine andere Herkunft könnte das Schlitzen im Kennzeichnen mittelalterlicher Spione haben. Ihnen wurde ein Nagel durch das Läppchen getrieben und dann herausgerissen. (Es wird auch behauptet, dass jemandem, der beim Lauschen an einer Tür ertappt wurde, die Ohrmuschel daran genagelt wurde. Folglich musste er sich irgendwann losreißen. Eine weitere Erzählung lautet, dass Bäcker, welche zu kleine Brötchen backten, ans Kirchentor genagelt wurden und sich eben nur durch einen gewagten Ruck wieder befreien konnten) 13 Al Capone ließ Abweichlern die Ohren beziehungsweise die Nase abschneiden, um sie zu stigmatisieren. Schwarzes Schaf Mit dem Ausdruck schwarzes Schaf bezeichnet man in der Regel einen Außenseiter. Im übertragenen Sinn werden Familienangehörige oder Freunde im Bekanntenkreis, die auf die schiefe Bahn geraten sind oder hinter den anderen ewig hinterher hinken, als schwarze Schafe (der Familie) bezeichnet. Bei der Schafzucht galt die Wolle der weißen Schafe wertvoller, da sie einfacher zu färben ist. Ein schwarzes Schaf dagegen senkte die Wollqualität und wurde in der Zucht wenn möglich aussortiert. Schwarze Schafe fallen unter weißen Schafen besonders auf und sind bei Schäfern, die ihre Produktion auf die Wolle ausgerichtet haben, sehr unbeliebt. Sie haben bei diesen Schäfern keine hohe Lebenserwartung. Schwedische Gardinen Schwedische Gardinen ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Gefängnis, Knast, Zuchthaus. Für die Entstehung dieses Ausdrucks gibt es zwei Legenden: 1. Während des 30-jährigen Krieges begann eine fast 200 Jahre andauernde schwedische Herrschaft über Teile Pommerns (Stralsund u. a.). Während dieser Besatzungszeit landete man sehr schnell im Gefängnis. 2. Dem schwedischen Stahl wurde eine gute Qualität zugesagt. Dieser Stahl wurde für das Vergittern von Gefängnisfenstern benutzt. Schwein haben Schwein haben ist eine deutsche Redensart und bedeutet ohne eigenes Zutun Glück haben. Die Herkunft ist nicht mit Sicherheit geklärt worden. Vermutlich geht die Redensart auf eine Sitte aus dem späte Mittelalter zurück: Bei Sportwettkämpfen, wie dem Augsburger Schießfest, wurde dem Verlierer als Trostpreis ein Schwein geschenkt. Wer das Schwein bekam, erhielt etwas, ohne es eigentlich verdient zu haben. Nach einer anderen Theorie stammt die Redensart aus dem Kartenspiel. Um das 16. Jahrhundert nannte man das As umgangssprachlich auch Sau. Wer die höchste Karte (Sau) zog, hatte viel Glück. Seemannsgarn Seemannsgarn, hergeleitet von Schiemannsgarn, sind Erzählungen der Seeleute über deren (angebliche) Erlebnisse. Das Schiemannsgarn wurde aus alten Tauen gewonnen und von den Seeleuten benutzt, Leinen und Trossen zu umwickeln. Schiemannsgarn drehen oder Schiemannsgarn spinnen war auf Segelschiffen eine untergeordnete Arbeit, die bei Schönwetter erledigt wurde. Weil sie recht langweilig war, erzählten sich die Seeleute unterdessen, was sie erlebt hatten und worüber sie sich Gedanken machten, Sagen, Schwänke und Döntjes gehörten dazu. Auf diese Weise bekam Schiemannsgarn spinnen mit der Zeit eine andere Bedeutung: Das Erzählen wurde Hauptsache, die Arbeit Nebensache, bis man das Erzählen allein so bezeichnete. Stein des Anstoßes Die Redewendung „Stein des Anstoßes bezeichnet ein Objekt oder ein Thema, das im übertragenen Sinne das Zentrum, den Auslöser eines Streites oder eines Ärgernisses verschiedener Parteien darstellt. Die Quelle dieser Wendung ist in der Bibel zu suchen. Dort heißt es bereits: Ich bin der heilige Zufluchtsort, aber ich bin auch der Stein, an dem man sich stößt; ich bin der Fels, der die beiden Reiche Israels zu Fall bringt. (Jes 8,14) Diese Stelle wird im neuen Testament wieder aufgegriffen, wenn es heißt: 14 . So kamen sie zu Fall an dem Stein des Anstoßes. (Röm 9,32) . ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt worden sind. (1. Brief Petrus 2,8) Stunde Null Die Stunde Null ist die Ausschlag gebende Uhrzeit, zu der eine ganz neuartige Ereigniskette abzulaufen beginnen soll oder begann. Es stammt aus der Planungssprache von Organisationen, klassisch des Militärs. (Manöverbefehl: Abmarsch 04:15. Erreichen des Punktes in Null plus 3 Stunden.) Historisch-politisch wird in Deutschland der Zeitpunkt der Kapitulation des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg am 8. Mai 1945, 24:00 Uhr, als Stunde Null bezeichnet. Hier gibt es seit Erscheinen des Schlagwortes in der Nachkriegszeit viel Begriffspolemik. Durch den Verlust der Selbstbestimmung des deutschen Volkes unter der Militärbesatzung ab 1945 wird von vielen Historikern behauptet, dass die deutsche Gesellschaft aufhörte zu existieren, da der Gesellschaftsbegriff geprägt wird durch Ordnung. Vielmehr können viele unterschiedliche Stunden Null für das Deutschland der Nachkriegszeit ausgemacht werden. So haben Familien, Firmen, Kunst-Projekte, Institutionen und Parteien ihre jeweils eigenen Neuanfänge erlebt. Insbesondere die Währungsreform am 20. Juni 1948 wurde von vielen Deutschen als ein großer Einschnitt, aus historischer Sicht auch als Anfang der Konsumgesellschaft, gesehen. Nicht alle Tassen im Schrank haben Von jemandem, den man für verrückt hält, sagt man, dass er nicht alle „Tassen im Schrank habe. Auch in weiteren Redewendungen ist Tasse im Sinne von Verstand oder auch Gemüt gebräuchlich. Man spricht bei einem langweiligen Menschen auch davon, er sei eine „trübe Tasse. Die Redewendung, dass „jemandes Tasse einen Sprung habe, ist heute nur noch wenig gebräuchlich. In all diesen Wendungen hat der Ausdruck Tasse nichts mit dem homonymen Wort Tasse als Trinkgefäß zu tun, wie beispielsweise in der Wendung: „Hoch die Tassen; vielmehr leitet sich die Wendung von dem jiddischen Wort „toshia her, das soviel wie Verstand bedeutet. Taube Nuss Eine taube Nuss ist eine saloppe umgangssprachliche abwertende deutsche Redensart und ist ein Synonym für einen Versager oder Nichtskönner. Der ursprüngliche Zusammenhang ist jedoch, dass das Adjektiv taub auch bedeuten kann, dass eine Sache den eigentlich erwarteten Inhalt bzw. eine Eigenschaft nicht aufweist bzw. hohl ist. Im Zusammenhang mit einer Nuss bedeutete der Begriff eine von außen durch die Schale nicht einsehbarer wertloser, weil vertrockneter, Inhalt. Der Begriff wird deshalb auch in diskriminierender Weise (hauptsächlich in der früheren derberen Ausdrucksweise der ländlichen Bauernhofeigner, wo die Nachkommenschaft gesichert sein musste) symbolisch für eine Frau gebraucht, die keine Kinder bekommen kann. Trick 17 Mit Trick 17 beschreibt man Lösungswege bei Problemen, die originell oder ungewöhnlich sind. Eine solche Lösung kann jedoch nur bei Erfolg Trick 17 genannt werden, da ein Trick 17 immer und sofort auf Anhieb funktionieren muss. Die Redewendung geht zurück auf das Kartenspiel „Whist, bei dem ein Stich mit seinem englischen Begriff „trick bezeichnet wird. Der höchstmögliche Stich in diesem Spiel ist 17. 15 Tolpatsch Beschreibt einen ungeschickten, schwerfälligen Menschen, dem oft Missgeschicke passieren. Der Tolpatsch kommt aus dem Ungarischen. Mit Tolpatsch (ung.: talpas füßig (mit Füßen), zu talp Sohle) bezeichnete man im Ungarischen früher einen Fußsoldaten, der statt festes Schuhwerk eine mit Schnüren befestigte Sohle trug. Im Österreichischen bezeichnet man daher mit Tolpatsch einen Soldaten, der eine unverständliche Sprache spricht. Einen Vogel haben Im heutigen Sprachgebrauch wird jemand, der einen Vogel hat, nicht ernst genommen. Der abwertende umgangssprachliche Ausdruck einen Vogel haben bezieht sich wahrscheinlich auf einen alten Volksglauben, nach dem sich in den Köpfen von Geisteskranken kleine Tiere, wie Vögel, eingenistet haben. Die Verwendung im Sinne von echter Geisteskrankheit ist heute hingegen unüblich. Zahn zulegen Einen Zahn zulegen ist eine Redewendung, die im heutigen Sprachgebrauch synonym für sich beeilen oder eine Tätigkeit schneller verrichten benutzt wird. Der Ursprung der Redewendung liegt in den Haushalten des Mittelalters begründet. In jener Zeit wurde Wasser und Nahrung in großen Kesseln über offenen Feuerstellen erhitzt. Diese Töpfe wurden mit höhenverstellbaren Eisenhaken in eine Zahnstange eingehängt. Sollte nun die Temperatur in dem Topf erhöht werden, um dessen Inhalt schneller zu garen oder zum Kochen zu bringen, wurde der Topf einen Zahn tiefer gehängt es wurde „ein Zahn zugelegt. 16