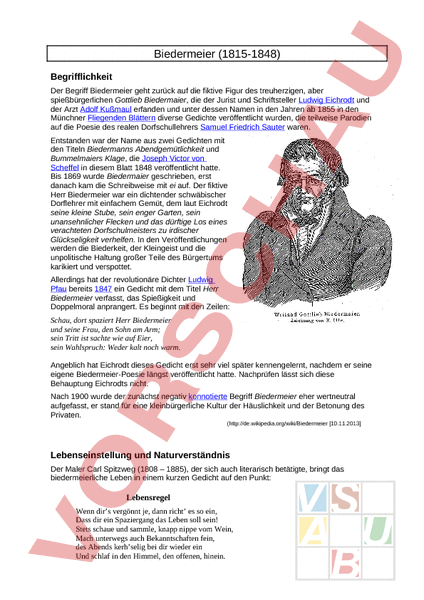Arbeitsblatt: Epoche des Biedermeier
Material-Details
Skript zur Epoche des Biedermeier mit Fragen
Deutsch
Leseförderung / Literatur
12. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
136185
2065
10
08.09.2014
Autor/in
Véronique Schegg
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Biedermeier (1815-1848) Begrifflichkeit Der Begriff Biedermeier geht zurück auf die fiktive Figur des treuherzigen, aber spießbürgerlichen Gottlieb Biedermaier, die der Jurist und Schriftsteller Ludwig Eichrodt und der Arzt Adolf Kußmaul erfanden und unter dessen Namen in den Jahren ab 1855 in den Münchner Fliegenden Blättern diverse Gedichte veröffentlicht wurden, die teilweise Parodien auf die Poesie des realen Dorfschullehrers Samuel Friedrich Sauter waren. Entstanden war der Name aus zwei Gedichten mit den Titeln Biedermanns Abendgemütlichkeit und Bummelmaiers Klage, die Joseph Victor von Scheffel in diesem Blatt 1848 veröffentlicht hatte. Bis 1869 wurde Biedermaier geschrieben, erst danach kam die Schreibweise mit ei auf. Der fiktive Herr Biedermeier war ein dichtender schwäbischer Dorflehrer mit einfachem Gemüt, dem laut Eichrodt seine kleine Stube, sein enger Garten, sein unansehnlicher Flecken und das dürftige Los eines verachteten Dorfschulmeisters zu irdischer Glückseligkeit verhelfen. In den Veröffentlichungen werden die Biederkeit, der Kleingeist und die unpolitische Haltung großer Teile des Bürgertums karikiert und verspottet. Allerdings hat der revolutionäre Dichter Ludwig Pfau bereits 1847 ein Gedicht mit dem Titel Herr Biedermeier verfasst, das Spießigkeit und Doppelmoral anprangert. Es beginnt mit den Zeilen: Schau, dort spaziert Herr Biedermeier und seine Frau, den Sohn am Arm; sein Tritt ist sachte wie auf Eier, sein Wahlspruch: Weder kalt noch warm. Angeblich hat Eichrodt dieses Gedicht erst sehr viel später kennengelernt, nachdem er seine eigene Biedermeier-Poesie längst veröffentlicht hatte. Nachprüfen lässt sich diese Behauptung Eichrodts nicht. Nach 1900 wurde der zunächst negativ konnotierte Begriff Biedermeier eher wertneutral aufgefasst, er stand für eine kleinbürgerliche Kultur der Häuslichkeit und der Betonung des Privaten. [10.11.2013] Lebenseinstellung und Naturverständnis Der Maler Carl Spitzweg (1808 – 1885), der sich auch literarisch betätigte, bringt das biedermeierliche Leben in einem kurzen Gedicht auf den Punkt: Lebensregel Wenn dirs vergönnt je, dann richt es so ein, Dass dir ein Spaziergang das Leben soll sein! Stets schaue und sammle, knapp nippe vom Wein, Mach unterwegs auch Bekanntschaften fein, des Abends kerhselig bei dir wieder ein Und schlaf in den Himmel, den offenen, hinein. Aus der eigentlich komischen Figur des Herrn Biedermeier wurde einige Jahrzehnte später ein Stilbegriff, der eine zwar vergangene, nichtsdestoweniger aber oft im Stillen wieder zurückersehnte Zeit verkörperte. Dieser Stilbegriff umriss die Zeit nach ca. 1830 in ihren restaurativen Tendenzen. Der romantischen Vorstellun geiner allumfassenden Innerlichkeit wie auch der emanzipatiorischen Dichtung des Vormärz und des Jungen Detuschlands wurde die Kultivierung der Familie und der bürgerlichen Zruückgezogenheit in den trauten vier Wänden gegenübergestellt – nun allerdings ohne die spiessigen Züge der ursprünglichen Figur. Äusseres Kennzeichen der Biedermeierdichtung ist die starke Verbundenheit zur „Heimat und deren Landschaftsverbundenheit. Ein wesentliches und typisches Thema des Biedermeier ist die Natur. Sie ist jetzt nicht mehr – wie in der Romantik – eine geradezu mystischen Wesenheit, ein Ausdruck von Jenseitigem und Gefühltem. Dennoch ist sie für die Vertreter der Epoche noch immer von grosser Wichtigkeit und vermittelt noch immer religiöses Empfinden. Man erlebt sie jetzt mehr im Kleinen und beobachtet ihre Erscheinungsformen. Die Naturbeschreibung trägt nun deutlich realistischere Züge als noch in der Zeit der Romantik. Damit wird das Biedermeier zu einer (frühen) Form des Realismus. Aufträge: 1. Betrachte und interpretiere Spitzwegs Gemälde. Welches Naturverständnis spricht deiner Ansicht daraus? Carl Spitzweg: Der Schmetterlingsfänger (um 1840) 2. Inwieweit zeigt das Gemälde ironisch-satirische Züge?