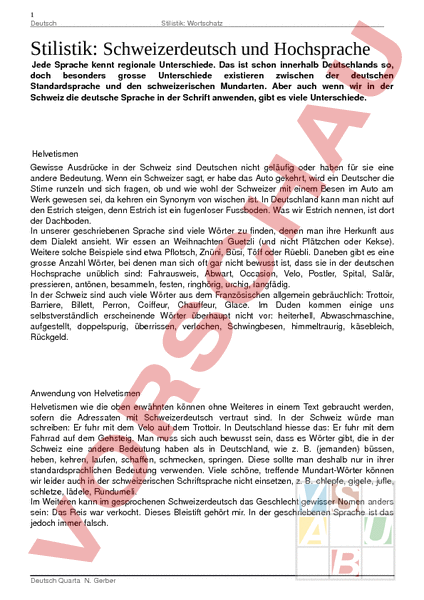Arbeitsblatt: Schweizerdeutsch und Hochsprache
Material-Details
Arbeitsblatt zur Differenzierung Schweizerdeutsch und Hochsprache
Deutsch
Wortschatz
9. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
145367
1725
17
27.03.2015
Autor/in
Nicole Wüthrich
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
1 Deutsch Stilistik: Wortschatz Stilistik: Schweizerdeutsch und Hochsprache Jede Sprache kennt regionale Unterschiede. Das ist schon innerhalb Deutschlands so, doch besonders grosse Unterschiede existieren zwischen der deutschen Standardsprache und den schweizerischen Mundarten. Aber auch wenn wir in der Schweiz die deutsche Sprache in der Schrift anwenden, gibt es viele Unterschiede. Helvetismen Gewisse Ausdrücke in der Schweiz sind Deutschen nicht geläufig oder haben für sie eine andere Bedeutung. Wenn ein Schweizer sagt, er habe das Auto gekehrt, wird ein Deutscher die Stirne runzeln und sich fragen, ob und wie wohl der Schweizer mit einem Besen im Auto am Werk gewesen sei, da kehren ein Synonym von wischen ist. In Deutschland kann man nicht auf den Estrich steigen, denn Estrich ist ein fugenloser Fussboden. Was wir Estrich nennen, ist dort der Dachboden. In unserer geschriebenen Sprache sind viele Wörter zu finden, denen man ihre Herkunft aus dem Dialekt ansieht. Wir essen an Weihnachten Guetzli (und nicht Plätzchen oder Kekse). Weitere solche Beispiele sind etwa Pflotsch, Znüni, Büsi, Töff oder Rüebli. Daneben gibt es eine grosse Anzahl Wörter, bei denen man sich oft gar nicht bewusst ist, dass sie in der deutschen Hochsprache unüblich sind: Fahrausweis, Abwart, Occasion, Velo, Postler, Spital, Salär, pressieren, antönen, besammeln, festen, ringhörig, urchig, langfädig. In der Schweiz sind auch viele Wörter aus dem Französischen allgemein gebräuchlich: Trottoir, Barriere, Billett, Perron, Coiffeur, Chauffeur, Glace. Im Duden kommen einige uns selbstverständlich erscheinende Wörter überhaupt nicht vor: heiterhell, Abwaschmaschine, aufgestellt, doppelspurig, überrissen, verlochen, Schwingbesen, himmeltraurig, käsebleich, Rückgeld. Anwendung von Helvetismen Helvetismen wie die oben erwähnten können ohne Weiteres in einem Text gebraucht werden, sofern die Adressaten mit Schweizerdeutsch vertraut sind. In der Schweiz würde man schreiben: Er fuhr mit dem Velo auf dem Trottoir. In Deutschland hiesse das: Er fuhr mit dem Fahrrad auf dem Gehsteig. Man muss sich auch bewusst sein, dass es Wörter gibt, die in der Schweiz eine andere Bedeutung haben als in Deutschland, wie z. B. (jemanden) büssen, heben, kehren, laufen, schaffen, schmecken, springen. Diese sollte man deshalb nur in ihrer standardsprachlichen Bedeutung verwenden. Viele schöne, treffende MundartWörter können wir leider auch in der schweizerischen Schriftsprache nicht einsetzen, z. B. chlepfe, gigele, jufle, schletze, lädele, Rundumeli. Im Weiteren kann im gesprochenen Schweizerdeutsch das Geschlecht gewisser Nomen anders sein: Das Reis war verkocht. Dieses Bleistift gehört mir. In der geschriebenen Sprache ist das jedoch immer falsch. Deutsch Quarta N. Gerber 2 Verbformen Bei den Verben besteht der wichtigste Unterschied zwischen Hochsprache und Mundart darin, dass wir im gesprochenen Schweizerdeutsch als Vergangenheitsform nur das Perfekt kennen. Eine Präteritumform wie in der Standartsprache gibt es nicht. Darauf ist besonders zu achten, wenn wir Vergangenes erzählen. Dann muss das Präteritum gebraucht werden. Übung 1 Wie sagt man in Deutschland? 1. Kaffeerahm 9. Unterbruch. 2. Münz 10. Sackgeld 3. pressieren 11. Spritzkanne 4. Rüebli. 12. aufbeigen 5. Gipfeli. 13. Metzger 6. Türfalle. 14. Lavabo. 7. Schnauz. 15. Dessert 8. Lichtsignal 16. speditiv. Übung 2 Wie lauten die schweizerischen Entsprechungen für folgende Wörter? 1. Klempner 7. hersagen 2. Schornstein 8. Pate/Patin 3. Vokabeln. 9. Hubschrauber. 4. schnorren. 10. Tagesordnung. 5. Schnuller 11. Apfelsine 6. Jackett. 12. Standspur. Übung 3 Was stimmt () Was nicht ()? 1. Das Dessert schmeckte herrlich. (.) 2. Das Spital wird umgebaut. (.) 3. Im rechten Ecken stand ein Papierkorb. (.) 4. Benütze das Lineal. (.) 5. Der Kies wurde von zwei Lastwagen gebracht. (.) 6. Der Butter sollte nicht an der Sonne stehen. (.) 7. Ein Blitz schlug in den Spitz des Kirchturms. (.) 8. Dieses Deutsch Quarta N. Gerber 3 Deutsch Stilistik: Wortschatz Thermometer ist nicht sehr genau. (.) 9. Das Wachs ist aufs Tischtuch getropft. (.) 10. Nun hat es einen Flecken gegeben. (.) Übung 4 „Übersetze die Helvetismen in die Hochsprache. 1. Sie haben nach Luzern gezügelt. 2. Entschuldigung, darf ich hier parkieren? . 3. Bitte stellen Sie das Buch zurück aufs Tablar. . 4. Ich tische für das Nachtessen. 5. Hol einen Lumpen. Ich habe etwas Kaffee ausgeleert. . 6. Der Abfallkübel steht beim Gartenhag. . 7. Ich muss sagen, dieser Vorschlag tönt gut. 8. Wir fahren mit dem Tram in die Stadt. . 9. Wir mussten das Auto in der Sackgasse kehren. . 10. Wir laufen von der Bushaltestelle nach Hause. . Deutsch Quarta N. Gerber