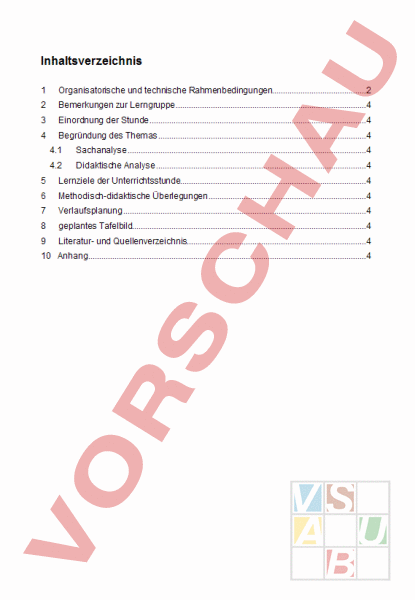Arbeitsblatt: Aktiv und Passiv
Material-Details
Aktiv und Passiv im Präsens mit Rollenspiel
Deutsch
Grammatik
7. Schuljahr
24 Seiten
Statistik
14571
2397
62
21.01.2008
Autor/in
Claudia Rosner
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Inhaltsverzeichnis 1 Organisatorische und technische Rahmenbedingungen . 2 2 Bemerkungen zur Lerngruppe. 4 3 Einordnung der Stunde 7 4 Begründung des Themas 10 4.1 Sachanalyse. 10 4.2 Didaktische Analyse . 15 5 Lernziele der Unterrichtsstunde. 16 6 Methodisch-didaktische Überlegungen 16 7 Verlaufsplanung 19 8 geplantes Tafelbild 22 9 Literatur- und Quellenverzeichnis 23 10 Anhang 24 1 Organisatorische und technische Rahmenbedingungen Die 55. Mittelschule befindet sich am Randgebiet von Grünau in der Ratzelstraße. Sie wurde 1929 als eine der ersten Volksschulen nach dem ersten Weltkrieg für die Kinder von Leipzig-Kleinzschocher, besonders für die der neu erbauten Siedlung Meyersche Häuser, eingeweiht. Sie galt als eine der modernsten, von den Räumlichkeiten her als besonders kinderfreundlich geplanten Volksschulen in jener Zeit. Als Besonderheit gilt die Architektur im Bauhausstil, die unter Denkmalschutz gestellt wurde. Seit 1992 ist das Gebäude Standort der 55. Schule LeipzigMittelschule. Die 55. Mittelschule umfasst seit Beginn des Schuljahres 07/08 die Klassen sieben bis zehn. Es besuchen ca. 200 Schüler die Schule. Trotz Auslaufen des musischen Profils arbeitet die 55. Mittelschule auch weiterhin an der musisch betonten Grundprofilierung (Unterricht, Exkursionen, Wanderfahrten, Aktionen, Wettbewerbe, Ausstellungen). Sie setzt vor allem ihre Schwerpunkte in der engeren nutzbringenden Zusammenarbeit zwischen Schülern, Lehrern, Elternhaus und Öffentlichkeit. Die 55. Mittelschule erhält seit 2005 Fördermittel zur Durchführung von Ganztagsangeboten, die sie an vier Wochentagen für die Betreuung der Kinder bis 15:00 Uhr einsetzt. So gibt es an der Schule eine Lernwerkstatt, in der dienstags – donnerstags von 13:30 Uhr – 15:00 Uhr Hausaufgaben mit Betreuung erledigt werden können. Außerdem bieten die Schule zweimal wöchentlich die Möglichkeit ihren Schulzoo zu besuchen, es gibt einen Chor, eine AG Kreatives Gestalten, eine AG Zeichnen und Sportgemeinschaften. In einer Medienecke stehen vier Computer zur freien Nutzung bereit. Rein baulich hat die Einrichtung ein hohes Renovierungspotential. Aber auch von außen sieht das Schulgebäude sehr heruntergekommen aus. Eine Sanierung wäre daher angebracht, aus Kostengründen jedoch leider nicht machbar. Somit verkommt, das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, von Jahr zu Jahr mehr. Von innen ist die Schule recht gut ausgestattet, da zumindest die technischen Mittel systematisch so ergänzt wurden, dass jetzt vollständig eingerichtete Fachräume zur Verfügung stehen, darunter zwei Informatikkabinette mit Schülerarbeitsplätzen. Außerdem gibt es Fernseher, DVD-Player, Kassettenrekorder, Overheadprojektor. Acht Klassenräume sind mit dem PC-Netzwerk verbunden. Die Schüler können auch 2 außerhalb des Unterrichts die Computer an der Schule nutzen. Neben den zahlreichen einheimischen Kindern aus Grünau und Randgebieten, gibt es auch viele ausländische Kinder sowie Kinder mit Migrationshintergrund. Abgesehen von den Klassen sieben bis zehn gibt es an der 55. Mittelschule Deutsch als Zweitsprache-Klassen (DAZ), um der hohen Zahl von ausländischen Kindern gerecht zu werden. Die ausländischen Schüler, die in den DAZ-Klassen altersmäßig gemischt unterrichtet werden, sprechen anfangs kaum Deutsch und haben meist ein Jahr Zeit, sich die Grundkenntnisse in Deutsch in kleinen Gruppen anzueignen. Schon nach wenigen Wochen werden sie teilweise in ihre Alterstufen integriert, wo sie schnell Fortschritte machen. Einige Schüler haben die Möglichkeit am Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund teilzunehmen. Das Einzugsgebiet ist ein sozialer Brennpunkt und ein Großteil der Schüler, die die 55. Mittelschule besuchen, stammt häufig aus sozial schwachen Familien, in denen die meisten Eltern arbeitslos sind. Oft sind die Familien zerrüttet. Einige Schüler stammen auch aus sehr kinderreichen Familien, in denen sie nicht optimal gefördert werden können. Neben der finanziellen Armut in den Elternhäusern ist besonders der soziale Umgang der Familienmitglieder untereinander ein Problem für die Kinder. Nur Wenige erfahren zu Hause Verständnis, gemeinsame Mahlzeiten oder eigene Zeit mit den Eltern. Dies wirkt sich entscheidend auf die Lernsituation der Kinder aus. Manche Elternhäuser kontrollieren oft nicht, ob Hausaufgaben erledigt werden und beteiligen sich auch nicht an Elternabenden. Damit fällt der Schule auch ein besonderer Erziehungsauftrag zu. Haupt und Realschulklassen werden an der 55. Mittelschule durchgängig getrennt unterrichtet. Seit dem letzten Schuljahr gibt es eine Sozialpädagogin an der Schule, die versucht, speziell mit einzelnen Elternhäusern zu arbeiten. Dabei werden einzelne Schüler intensiv betreut. Frau Isensee bemüht sich, mit den Kindern Lösungen für ihre Probleme zu finden und Konflikte zu lösen. Sie ist eine wichtige neutrale Bezugsperson für die Schüler und ist in der Schule eine große Hilfe für Schüler und Lehrer. Der Schulalltag ist so organisiert, dass nicht die Lehrer in den Pausen wandern müssen, sondern die Schüler. Somit hat jeder Lehrer seinen eigenen Raum. Das bietet sich an, da man erstens sein Material in dem Raum deponieren kann, zweitens 3 ihn individuell, auf das Fach abgestimmt, einrichten kann und man drittens, in den zum Teil nur fünf Minutenpausen, nicht wandern muss. Der Deutschraum meiner Mentorin ist mit Overheadprojektor, Fernseher und Kassettenrekorder ausgestattet. Des Weiteren deponiert sie in den Schränken Material für den Deutschunterricht, wie zum Beispiel Duden, auf die sie jederzeit Zugriff hat und den Schülern austeilen kann. Um den DVD-Player benutzen zu können, muss man sich vorab im Lehrerzimmer in eine Liste eintragen und diesen dann am gewünschten Tag bei Herrn Schäfer, dem Informatiklehrer, ausleihen. Man kann also jederzeit auf alle diversen Medien zurückgreifen und somit seinen Deutschunterricht interessant gestalten. In den 7. Klassen verwenden die Deutschlehrer das Lehrbuch Praxis Sprache von Westermann sowie dem dazugehörigen Arbeitsheft. 2 Bemerkungen zur Lerngruppe In der Klasse 7a lernen elf Jungen und zehn Mädchen, davon habe ich bereits neun Schüler in dem vergangenen Schuljahr in Deutsch unterrichtet. Aus den ehemaligen drei 6. Klassen wurden zwei Realschulklassen und eine Hauptschulklasse gebildet. Weiterhin wurden die zwei Realschulklassen neu zusammengewürfelt, so dass ich einen Teil meines alten Stamms übernommen habe, aber auch zwölf neue Schüler dazubekommen habe. Man müsste davon ausgehen, dass nun die neue Klassenkonstellation zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre führen sollte, da die wirklichen „Störenfriede und Klassenschwächsten in den Hauptschulbildungsgang gewechselt sind, jedoch das Gegenteil tritt hier in Kraft. Wieder einmal gehört die Klasse 7a zu einer schwierigen Klasse, bei denen jeder Tag wieder eine neue Herausforderung ist, da man nie weiß, wie sie heute drauf sind. Im Grunde genommen habe ich ein gutes Verhältnis zu meinen Schülern, sie akzeptieren mich und nehmen mich als vollwertige Lehrerin wahr aber auch ich muss mir bezüglich des Klassenklimas und der Lern- und Arbeitsatmosphäre immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Die Siebtklässer 4 sind nun in einem Alter, in dem sie sich mehr mit ihrem Erwachsenwerden beschäftigen. Sie befinden sich in der Pubertät und in ihrem Prozess der Identitätsfindung haben Unterrichtsstörungen eine andere Qualität angenommen. Aus verspielten Träumern sind provozierende Teenager geworden. Ihnen ist es nun wichtiger, beachtet und ernst genommen zu werden. Viele Handlungen geschehen bei ihnen aus einer Art Probe, sie testen ihre Umwelt jetzt genauer aus, um sich in ihr einen eigenen Platz zu suchen. Störungen sind nun hartnäckiger und meist nur noch im Zweiergespräch zu klären. Den Schülern ist der Kontakt zum Lehrer wichtig. Viele haben ein hohes Mitteilungsbedürfnis und erzählen gern aus ihrer Lebenswelt. Auch in diesem Schuljahr arbeite ich eng mit der Klassenlehrerin Frau Kinne zusammen, was in der Klasse 7a unabdingbar ist. Zusammen überlegen wir uns immer wieder neue Methoden aber auch Sanktionen, die das Lernklima fördern sollen. Zu Beginn des neuen Schuljahres habe ich mit den Schülern zusammen Regeln für den Unterricht erarbeitet. Auch sollten sie sich bei Nichteinhaltung der Regeln Konsequenzen überlegen. Diese Regelliste haben die Schüler selber erstellt und in den Deutschraum aufgehängt. Des Weiteren wurden die gleichen Regeln auf ein DinA4 Blatt übertragen und vorne in das Klassenbuch reingelegt, so dass sie für jeden Fachlehrer zugänglich sind. Zu Beginn hat das Ganze gut funktioniert, doch ich ertappe mich dabei, dass ich schon wieder inkonsequent werde. Ich unterrichte die Klasse viermal in der Woche und habe das Pech, dass ich die Klasse u.a. montags in der siebten Stunde habe. Diese Stunden bereiten mir oft Schwierigkeiten, da die Schüler zuvor Sportunterricht haben und somit in der siebten Stunde meistens unerträglich sind. In diesen Stunden ist ein normaler Fachunterricht kaum möglich. Daher arbeiten die Schüler montags oft in Partner- bzw. Gruppenarbeit, bekommen Arbeitsblätter und wiederholen grammatische Verfahren oder Regeln der Rechtschreibung. Die zehn Mädchen der Klasse 7a sind sehr freundlich, lernbereit und diszipliniert. Einige von ihnen sind noch sehr schüchtern und zurückhaltend und trauen sich nicht, den Mund aufzumachen bzw. sich zu melden. Zusammen harmonieren die zehn Mädchen sehr gut und von „Zickenterror ist wenig zu spüren. Ich habe das Glück, dass Sechs davon zusätzlich in meinem Neigungskurs „Tanz und Theater sind, was 5 das soziale Miteinander sehr begünstigt. Von daher habe ich mit den Mädchen weniger Probleme. Bei den Jungs sieht es da schon ein bisschen anders aus. Zu den wirklichen Störenfrieden, die mindestens einmal in jeder Stunde unangenehm auffallen, gehören Claus, Alexander, Ames, Kevin, Dominik, Philip und Hamid. Mit allen anderen Jungs macht das Zusammenarbeiten Spaß. Aber die bereits genannten sieben Jungs sind vorlaut, unaufmerksam, unkonzentriert, störend und frech, jeder auf seine Art und Weise anders. Claus ist ein sehr cleverer Junge, der sich zwar in das Unterrichtsgeschehen viel mit einbringt, jedoch ansonsten permanent stört. Ihm fällt es schwer, den Mund zu halten, wenn er nicht an der Reihe ist, sich zu melden und nicht reinzurufen und auch das Kippeln kann er nicht unterlassen. Ames hat ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis, muss im Mittelpunkt stehen und seine Aufmerksamkeit bekommen. Ständig quatscht er rein, steht einfach im Unterricht auf, schlägt andere Kinder, ist frech und unerzogen. Bei Alexander merkt man, dass er sich mitten in der Pubertät befindet. Er gibt Widerworte, ist „schnippig und aufsässig. Ähnlich in ihrem Verhalten sind auch die anderen vier. Zusammen sind sie stark und unterhalten sich im Unterricht über Tische und Bänke. Es ist nur sehr schwer, sie zu bändigen und zurück zum eigentlichen Unterrichtsgeschehen zu holen. Fehlt Ames aus Krankheitsgründen, dann verbessert sich zunehmend das Klassenklima und ein ordentlicher Unterricht kann stattfinden. Ich stelle immer wieder fest, dass Ames unter den besagten sieben Störenfrieden der größte Unruhepol ist und mit seiner Art die Klasse untereinander aufmischen kann. Dank einiger Elternanrufe letzter Woche hat sich die Unruhe einwenig gelegt und auch Ames hat gemerkt, wie schnell ich reagieren kann. Fehlt ihm auch der Respekt vor den Lehrern, so hat er ihn wenigstens noch zu Hause vor seinem Vater. Somit wurde mir wieder einmal bewusst, dass manche Schüler nur funktionieren, wenn sie den Druck meinerseits spüren und bestraft werden. Als relativ sicherer Gegenreiz auf Störungen haben sich Extraaufgaben und in schweren Fällen Nachsitzen bewährt. Die Mitarbeit der Schüler ist im Großen und Ganzen vorbildlich. Ein Großteil der Schüler bringt gute Leistungen im Lesen und Schreiben, was günstige Voraussetzungen für einen lebendigen Unterricht sind. Der Leistungsstand der Klasse ist weitestgehend homogen. Die Schüler befinden sich mehr oder weniger auf einem Leistungslevel. In der Rechtschreibung mangelt es den Schülern nach wie vor sehr. 6 3 Einordnung der Stunde St. Inhalt 1 2 3 4 5 Methodisch-didaktische Überlegungen Elemente des Lehrplans Fremd ist der Fremde Einführung in den Lernbereich LB 4: andere Länder und nur in der Fremde! – Entdeckungen: Das Fremde Sitten, eigene Ist nicht jeder Fremde Erfahrungen ein Fremder? LB1: Umfrage zum Thema „Ausland Klischees Text: Reise mit Klischees LB 4: Kennenlernen von Toleranz; Toleranztest: Wie tolerant seid Klischees einzelner Verständnis zu ihr anderen Kulturen Länder anderen Kulturen gegenüber? LB1: Informationen erfassen, Assoziationen zu Bildern LB 4: Kennen von Von der Hoffnung auf Reportage: Eine ein besseres Leben Unberührbare geht zur Schule Möglichkeiten der Textarbeit Darstellung des Themas erfahren in Sachtexten LB1: Strategien der Texterschließung Eine Karikatur Vorurteile thematisieren, LB 4: eigene Erfahrungen verstehen und gemeinsam über Problematik LB 2: Strategien bewerten sprechen anwenden: andere Wortformen suchen LB 1: eigene Meinung sachlich äußern und begründen Eine Erzählung lesen Text: Das Kaninchen LB 4 und verstehen LB 1: Strategien der Texterschließung, Informationen erfassen, wichten, strukturieren und veranschaulichen 6 Grammatischer Aufbau von Aktiv und Passiv im Präsens Bildung des Passivs sowie die Umstellung der Satzglieder „Subjekt und „Objekt Anwendung 7 Aktiv und Passiv im Kennenlernen der Bildung des Präteritum, Perfekt, Passivs in den anderen Plusquamperfekt und Zeitformen; Anwendung Futur LB 4: Beherrschen sprachlicher Mittel des Berichtens LB 2: Beherrschen von Form und Funktion der Wortarten LB 4: Beherrschen sprachlicher Mittel des Berichtens LB 2: Beherrschen von Form und Funktion der Wortarten 7 8 Fremde Kulturen – fremde Gerichte Leistungsüberprüfung der Aktiv und Passivformen 10 Andere Länder – andere Sitten Über andere Essgewohnheiten berichten 11 Vorlieben und Abneigungen kulinarische Gerichte aus fremden Ländern Ordnen von Rezepten Anwenden der Passivformen LB 4: Beherrschen sprachlicher Mittel des Berichtens LB 2: Beherrschen von Form und Funktion der Wortarten über Frühstücksgewohnheiten der einzelnen Länder informieren und anschließend darüber berichten LB1: Über fremde Traditionen berichten LB 4: Beherrschen des Berichtens, eigene Erfahrungen LB 1: Argumente finden, formulieren; Beherrschen von Lesetechniken LB 2: Beherrschen der Wortarten LB 4: andere Länder – andere Sitten LB 1: Ein Problem erkennen und erörtern; Kennen von Strategien des erörternden Erschließens; ein Schaubild lesen und verstehen; Strategien der Texterschließung, Mind Map, Cluster LB 4: Gestalten einer Präsentation, Einbeziehung aller Aspekte des LB LB 1: Beherrschen von Arbeitstechniken der Präsentation LB 1: eigene Meinung äußern 9 12 „Kleider machen 13 Leute 14 Schuluniform ja oder nein? Text: Herr Fu und die Seidenraupen ein und derselbe Junge – unterschiedliche Stylings wonach werden Menschen häufig beurteilt? über Vorurteile nachdenken 15 Über fremde ein Land vorstellen, 16 Traditionen berichten Lebensweisen, Konflikte 17 – Eine Präsentation erstellen und halten 18 Auswertung der Präsentationen Vorlesen, zuhören, durch Klasse bewerten 19 Leistungsüberprüfung Arbeit mit Sachtexten 20 Puffer 8 Die vorliegende Stunde ordnet sich in den Lernbereich 4 des sächsischen Lehrplans in der Klasse 7RS an Mittelschulen ein. Im Mittelpunkt des Lernbereichs Entdeckungen: Das Fremde stehen thematische Aspekte, die die Schüler altersgemäß als interessant und spannend empfinden: fremde Länder und ihre Sitten, zwischenmenschliche Beziehungen, Vorurteile, Schulkleidung, Piercings. Die heutige Stunde mit dem Thema: Grammatischer Aufbau von Aktiv und Passiv im Präsens lässt sich gut in den Lehrplaninhalt des Lernbereichs 4 integrieren. Die Schüler sollen sprachliche Mittel des Berichtens beherrschen, d.h. über andere Länder und Sitten berichten sowie eigene Erfahrungen mit einbeziehen. Da Berichte auch immer abgeschlossene bzw. gerade laufende Vorgänge beschreiben, müssen die Schüler mit den Formen des Aktivs und Passivs vertraut sein und sie beherrschen. Auch wenn ein eigentlicher Bezug zum Lernbereich 2 nicht direkt angegeben ist, so lässt sich meines Erachtens eine Verknüpfung hier begründen: Laut Lehrplan sollen die Schüler Formen und Funktionen der Wortarten beherrschen, jedoch sollten die Schwerpunkte je nach Lernausgangslage gesetzt werden. Im letzten Schuljahr habe ich mit der damaligen 6. Klasse, aufgrund von Zeitproblemen, die Aktiv- und Passivformen nicht mehr drannehmen können. Da die Schüler keine Ausgangslage haben, möchte ich nun den Schwerpunkt auf Aktiv und Passiv legen. In der Lernbereichsplanung sind für diese Einheit 20 Stunden vorgesehen, in denen die Schüler eine Problemfrage diskutieren, eine kontroverse Erörterung schreiben, einem Sachtext Informationen entnehmen, Informationsmaterial sammeln, sichten und für eine Präsentation aufbereiten, einen Sachtext lesen und verstehen sowie Aussagen eines Textes beurteilen und bewerten. Das Hauptaugenmerk soll zu Beginn auf fremde Länder, fremde Sitten, fremde Kulturen sowie Toleranz Fremdem gegenüber liegen. Eine weitere wichtige Rolle spielen Vorurteile und zwischenmenschliche Beziehungen. In einer abschließenden Präsentation sollen die Schüler alle Aspekte des Lernbereiches mit einbeziehen und ein Land vorstellen, in dem sie auf die Lebensweisen sowie Konflikte mit eingehen und den Bezug zur eigenen Lebenswelt herstellen. Die vorliegende Stunde stellt die sechste Stunde der Unterrichtseinheit Entdeckungen: Das Fremde dar. In dieser Stunde wird die grundlegende formale 9 Struktur des Passivs im Vergleich zum Aktiv behandelt. Die Schwerpunkte dieser Stunde sind: Kennen lernen der Bildung des Passivs im Präsens Anwenden des Passivs im Präsens Nach dieser einführenden Stunde folgen zwei weitere, in denen die Schüler die Bildung des Passivs in den anderen Zeitformen kennen lernen, dessen kommunikative Leistungen Vorgangsbeschreibung erarbeiten sowie in einer anschließenden kulinarischer Gerichte aus fremden Ländern ihr Wissen anwenden. In einer abschließenden Leistungsüberprüfung sollen die Schüler ihr Gelerntes unter Beweis stellen. Laut Lehrplan beansprucht der Lernbereich 4 20 Unterrichtsstunden. Berücksichtigen muss man hier die Integration der Lernbereiche 1 und 2, die als keine eigenständigen Unterrichtseinheiten gedacht sind, sondern laut Lehrplan in die Lernbereiche 3 bis 6 eingearbeitet werden sollen. So müssen in den Lernbereich 4 sehr oft die Strategien der Texterschließung übertragen werden und die Schüler das Beherrschen von Lesetechniken unter Beweis stellen. 4 Begründung des Themas 4.1 Sachanalyse Aktiv und Passiv sind verschiedene Darstellungsweisen einer Aussage, die je nach kommunikativer oder auch stilistischer Absicht verwendet werden. Nur den transitiven Verben stehen beide Darstellungsweisen uneingeschränkt zur Verfügung. Grundsätzlich werden beim Verb 3 Genera unterschieden: Aktiv Vorgangspassiv (oder werden-Passiv) Zustandspassiv (oder sein-Passiv) 10 Formbildung: Das Vorgangspassiv wird gebildet aus den konjugierten Formen des Hilfsverbs werden Partizip II des Vollverbs. Im Perfekt und Plusquamperfekt verliert das Partizip II von werden das Präfix ge-. Ich werde geimpft. Ich wurde geimpft. Ich bin geimpft worden. Ich war geimpft worden. Das Zustandspassiv wird gebildet aus den konjugierten Formen des Hilfsverbs sein Partizip II des Vollverbs. Das Perfekt und Plusquamperfekt sowie das Futur des Zustandspassivs werden verhältnismäßig selten verwendet. Das Perfekt und Plusquamperfekt werden gewöhnlich durch das Präteritum, das Futur durch das Präsens ersetzt. Ich bin geimpft. Ich war geimpft. Ich bin/war geimpft gewesen. Von reflexiven Verben kann in der Regel kein Passiv gebildet werden, weil das Reflexivpronomen und das Subjekt dasselbe Wesen oder Ding nennen. Vom Satz Ich wasche mich ist das Passiv Ich werde von mir gewaschen sinnlos. Inhaltliche Auswirkungen des Passivs: Das Vorgangspassiv wird zumeist statt des Aktivs verwendet, wenn der Sprecher den Handlungsträger ( das Subjekt des Aktivs) nicht nennen kann oder will. Wird aber der Handlungsträger im Passiv genannt, erscheint er in der Position des vom Mitteilungsgehalt her wesentlichen Satzgliedes (im letzten Teil des Satz) und wird dann kommunikativ als besonders wichtig empfunden. In Passivkonstruktionen wird das Verb aus der wenig betonten Stelle, an der es im Aktivsatz erscheinen würde, herausgelöst und in die stark betonte Endposition 11 gebracht. Damit erscheint das Verb als das wichtigste Satzglied in einer betonten Stellung, was sowohl die Aufnahme als auch das Einprägen des Inhalts erleichtert. In manchen Fällen wird der Gebrauch des Passivs auch dadurch motiviert, dass Vorgänge als gesetzmäßig dargestellt werden können, die vom Menschen zwar erkennbar oder anwendbar, aber nicht veränderbar sind. Gebrauch des Vorgangspassivs: Nicht jeder aktive Satz lässt die Bildung eines Vorgangspassivs zu. Ein Vorgangspassiv kann nur gebildet werden, wenn im entsprechenden Aktivsatz das Subjekt ein „Agens (Handlungsfähiger) und das Verb entsprechend ein Tätigkeitsverb ist. Aktiv: Der Sohn hilft dem Vater. Passiv: Dem Vater wird (vom Sohn) geholfen. Aktiv: Der Sohn ähnelt dem Vater. Passiv: *Dem Vater wird (vom Sohn) geähnelt. ( nicht möglich!!) Die Bildung des Vorgangspassivs ist nicht möglich, wenn das Verb ein so genanntes Mittelverb ist: bekommen, haben, besitzen, erhalten, kosten, enthalten, umfassen, es gibt Außerdem kann man von intransitiven Verben, die ihr Perfekt mit dem Hilfszeitwort sein bilden, kein Passiv bilden. (z.B. kommen, reisen, bleiben etc.) Passivsätze mit Subjekt: Das Akkusativobjekt des Aktivsatzes wird Subjekt des Passivsatzes. Das Subjekt des Aktivsatzes (außer man) kann mit von Dativ in den Passivsatz aufgenommen oder einfach weggelassen werden. Aktiv: Die Ärztin untersucht den Patienten vor der Operation. Passiv: Der Patient wird vor der Operation (von der Ärztin) untersucht. 12 Subjektlose Passivsätze: Hauptsätze: Wenn der Aktivsatz kein Akkusativobjekt enthält, kann es auch kein Subjekt im Passivsatz geben. Man nimmt dann es zu Hilfe. Dieses es kann nur am Anfang des Hauptsatzes stehen. Wenn ein anderes Satzglied an diese Stelle tritt – was stilistisch meist besser ist – fällt es weg. Aktiv: Man arbeitet sonntags nicht. Passiv: Es wird sonntags nicht gearbeitet. Sonntags wird nicht gearbeitet. Aktiv: Man half den Verunglückten erst nach zwei Tagen. Passiv: Es wurde den Verunglückten erst nach zwei Tagen geholfen. Den Verunglückten wurde erst nach zwei Tagen geholfen. Nebensätze: In Nebensätzen mit Passiv fällt das unpersönliche es immer weg, weil die Konjunktion (weil, als etc.) den Anfang des Nebensatzes besetzt. Aktiv: Er wird immer böse, wenn man ihm sagt, dass er unordentlich ist. Passiv: Er wird immer böse, wenn ihm gesagt wird, dass er unordentlich ist. Aktiv: Ich war ratlos, als mir der Arzt von einer Impfung abriet. Passiv: Ich war ratlos, als mir von einer Impfung abgeraten wurde. Gebrauch des Zustandspassivs: Ein Zustandspassiv setzt immer ein entsprechendes Vorgangspassiv voraus. Deshalb ist ein Zustandpassiv nur dann möglich, wenn es auch ein entsprechendes Vorgangspassiv gibt. Aktiv: Peter öffnet das Fenster. Vorgangspassiv: Das Fenster wird geöffnet. Zustandspassiv: Das Fenster ist geöffnet. 13 Das Zustandspassiv dient zur Darstellung von Zuständen, die das Ergebnis oder die Folge einer vorausgegangenen Tätigkeit sind. Weitere Möglichkeiten, passivische Sehweise auszudrücken: Bleiben-Passiv: Das Fenster wird geöffnet. Das Fenster ist geöffnet. Das Fenster bleibt geöffnet. Das bleiben-Passiv im letzten Satz hat als zusätzliche Bedeutung die Kontinuität. Wie nicht jedes Aktiv ein Vorgangspassiv und nicht jedes Vorgangspassiv ein Zustandspassiv hat, so hat auch nicht jedes Zustandspassiv ein entsprechendes bleiben-Passiv. Konstruktionen mit bekommen, erhalten Partizip II: Er bekommt das Buch geschenkt. ( Ihm wird das Buch geschenkt.) Diese Konstruktion wird auch „Dativ-Passiv genannt, weil nicht der Akkusativ, sondern der Dativ des aktivischen Satzes im Passiv zum Subjekt wird. Dieses bekommen-Passiv kann von folgenden Verbgruppen gebildet werden: Verben des Besitzwechsels (z.B. schenken, schicken, spendieren, überreichen, zusenden), Verben des Mitteilens (z.B. sagen, mitteilen, darstellen, erklären, erläutern) und Verben der aktiven Tätigkeit (z.B. ziehen, brechen, waschen, schneiden, reparieren, reinigen). Konstruktion mit sein zu Infinitiv: Diese Form drückt eine Notwendigkeit, einen Zwang aus oder eine Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit. Die Konstruktion kann durch die Modalverben müssen und können ersetzt werden. Das Zimmer ist abzuschließen. ( Das Zimmer muss/kann abgeschlossen werden.) Anträge sind im Rathaus abzuholen. ( Anträge können im Rathaus abgeholt werden.) 14 Konstruktion lassen Reflexivpronomen Infinitiv: Das Buch lässt sich gut verkaufen. Es lässt sich nicht erklären, warum er gekommen ist. Warum er nicht gekommen ist, lässt sich nicht erklären. Auch reflexive Verben in Verbindung mit einem Sachsubjekt können passivische Sehweise ausdrücken: Das Buch verkauft sich gut. Der Schlüssel findet sich sicher wieder. 4.2 Didaktische Analyse Das Thema gehört laut Lehrplan der 6. Klassen an der Mittelschule zum Stoff der 6. Klasse. Die Schüler sollen Form und Funktion von Aktiv und Passiv beherrschen. Da ich aus Zeitproblemen auf die Bildung und Verwendung des Passivs in der 6. Klasse verzichten musste, halte ich es nun für notwendig, dies in der 7. Klasse nachzuholen. Im Hinblick darauf, dass Bericht und Anleitung bzw. Beschreibung obligatorische Themen des Deutschunterrichts in der Mittelstufe sind und das Passiv ein wichtiges sprachliches Mittel dieser Textsorten darstellt, ist eine spezifische Behandlung dieser sprachlichen Form sinnvoll. Innerhalb des Lernbereichs 4 sollen die Schüler über andere Länder und Sitten sowie über ihre eigenen Erfahrungen bezüglich des Fremden und des Auslands berichten. Hierfür sind Kenntnisse der Passivbildung von Nutzen. Die deutsche Sprache ist durch die häufige Verwendung des Passivs gekennzeichnet. Das Passiv kommt oft in beschreibenden Texten vor, in denen z.B. ein Vorgang im Vordergrund steht. Es wird vor allem benutzt, wenn derjenige, der etwas getan hat, nicht bekannt ist oder nicht genannt werden soll. So findet man das Passiv häufig in Zeitungsartikeln wieder, z.B. bei Täterbeschreibungen aber auch bei Kochrezepten wird das Passiv häufig verwendet. 15 5 Lernziele der Unterrichtsstunde Groblernziel der 3 Unterrichtsstunden zu Aktiv/Passiv innerhalb der Unterrichtseinheit: Die Schüler sollen das Aktiv und Passiv in verschiedenen Tempusformen sowie als Möglichkeiten der persönlichen und unpersönlichen Redeweise kennen lernen und anwenden. Groblernziel der Unterrichtsstunde: Die Schüler sollen die Bildung des Passivs im Präsens kennen lernen und anwenden können. Feinlernziele der Unterrichtsstunde: 1. Unter aufmerksamen Zuschauen verfolgen die Schüler das Rollenspiel und erraten, was das und das zu bedeuten haben und was ihnen beim Rollenspiel aufgefallen ist. 1. Die Schüler stellen die Aussagengleichheit des Aktiv- und Passivsatzes fest. 2. Sie bestimmen die Satzglieder im Aktiv- und Passivsatz und unterscheiden Subjekt, Objekt und Prädikat. 3. Sie erarbeiten die formalen Unterschiede zwischen Aktiv und Passiv. 4. Sie erkennen den Unterschied Aktiv-Passiv. 5. Die Schüler können den Aktivsatz in einen Passivsatz umwandeln. 6 Methodisch-didaktische Überlegungen Die heutige Stunde ist handlungsorientiert angelegt. Ich habe mich für eine induktive Vorgehensweise entschieden, d.h. das grammatische Phänomen (Aktiv/Passiv) wird im Vorfeld weder benannt noch erläutert, die Schüler entdecken und erarbeiten sich dieses ausgehend von einem Rollenspiel. Später wird das grammatische Phänomen klassifiziert. Wir gehen also von Allgemeinen zum Besonderen. Als Hinführung zum Thema dient ein Rollenspiel, welches ich zusammen mit einem Schüler der Klasse vortragen werde. Hierzu habe ich mich entschieden, bereits im Vorfeld einen Schüler der Klasse 7a auszusuchen und zu instruieren. Meine Entscheidung fiel dabei auf 16 Helene. Helene und ich werden zusammen der Klasse ein Rollenspiel präsentieren. Sie wird die Passivrolle übernehmen und ich die Aktivrolle. Zur Kennzeichnung der beiden unterschiedlichen Rollen habe ich zwei Medaillen mit jeweils einem und einem erstellt. Da die Klasse zunächst nicht weiß, worum es geht, sollen sie anschließend Vermutungen aufstellen und auch überlegen, was das und das zu bedeuten haben. Vielleicht kommt ja der eine oder andere selbst darauf. Anhand der vorgespielten Beispiele wird die Problemstellung des Aktiv-Passivs erarbeitet. Die Schüler sollen die Satzglieder Subjekt, Prädikat und Objekt erkennen und bestimmen und somit auch die Unterschiede zum Passivsatz herausarbeiten. Anhand der beiden Beispielsätze aus dem Rollenspiel sollen sie erkennen, dass das Subjekt des Aktivsatzes immer etwas tut, hingegen dem Subjekt im Passivsatz etwas angetan wird. Nach der gemeinsamen Erarbeitung der Regel übernehmen die Schüler das Tafelbild in ihren Merkteil und wenden ihr zuvor Erlerntes in der Festigungsphase an. Auf einem Arbeitsblatt unterstreichen die Schüler jeweils die Satzglieder und bilden die dazugehörigen Passivsätze. In einer abschließenden Übung sollen sich die Schüler nun selbst an einem Rollenspiel üben. Ihnen dient als Vorlage das zu Beginn der Stunde gehörte Rollenspiel. Über Paarbildungskarten lasse ich je 10 Paare bilden, dabei arbeiten jeweils ein Bundesland und seine Hauptstadt zusammen als Partner. Die Paare sollen sich 2 Aktivsätze mit den dazugehörigen Passivsätzen ausdenken. (z.B. Ich repariere dein Fahrrad. Mein Fahrrad wird repariert.) Anschließend sollen, je nach Zeit, 1-2 Paare nach vorne kommen und ihre Ergebnisse präsentieren. Die Klasse hat nun die Aufgabe zuzuhören und zu entscheiden, wer die Medaille umgehängt bekommt und wer die Medaille. Sie sollen also durch das aufmerksame Zuhören herausfinden, wer den Aktivpart übernommen hat und wer den Passivpart. Die heutige Stunde ist exakt für 45 Minuten konzipiert, jedoch weiß ich nicht genau, in welchem Lerntempo die Klasse die einzelnen Aufgaben absolvieren wird. Sollten die Schüler für die erste Übung auf dem Arbeitsblatt mehr Zeit beanspruchen als geplant, dann werden wir das Rollenspiel zum Schluss nicht mehr schaffen und es in der nächsten Stunde durchführen. Sollte die Klasse jedoch schneller arbeiten als erwartet, dann könnten am Schluss mehrere Paare ihr Rollenspiel präsentieren. 17 Sollten alle 21 Schüler in dieser Stunde anwesend sein, dann werde ich mich an der Paarbildung mitbeteiligen, damit es aufgeht. Somit werden es dann 11 Paare sein. 18 7 Verlaufsplanung Zeit Didakt.-meth. Struktur Lehrertätigkeit Schülertätigkeit/Sozialformen Medien begrüßt stehen auf und begrüßen Motivation holt freiwilligen nach vorn und hängt ihm ein um den Hals und sich selbst ein L und tragen ein Rollenspiel vor 9:51 Zusammentragen der Ergebnisse fragt S, was ihnen aufgefallen ist und wofür und stehen Rollenspiel verfolgen aufmerksam Rollenspiel sollen erraten, was das und das zu bedeuten haben und was ihnen beim Rollenspiel aufgefallen ist stellen Vermutungen auf und kommen evt. auf Aktiv und Passiv 9:53 Zielangabe hören aufmerksam zu 9:54 Erarbeitung setzt Stundenziel und notiert Überschrift an die Tafel: Aktiv und Passiv im Präsens notiert Beispielsätze (aktivpassiv) aus dem Rollenspiel an die Tafel (unterschiedliche Farben) fragt S, was ihnen auffällt, wenn sie den Aktiv- und den Passivsatz vergleichen. stellen Vermutungen auf: „Ich kommt nicht mehr im Passiv vor „werden steht immer im Passiv „die Schuhe sind rot geschrieben im Passiv Tafel unterschiedliche Farben lässt Subjekt im Aktivsatz bestimmen: Subjekt (rot geschrieben) „Ich im Aktiv Subjekt man erfragt Subjekt immer mit Wer oder Was? L-S Gespräch frontal Tafel unterschiedliche Farben 9:45 9:46 Hinführung zur Zielangabe/Einstieg und Medaillen Text Rollenspiel Utensilien (Schuhe, Brille, Stuhl, Jacke, Bürste) Bemerkungen notiert Subjekt mit rot an die Tafel (Das Subjekt im Satz tut etwas) erklärt, dass es im Passiv etwas anderes ist das Subjekt ist ein anderes! „die Schuhe (dem Subjekt des Satzes wird etwas angetan) fragt S, was es neben dem Subjekt im Satz noch gibt antworten: Prädikat und Objekt fragt, wie Objekt erfragt werden kann notiert Objekt mit grün an die Tafel antworten: mit Wen oder Was? fragt, was das Prädikat des Satzes ist. erklärt, dass Prädikate immer aus Verben bestehen und mit Was geschieht? erfragt werden können notiert Prädikat mit blau an die Tafel antworten: binden fragt S, was ihnen auffällt, wenn die sich das Objekt im Aktivsatz anschauen und vergleichen mit dem Passivsatz antworten: aus dem Objekt im Aktivsatz wird ein Subjekt im Passivsatz! notiert Merksatz an Tafel: Aus dem Objekt im Aktivsatz, wird das Subjekt im Passivsatz. 10:02 fordert auf Tafelbild zu übernehmen übernehmen Tafelbild in ihren Merkteil Tafel Hefter (Merkteil) 20 10:07 10:10 Festigung/Übung Übung schreibt weiteren Aktivsatz aus Rollenspiel an Tafel und fordert auf, den Passivsatz zu bilden L-S Gespräch (Ich kämme dir die Haare.) (Die Haare werden mir gekämmt.) teilt AB aus und fordert auf die 4 Sätze auf dem AB ins Passiv zu übertragen Einzelarbeit L-S Gespräch 10:15 Kontrolle vergleicht mit Aufgaben 10:18 Übung lässt je eine Karte ziehen (ein Bundesland und seine Hauptstadt arbeiten zusammen) 10:25 Kontrolle 10:30 Stundenschluss Tafel bilden Passivsatz AB lösen Aufgaben lesen Ergebnisse vor Partnerarbeit Folie AB Karten zur Paarbildung ziehen Karte, verraten zunächst nicht, was auf der Karte steht gibt Kommando für Paarbildung suchen sich ihren jeweiligen Partner und setzen sich wieder hin fordert Paare auf 2 Sätze zu bilden und verweist damit auf das Rollenspiel fordert 1-2 Paare auf, nach vorne zu kommen und ihr Rollenspiel vorzutragen Paare bilden 2 Aktivsätze und die dazugehörigen Passivsätze müssen entscheiden, wer und wer Medaille umgehängt bekommt und Medaillen 21 8 geplantes Tafelbild Aktiv Passiv Das Dem Ich binde dir die Schuhe. Die Schuhe werden mir gebunden. Subjekt des Satzes Subjekt Ich kämme dir die Haare. Die Haare werden mir gekämmt. tut etwas des Satzes wird etwas vom Schüler Subjekt Wer? oder Was? Prädikat Was geschieht? Objekt Wen oder Was? Wichtig: Aus dem Objekt im Aktiv wird das Subjekt im Passiv angetan 9 Literatur- und Quellenverzeichnis Abraham/ Beisbart/ Koß/ Marenbach: Praxis des Deutschunterrichts. Arbeitsfelder, Tätigkeiten, Methoden. Donauwörth 2005. Dreyer/ Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning 2000. Kämper, van den Boogaart [Hrsg.]: Deutschdidaktik. Leitfaden für die Sekundarstufe und II. Berlin 2003. Lehrplan Sachsen Mittelschule Deutsch 2006/2007 unter: 10 Anhang 24