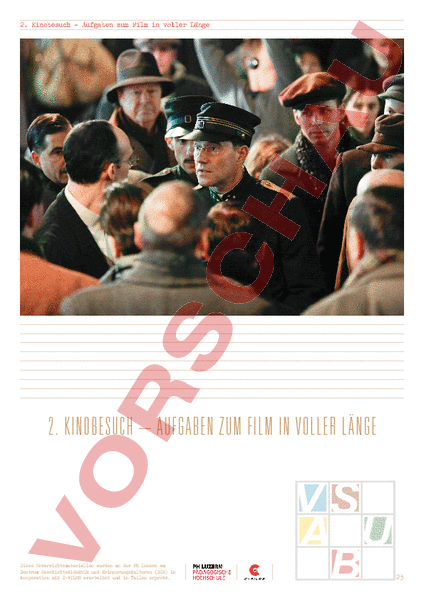Arbeitsblatt: Akte Grüninger (Schweizer Flüchltlingspolitik)
Material-Details
Schweiz im 2. Weltkrieg. Mit Einführung, Aufgaben und Lösungen. Viedosequenzen und Film im Internet gratis Downloadbar.
Geschichte
Gemischte Themen
9. Schuljahr
34 Seiten
Statistik
146228
2419
42
19.04.2015
Autor/in
Ueli Hans
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
2. Kinobesuch Aufgaben zum Film in voller Länge 2. kinobesuch – AUFGABEN ZUM FILM IN VOLLER ÄNGE Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 23 Die vorliegenden Unterlagen dürfen ausschliesslich für schulische Zwecke kopiert werden. Jegliche kommerzielle Nutzung ist strengstens untersagt und wird rechtlich verfolgt. Inhaltsverzeichnis inhALt 2. Unterrichtsbausteine: Kinobesuch Aufgaben zum Film in voller Länge 1. Figurenkonstellation „Akte Grüninger (1 Aufgabe) 2. Verknüpfungen und Zusammenhänge – Figurenkonstellation und Materialset (Quellen und Darstellungen) (1 Aufgabe) 3. Schweizerische Flüchtlingspolitik 1933-39 (5 Aufgaben) 4. Robert Frei – Entscheidungen und Handlungsspielraum (4 Aufgaben) 5. Paul Grüninger – Entscheidungen und Grenzen (3 Aufgaben) 6. .und dann? Fallengelassen und verurteilt. Der Umgang mit Paul Grüninger. Ein Denkmal oder eine Gedenkstätte? (1 Aufgabe) iMPRessuM 25 28 33 41 47 53 Autorinnen: Prof. Dr. Karin Fuchs (Dozentin) mit Catherine Morgenthaler und Nicole Riedweg (Studentinnen), PH Luzern Produktion: Anne Walser, C-FILMS Gestaltung: Stefan Haas Rudi-Renoir Appoldt (haasgrafik.ch rrenoir.com) Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 24 2.1 Figuren-Konstellation deutschL And ÖsteRReich FiGuRenkonsteLL Ation Au Flü fgen h om tlin g en Vizekonsul der Schweiz in Bregenz ge Flü ies h en tlin ge Aufgaben Ab 1) Welche Rollen haben die Figuren im Film? Bezeichne mit Stichworten die Rollen auf den folgenden beiden Seiten. 2) Ordne die Figuren auf nebenstehender Figurenkonstellation richtig zu. 3) Begründe mit Beispielen aus dem Film. KANTON ST. GALLEN Kantonsregierung Al te Rh ein SP-Regierungsrat, Chef des Polizeidepartements Polizeihauptmann des Kantons St. Gallen Untersuchungsrichter Grenzpolizisten, Schlepper seine Frau ihre Tochter Leiter Israelitische Flüchtlingshilfe St. Gallen DIEPOLDSAU SG Grenzpolizisten Grenzpolizist, Leiter des Flüchtlingsheims Diepoldsau Flüchtlingsheim Alte Spinnerei KANTON THURGAU Gasthaus wohnt in Diepoldsau mit seiner Frau Polizeihauptmann des Kantons Thurgau schWeiZ Andere Kantone Schweizerische Eidgenossenschaft BERN Bundesrat EJPD Eidg. Justiz- und Polizeidepartement Chef der Polizeiabteilung des EJPD und der Zentralstelle der Fremdenpolizei Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. Zur Untersuchung illegaler Grenzübertritte an die Schweizer Grenze im Kanton St. Gallen abbestellt 25 2.1 Figuren-Konstellation Ruth Grüninger Paul Grüninger Heinrich Rothmund Ernest Prodolliet Robert Frei Sidney Dreyfuss Ernst Haudenschild Valentin Keel Alice Grüninger Ernst Kamm Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 26 2.1 Figuren-Konstellation Karl Werner Walter Härtsch Alfons Eigenmann Abgewiesene Flüchtlinge Familie Schwarz Christian Dutler und Karl Zweifel Max Wortsmann Jakob, Ida und Robert Kreutner Käthe und Samuel Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 27 2.2 Materialset MAteRiALset Aufgabe) Materialset und Figurenkonstellation Du findest verschiedene Materialien – einige sind Quellen, einige sind Darstellungen. Die Materialien beleuchten Aspekte des Films aus unterschiedlichen Perspektiven und wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten verfasst. a) Schau dir zuerst die Figurenkonstellation zum Film „Akte Grüninger auf der folgenden Seite genau an. b) Wähle aus dem Materialset mindestens 5 Quellen und/oder Darstellungen aus, die du mit der Figurenkonstellation in Verbindung bringen kannst. Notiere jeweils die Nummer der Quellen/Darstellungen direkt in die Figurenkonstellation und begründe mit wenigen Sätzen deine Zuordnung. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 28 2.2 Materialset deutschL And ÖsteRReich FiGuRenkonsteLL Ation MÄRZ 1938 bis MÄRZ 1939 Ernest Prodolliet Ab te Rh ein Valentin Keel SP-Regierungsrat, Chef des Polizeidepartements Paul Grüninger Walter Härtsch Polizeihauptmann des Kantons St. Gallen Untersuchungsrichter Jakob, Ida und Robert Kreutner Kantonsregierung Al Käthe und Samuel KANTON ST. GALLEN ge Flü ies h en tlin ge Karl Werner Familie Schwarz Max Wortsmann Au Flü fgen h om tlin g en Vizekonsul der Schweiz in Bregenz Christian Dutler Karl Zweifel Grenzpolizisten, Schlepper Alice Grüninger seine Frau Ruth ihre Tochter Grenzpolizisten Ernst Kamm Sydney Dreyfuss DIEPOLDSAU SG Leiter Israelitische Flüchtlingshilfe St. Gallen Flüchtlingsheim Alte Spinnerei Alfons Eigenmann Gasthaus wohnt in Diepoldsau mit seiner Frau KANTON THURGAU Ernst Haudenschild Grenzpolizist, Leiter des Flüchtlingsheims Diepoldsau Polizeihauptmann des Kantons Thurgau schWeiZ Andere Kantone Schweizerische Eidgenossenschaft BERN Bundesrat EJPD Eidg. Justiz- und Polizeidepartement Heinrich Rothmund Chef der Polizeiabteilung des EJPD und der Zentralstelle der Fremdenpolizei Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. Robert Frei Zur Untersuchung illegaler Grenzübertritte an die Schweizer Grenze im Kanton St. Gallen abbestellt 29 2.2 Materialset QueLLen und dARsteLLunGen Q1 „Die Schweiz als Zufluchtsort Vertriebener, das ist unsere edle Tradition. Das ist nicht nur unser Dank an die Welt für den jahrhundertelangen Frieden, sondern auch Anerkennung für die grossen Werte, die uns der heimatlose Flüchtling von jeher gebracht hat. Worte am Höhenweg der Schweizerischen Landesausstellung in Zürich, Sommer 1939. Aus: Peter Ziegler, Zeiten, Menschen, Kulturen, Band 8, Zürich 1989, S. 164. Q2 „Deutschen Reichsangehörigen mit deutschem Pass, die nach den deutschen Gesetzen nicht arisch sind, wird der Grenzübertritt nur noch gestattet, wenn ihr Pass mit dem Eintrag einer Bewilligung zum Aufenthalt in der Schweiz oder zur Durchreise durch die Schweiz versehen ist. Der Visumszwang für die Inhaber österreichischer Pässe bleibt nach wie vor bestehen. Angesichts der grossen Zahl von Emigranten in der Schweiz wird erneut darauf hingewiesen, dass die Schweiz für sie nur ein Transitland sein kann und dass ihnen während ihres vorübergehenden Aufenthaltes in der Schweiz jede Erwerbstätigkeit untersagt ist. Auch der Erwerb von Liegenschaften oder die Beteiligung an schweizerischen Geschäften usw. geben keinen Anspruch auf Aufenthalt. Der neue Bundesbeschluss wird strikte durchgeführt. Er gilt nicht nur für den Grenzübertritt aus Deutschland, sondern auch aus Italien und Frankreich. Beschluss des Bundesrates vom 19. Oktober 1938. Aus: Peter Ziegler, Zeiten, Menschen, Kulturen, Band 8, Zürich 1989, S. 164. Q3 „Müssen wir grausam sein in der Gegenwart um einer unsicheren Zukunft willen, so quasi auf Vorrat hin grausam? Müssen wir Mitmenschen, die uns um Erbarmen anflehen, ins Elend und in den Tod stossen, weil es uns vielleicht auch einmal schlecht gehen kann? Nationalrat Albert Oeri, Chefredaktor der Basler-Nachrichten, 22. Sep. 1942. Aus: Peter Ziegler, Zeiten, Menschen, Kulturen, Band 8, Zürich 1989, S. 164. Q4 „Deutschland hat weder die Absicht noch den Willen, sich in die inneren österreichischen Verhältnisse einzumengen, Österreich etwa zu annektieren oder anzuschliessen. Hitler, Reichstagsrede vom 21. Mai 1935 Aus: Peter Ziegler, Zeiten, Menschen, Kulturen, Band 8, Zürich 1989, S. 97. Q5 „Die deutsche Reichsregierung hat dem Herrn Bundespräsidenten [Wilhelm Miklas] ein befristetes Ultimatum gestellt, nach dem der Herr Bundespräsident einen ihm vorgeschlagenen Kandidaten [Arthur Seyss-Inquart] zum Bundeskanzler zu ernennen und die Regierung nach den Vorschlägen der deutschen Reichsregierung zu bestellen hätte, widrigenfalls der Einmarsch deutscher Truppen in Österreich für diese Stunde in Aussicht genommen wurde. [.] Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volke mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. Wir haben, weil wir um keinen Preis, auch diesen ernsten Stunden nicht, deutsches Blut zu vergiessen gesonnen sind, unserer Wehrmacht den Auftrag gegeben, für den Fall, dass der Einmarsch durchgeführt wird, ohne Widerstand sich zurückzuziehen und die Entscheidungen der nächsten Stunden abzuwarten. [.] Rundfunkerklärung des zurückgetretenen österreichischen Bundeskanzlers von Schuschnigg an das österreichische Volk, 11. März 1938, 19.50 Uhr. Aus: Peter Ziegler, Zeiten, Menschen, Kulturen, Band 8, Zürich 1989, S. 97. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 30 2.2 Materialset Quellen und Darstellungen Q6 „In jeder Ortsgruppe der NSDAP sind sofort Aktionskomitees zu bilden zur planmässigen Durchführung des Boykottes jüdischer Geschäfte, jüdischer Waren, jüdischer Ärzte und jüdischer Rechtsanwälte. [.] Es ergehen Anordnungen an die SA und SS, um vom Augenblick des Boykotts an durch Posten die Bevölkerung vor dem Betreten der jüdischen Geschäfte zu warnen. Der Boykott setzt schlagartig Samstag, den 1. April [1933], punkt 10 Uhr vormittags ein. Aus der Anordnung der Parteileitung der NSDAP vom 28. März 1933 Aus: Peter Ziegler, Zeiten, Menschen, Kulturen, Band 8, Zürich 1989, S. 76. Q7 „Am 10. November 1938 wurde ich am frühen Morgen durch telefonische Anrufe gewarnt, ich solle nicht aus dem Haus gehen, da Juden auf der Strasse und in den Verkehrsmitteln verhaftet würden. Dies schien mir aber unwahrscheinlich, und ausserdem hatte ich nicht zu befürchten, als Jude äusserlich erkannt zu werden. Die Tauentzienstrasse [Berlin] bot einen furchtbaren Anblick. Die meisten Geschäfte hatten keine Schaufensterscheiben mehr, und die Strasse war mit Glasscherben übersät. Die Synagogen brannten immer noch. Die Feuerwehr war aufgefahren, griff aber nur ein, um die umliegenden Gebäude vor Funkenflug und Brandgefahr zu schützen. Als ich mittags nach Hause kam, teilten mir meine Kinder mit, dass sie aus ihren Schulen hinausgeworfen worden seien, und zwar in der hässlichsten Weise. Auch die Klassenkameraden hätten sich sehr schlecht benommen. Am Nachmittag begleitete ich meine Tochter zur Klavierstunde, weil ich sie nicht allein gehen lassen wollte, und brachte gleichzeitig einige Kunstgegenstände aus meiner Wohnung zu christlichen Freunden. Ich hatte genug gesehen! Als ich nach Hause kam, lief mir auf der Strasse mein Sohn entgegen und erzählte mir aufgeregt, dass bei uns ein Herr der Gestapo sitze, um mich abzuholen. Mutter lasse mir sagen, ich solle nicht nach Hause kommen. Nach kurzem Überlegen tat ich dies aber trotzdem. [.] Sigismund Weltinger, Hast du es schon vergessen?, Frankfurt 1954. Aus: Peter Ziegler, Zeiten, Menschen, Kulturen, Band 8, Zürich 1989, S. 78. D1 Flüchtlingspolitik „[.] 1938 verschärfte die Schweiz ihre Ausländer- und Flüchtlingspolitik. Fremden Menschen wurde es immer schwieriger gemacht, in unser Land zu kommen. Das war nicht etwa völlig neu. Bereits um 1900 verwehrte die Schweiz bestimmten Menschen und Gruppen die Aufnahme. Nach 1920 wurden die Abweisungen noch häufiger. Die harte Linie zeigte sich auch daran, wie man mit ausländischen Roma und Sinti umging (früher: „Zigeuner). Ähnlich behandelte man inländische Jenische (Fahrende). Man nahm ihren Familien seit 1926 mit Gewalt die Kinder weg. – Das alles war das Gegenteil vom menschenfreundlichen Bild, das die Schweiz immer wieder von sich verbreitete. Dieses humanitäre Bild wurde mit der Zeit ganz selbstverständlich. Man wollte damit auch die neutrale Haltung der Schweiz moralisch rechtfertigen. Für das Ansehen unseres Landes im Ausland und im Inland ist sehr wichtig, dass Asyl gewährt und Hilfe geleistet wurde. Dazu zählen auch die guten Dienste des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Dazu gehörte, dass sich die Regierung der Schweiz wirtschaftlich immer für einen offenen Austausch von Gütern, Kapital und Dienstleistungen (z.B. Versicherungen) über die Grenzen einsetzte; sie liess sich darin nicht oder nur sehr ungern einschränken. Wie man mit Asylsuchenden, Flüchtlingen und anderen unerwünschten Zuwanderern umging, stand in einem harten Gegensatz zum Bild von der offenen und menschlichen Schweiz. So war fremdes Geld, das durch das Bankgeheimnis geschützt war, sehr willkommen; vielen bedrängten Menschen jedoch, die vor Beraubung und Verfolgung durch die Nazi-Regierung zu fliehen versuchten, verwehrte man den Zutritt. Die vorliegenden Ergebnisse bestäti- Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 31 2.2 Materialset Quellen und Darstellungen gen das, was die Forscherinnen und Forscher bereits früher heraus gefunden haben: Die neutrale Schweiz sah sich selber als menschliches und gastfreundliches Land. Dieses selber gesteckte Ziel verfehlte sie aber in der Flüchtlingspolitik. Mehr noch: Unser Land verstiess gegen ganz zentrale Gebote der Menschlichkeit. Diese Entwicklung führte zu einschneidenden Massnahmen: Die Schweizer Regierung brachte die Nazis 1938 dazu, in die Pässe deutscher Juden ein „J zu stempeln. 1942 wurden Juden nicht als schutzwürdig anerkannt. Die Schweiz behauptete, die Juden seien nicht aus politischen Gründen aus Deutschland geflohen. Sie schloss die Grenzen für diese Menschen – in einem entscheidenden Moment. Denn in dieser Zeit war die Schweiz wegen ihrer geografischen Lage für viele Menschen die einzige Hoffnung auf Flucht und Rettung. Zwar nahm die Schweiz Kinder auf, die hier Erholungsferien machen durften. Sie weigerte sich aber, jüdische Kinder aufzunehmen. Dabei spielte die antisemitische, das heisst: gegen die Juden gerichtete Einstellung der verantwortlichen Politiker und Beamten mit. Diese Einstellung konnte offen oder versteckt sein. Antisemitismus hatten manche Juden bereits nach 1920 erfahren. Wenn sich Juden einbürgern lassen wollten, mussten sie vorher mehr Jahre in der Schweiz gewesen sein als andere Bewerber. [.] Aus: Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg. Die Schweiz, der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg. Schlussbericht. Zürich (Pendo Verlag) 2002, Seite 523 (von Kurt Messmer sprachlich vereinfacht für die Sekundarstufe I). D2 Schweizerische Gründlichkeit „[.] 1938 annektiert das Dritte Reich Österreich, zerschlägt die Tschechoslowakei und organisiert die ‚Reichskristallnacht. In diesem Jahr verschärft sich der Druck auf die jüdische Bevölkerung massiv, sie soll endgültig zur Auswanderung gezwungen werden. Aber bevor sie gehen, müssen sie ihren Besitz dem Dritten Reich ausliefern. Zur gleichen Zeit er-zwingt die Schweiz vom Dritten Reich den J-Stempel. Die Eidgenössische Material- und Druckzentrale testet die Stempelqualität: „Das Auswaschen des mittels roter Stempelfarbe aufgedruckten ist uns nicht vollständig gelungen. Ohne Schwierigkeiten wird man die zurückgebliebenen Spuren erkennen. Die Schweiz ist zufrieden. Die Massnahme erfüllt ihren Zweck: Die Juden sind an der Grenze eindeutig erkennbar und können nach Deutschland zurück geschickt werden. [.] Aus: Tages-Anzeiger 28.4.1998 Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 32 2.3 Schweizerische Flüchtlingspolitik von 1933-1939 schWeiZeRische FLüchtLinGsPoLitik Von 1933-1939 Aufgabe 1) Kritischer Umgang mit dem Medium Film Kreuze die richtige(n) Aussage(n) an und begründe in einem Satz, wieso du die Aussage als richtig erachtest. Beachte, dass mehrere Aussagen richtig sein können oder dass keine Aussage richtig sein kann. Es handelt sich beim Film „Akte Grüninger um eine Quelle, weil. eine Darstellung, weil. einen historischen Roman, weil. eine Fernsehdokumentation, weil. einen Spielfilm, weil. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 33 2.3 Schweizerische Flüchtlingspolitik von 1933-1939 Aufgabe 2) Arbeit mit Quellen Du findest zwei Materialsets zum Thema „Schweizerische Flüchtlingspolitik von 1933-1939. a) Schaue dir die zwei Materialsets genau an und setze jeweils direkt zum Materialset einen passenden Titel. b) Beschreibe in 3-4 Sätzen beide Materialsets, die jeweils verschiedene Quellen der damaligen Zeit enthalten. c) Wo siehst du Verbindungen zum Film? Erkläre je in 3-4 Sätzen. Materialset 1: Aufgabe b) Materialset 1: Aufgabe c) Materialset 2: Aufgabe b) Materialset 2: Aufgabe c) Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 34 2.3 Schweizerische Flüchtlingspolitik von 1933-1939 MAteRiALset 1 Titel: 1.1 Grenzsperre im Rheintal (zu Kriegsbeginn) Stadtarchiv Dornbirn, Photoarchiv der J.-A.Malin-Gesellschaft; Original im Archiv der Finanzdirektion für Vorarlberg, Feldkirch (Chronik des Hauptzollamtes Feldkirch, Band I) 1.2 Flüchtlinge an der Schweizer Grenze (ohne Datum) Aus: Guth Nadia, Hunger Bettina (Hrsg.), Reduit Basel 39/45, Basel 1989, S.86. 1.3 Deutscher Grenzposten an der schweizerisch-französischen Grenze bei Les Brenets, 1940 Aus: Anne Frank und wir, Stapferhaus Lenzburg 1995, S.37. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 35 2.3 Schweizerische Flüchtlingspolitik von 1933-1939 MAteRiALset 2 Titel: 2.1 Abkommen des J-Stempels Aus: Dodis, M 2.2 J-Stempel in einem deutschen Pass, nach 1938 Aus: Thomas Maissen, Schweizer Geschichte im Bild, Baden 2012, S.222. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 36 2.3 Schweizerische Flüchtlingspolitik von 1933-1939 Aufgabe 3) Debatte über die Flüchtlingspolitik (Konferenz der Polizeidirektoren, 17. August 1938) Heinrich Rothmund lud am 17. August 1938 zum Thema schweizerische Flüchtlingspolitik zu einer Sitzung ins Bundeshaus in Bern ein. Verschiedene Kantonsregierungs- und Polizeivertreter (wie Paul Grüninger, Ernst Haudenschild, Valentin Keel) nahmen teil. Es fand eine lebhafte Diskussion statt, die unterschiedliche Standpunkte zum Thema zeigte. Wer hat was gesagt? Schreibe den korrekten Namen neben die Aussage. Jeder Name kommt einmal vor. Heinrich Rothmund, Chef der Eidg. Bundespolizei Valentin Keel, Regierungsrat des Kt. St. Gallen Paul Grüninger, Polizeihauptmann des Kt. St. Gallen „Wir müssen sie (die Juden) reinlassen, alle, mit oder ohne Visum. „Die Judenverfolgung ist einfach eine Kulturschande. „Bis heute können wir froh sein, dass die Deutschen nicht mit ihrem Militär vor unserer Tür stehen. Wenn ich richtig zähle, haben wir bis heute mehr als 10.000 Flüchtlinge aufgenommen. „Mit der zunehmenden Verjudung haben die Probleme in Deutschland erst richtig angefangen. Wer von uns will Zustände wie dort? Wollen wir einen eigenen Judenhass? Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 37 2.3 Schweizerische Flüchtlingspolitik von 1933-1939 Aufgabe 4) Gründe für die restriktive Flüchtlingspolitik In der Schweiz überlebten 60‘000 Flüchtlinge die Verfolgung der Nationalsozialisten. Gleichzeitig wurden 20‘000 Flüchtlinge an der Grenze abgewiesen. Die Behörden verweigerten also Tausenden die Hilfe, obwohl sie wussten, dass sie damit die Schutzsuchenden in den Tod schickten.1 a) Welche der folgenden Gründe gegen die Flüchtlingsaufnahme kommen in der Sitzung (siehe Aufgabe 3) zum Ausdruck? Kreuze an. b) Welche der möglichen Gründe findest du in den Aussagen (Aufgabe 3)? c) Markiere die Stellen mit den entsprechenden Farben: Mögliche Gründe: Die Ernährungsgrundlage (blau) Die Kriegsgefahr (pink) Die innere Sicherheit wird durch die Flüchtlinge gefährdet. (gelb) Herrschender Antisemitismus in der Schweiz und Angst vor wachsendem Antisemitismus (grün) d) Arbeit mit dem Lehrmittel „Hinschauen und nachfragen Erläutere ausführlich die Gründe, die du angekreuzt hast, mit Hilfe der Seiten 113 114 im Lehrmittel „Hinschauen und nachfragen. Erkläre einen weiteren Grund für die Abwehr von Flüchtlingen, der im Film nicht zur Sprache kommt, ebenfalls mit Hilfe der Seiten 113 114 im Lehrmittel „Hinschauen und nachfragen in 3-5 Sätzen. 1) Vgl. Barbara Bonhage, Peter Gautschi, Hinschauen und nachfragen, S.113. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 38 2.3 Schweizerische Flüchtlingspolitik von 1933-1939 Aufgabe 5) Die Situation an der Schweizer Grenze Im Film kommen verschiedene Sequenzen vor, die die Zustände und den Umgang der Grenzpolizisten mit den Flüchtlingen an der Schweizer Grenze zeigen. Vergleiche die drei verschiedenen Sequenzen miteinander, indem du die Fragen beantwortest. SQ 4: SQ 5: SQ 6: Was geschah in der jeweiligen Szene? Wie gingen die Grenzpolizisten mit den illegal eingereisten Flüchtlingen um? Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 39 2.3 Schweizerische Flüchtlingspolitik von 1933-1939 SQ 4: SQ 5: SQ 6: Was war wohl der Grund für das Handeln der Grenzpolizisten? Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 40 2.4 Robert Frei Entscheidungen und Handlungsspielraum RobeRt FRei Aufgabe 1) Kritischer Umgang mit dem Medium Film Kreuze die richtige(n) Aussage(n) an und begründe in einem Satz, wieso du die Aussage als richtig erachtest. Beachte, dass mehrere Aussagen richtig sein können oder dass keine Aussage richtig sein kann. Es handelt sich beim Film „Akte Grüninger um. eine Quelle, weil. eine Darstellung, weil. einen historischen Roman, weil. eine Fernsehdokumentation, weil. einen Spielfilm, weil. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 41 2.4 Robert Frei Entscheidungen und Handlungsspielraum Aufgabe 2) Entscheidungen Robert Frei Untersuchung illegaler Grenzübergänge an der Schweizer Grenze im Kanton St. Gallen Ergänze die untenstehenden Sätze so, dass sie inhaltlich korrekt sind. Da Frei zufällig bei der Suche nach einem Fremdenzimmer auf den Flüchtling Karl Werner trifft, der seine Papiere nicht dabei hat, Aufgrund Werners Wollmütze, seiner Winterjacke und den Winterstiefeln schliesst Frei, dass Werner Frei will unbedingt vor Abgabe seines Berichts mit Keel sprechen, weil er will, dass Da Frei den Bericht schlussendlich doch Rothmund abgegeben hat, Da Frei die beiden Kinder, Samuel und Käthe rettet, Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 42 2.4 Robert Frei Entscheidungen und Handlungsspielraum Aufgabe 3) Zwischen Pflicht und Gewissen a) Am Schluss des Films sitzt Robert Frei in der menschenleeren Flüchtlingsunterkunft. Es scheint, als ob er uns Zuschauer direkt anschauen würde. Was könnte er dich in diesem Moment fragen wollen? Formuliere eine Frage und schreibe sie in die Sprechblase. Was könnte ihm zudem in diesem Moment durch den Kopf gehen? Schreibe deine Vermutung in die Gedankenblase. b) Stell dir vor, ein Enkelkind von Robert Frei spricht ihn heute auf seine damalige Handlung an und stellt Fragen. Frei nimmt also Jahre später Stellung zu seinem Verhalten. Was könnte er von seiner damaligen Handlung halten? Wie beurteilt er rückwirkend seine Rolle? Was würde er vielleicht anders machen? Du kannst entweder einen Dialog zwischen Robert Frei und seinem Enkelkind (fiktives Interview) schreiben oder Robert Frei in Form eines Briefs an den Enkel Stellung nehmen lassen. Umfang: Eine halbe bis 1 A4-Seite. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 43 2.4 Robert Frei Entscheidungen und Handlungsspielraum dAs ModeLL „die GeseLLschAF des hoLocAust Der Historiker und Erziehungswissenschaftler Matthias Heyl entwickelte das Modell „Die Gesellschaft des Holocaust. Erklärung des Modells: Im Zentrum sind die Zuschauer. Sie sind zugleich auch die Mitte der Gesellschaft und die zahlenmässig grösste Gruppe. Einige von ihnen entscheiden sich, „Mitläufer oder „Helfer der Täter zu sein. Manche davon werden zu expliziten Tätern. Andere Zuschauer, eine kleine Minderheit, entschliessen sich zur Hilfe für die Verfolgten und werden dadurch ev. selber zu Verfolgten. Die Juden (auch Sinti und Roma gehören dazu) gehören zur Gruppe, die von den Nazis aktiv verfolgt werden. Einigen gelingt es zu entkommen.1 Juden Entkommene Verfolgte Helfer der Verfolgten Zuschauer Mitläufer Helfer der Nazis Nazis Täter Abb.1 Die Gesellschaft des Holocaust nach Matthias Heyl 1) Matthias Heyl, Ido Abram, Thema Holocaust, ein Buch für die Schule, Reinbek 1996, S.314. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 44 2.4 Robert Frei Entscheidungen und Handlungsspielraum Aufgabe 4) a) Welche Kategorisierung trifft auf wen im Film zu? Ordne die folgenden Personen mit Hilfe der Sequenzen der passenden Kategorisierung (siehe Abb.1) zu. Schreibe diese direkt in die Tabelle. Begründe deine Zuordnung mit Beispielen aus dem Film. Tausche anschliessend deine Ergebnisse mit deinem Pultnachbar aus. Gibt es Unterschiede in der Zuordnung? Kategorisierung Begründung Karl Adolf Werner Kete und Samuel Paul Grüninger Gastwirtin der Pension b) Welche Kategorisierung nimmt Robert Frei im Modell „Die Gesellschaft des Holocaust ein? Überlege und diskutiere, ob Robert Frei einer dieser Kategorisierungen zugeordnet werden kann. Vorgehen: 1. Markiere als erstes alle Kategorisierungen im Modell und in der Tabelle, die auf Frei zutreffen, mit Farbe. 2. Als zweites setzt du entlang des Films (chronologisch, also gemäss der Entwicklung, die Frei im Film macht) Nummern zu diesen Kategorisierungen direkt ins Modell ein. 3. Vervollständige die folgende Tabelle (nächste Seite). Gib die Nummern an (Vorgehen 2) und formuliere aus, warum die jeweilige Kategorisierung passt. Begründe deine Zuordnung mit Beispielen aus dem Film. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 45 2.4 Robert Frei Aufgaben Robert Frei ist ein. Nr. weil Nazi Täter Helfer der Nazis Mitläufer Zuschauer Verfolgter Helfer der Verfolgten Jude Entkommener c) Visualisierung Stelle mit Hilfe der ausgefüllten Tabelle alleine oder zu zweit ein eigenes Modell für die Figur „Robert Frei dar, das seine Rolle und seine Haltung im Film am besten zum Ausdruck bringt. Achte darauf, dass dein Modell grafisch überzeugend dargestellt ist. Es soll deine Überlegungen möglichst gut visualisieren. Füge Beispiele aus dem Film als jeweilige Begründungen hinzu. Diskutiere in der Gruppe oder im Plenum und nimm in 2-3 Sätzen schriftlich Stellung dazu. f) Ein Modell für die Schweiz Passe das Modell „Die Gesellschaft des Holocaust von Heyl auf die Schweiz an. Entwickle alleine oder zu zweit ein Modell und stelle es auf einem Poster grafisch dar. Hilfestellung: Wo gibt es Schwierigkeiten? Warum sind das Schwierigkeiten? Gibt es Alternativen? d) Präsentation g) Präsentation Diskussion Stellt euch gegenseitig eure entworfenen Modelle für die Figur „Robert Frei vor. Diskutiert anschliessend Probleme, Ähnlichkeiten und Unterschiede. Stellt euch gegenseitig eure entworfenen Modelle vor und diskutiert anschliessend Ähnlichkeiten und Unterschiede in euren Modellen. e) Diskussion Darf man, respektive kann man überhaupt dieses Modell „Die Gesellschaft des Holocaust für die Schweiz verwenden? In unserem Fall für die Figur Robert Frei? Was spricht dafür? Was dagegen? Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 46 2.5 Paul Grüninger Entscheidungen und Grenzen PAuL GRüninGeR Aufgabe 1) Bilanz auf den Kinofilm bezogen Versetze dich in die Lage eines interessierten und engagierten Journalisten. Nachdem du den Film „Akte Grüninger im Kino gesehen hast, möchtest Du über folgende Aussage „Paul Grüninger – Verräter oder Held?, einen spannenden, interessanten und total fesselnden Artikel niederschreiben. Dein strukturierter Artikel umfasst ca. 1 – 2 A4-Seiten und enthält einen selbständig ausgewählten, spannend klingenden Titel. Du entscheidest selbst, in welcher Zeitung dein Artikel veröffentlicht wird (z.B. St. Galler Tagblatt, Neue Luzerner Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Blick, 20 Minuten, SonntagsZeitung) und passt den Schreibstil entsprechend an. Als Hilfsmittel dienen dir die auf den weiteren Seiten aufgeführten Materialien und deine Recherchebeiträge. Beachte, dass alle Journalisten ihre Beiträge zeitlich gliedern und auch die Vorgeschichte und die Folgen wichtige Informationen für den zukünftigen Leser sind. Benutze für diese Aufgabe separates A4-Papier. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 47 2.5 Paul Grüninger Entscheidungen und Grenzen Aufgabe 2) Bei dieser Aufgabe darfst du den Atlas als Hilfsmittel einsetzen. a) Zeichne auf der Karte (nächste Seite) deinen Wohnort mit oranger Farbe ein. b) Umfahre auf der Karte deinen Wohnkanton mit grüner Farbe. c) Umfahre den Teil der Schweizer Grenze . der an Frankreich grenzt mit blauer Farbe. der an Italien grenzt mit gelber Farbe. der an Deutschland grenzt mit schwarzer Farbe. der an Österreich grenzt mit roter Farbe. der an Lichtenstein grenzt mit violetter Farbe. d) Probiere den kleineren Kartenausschnitt auf der grossen Schweizerkarte zu verorten (welchen Teil der Schweiz wird auf der kleineren Karte dargestellt) und umranden diesen Teil mit brauner Farbe. e) Markiere folgende Ortschaften auf der Karte mit einem roten Kreuz (Hilfsmittel Atlas). Ortschaft: Kurzerklärung zu den Ortschaften: Hohenems Diepoldsau Buchs Bregenz Bern St. Margrethen Treffpunkt in der Gaststätte Grenzübergang Flüchtlingslager Grenzübergang Bezirksgefängnis Konsulat Parlamentsgebäude Polizeidepartement, Büro Rothmund Grenzposten f) Was fällt dir auf, wenn du deine roten genau beobachtest? Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 48 2.5 Paul Grüninger Entscheidungen und Grenzen Abbildung 1: Landeskarte Schweiz. Aus: schweizerkarte-kantone.png. Abbildung 2: Ausschnitt Grenzkanton St. Gallen. Aus: Jörg Krummenacher, Flüchtiges Glück. Zürich 2005, S.16. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 49 2.5 Paul Grüninger Entscheidungen und Grenzen Aufgabe 3) Streitgespräch Paul Grüninger Held oder Verräter? Bei dem Streitgespräch versuchen die Gegner (Kontra) und die Anhänger (Pro) von Paul Grüninger, ihre Position darzulegen und sich wechselseitig von deren argumentativer Überlegenheit zu überzeugen. Zu Beginn wird die Klasse in folgende, unterschiedliche Gruppen aufgeteilt: Ein/e Moderator/in (Gesprächsleiter/in) Eine Kontra – Gruppe, inkl. Gruppenchef Eine Pro – Gruppe, inkl. Gruppenchef Protokollführer/in Mind. 1 Beobachter/in, die auf die Form des Gesprächsverhaltens achtet Mind. 2 Beobachter/innen, die auf den Inhalt (Pro- und Kontra- Überlegungen) achten und Stichworte und Argumente aufschreiben und sammeln Bei Bedarf ein kleines Publikum Ablauf 1. Der Moderator die Moderatorin führt in das Thema ein. Bsp.: Liebe Mitschüler/innen, heute führen wir eine Streitgespräch zum Thema „Paul Grüninger- Held oder Verräter, durch. Folgende Frage gilt zu beantworten: „Ist Paul Grüninger ein mutiger Held mit Zivilcourage oder ein Verräter seines Amtes und Vaterlandes? Das Streitgespräch und die Argumentationen basieren auf dem Zeitraum des Kinofilms „Grüningers Fall, d.h. im Bereich von 1938-1939 (ca. 5‘). 4. Nach Ablauf der Vorbereitungszeit Alternative Ideen: treffen sich alle Schüler/innen wieder und das eigentliche Streitgespräch kann beginnen (ca. 5‘). Streitgespräch im Rahmen eines Rückblicks aus heutiger Sicht Zeitrahmen auf die gesamte Dienstzeit von Paul Grüninger erweitern Streitgespräch im Zeitrahmen nach der Dienstzeit von Paul Grüninger 5. Die Moderatorin der Moderator eröffnet und leitet die Diskussion (ca. 20-30‘). 6. Die Kontra Gruppe und die Pro Gruppe verteidigen ihre jeweilige Ansichten und versuchen, Gegenargumente zu schwächen. 7. Die Beobachter/innen verfolgen alle 2. Der Moderator die Moderatorin führt eine Abstimmung durch, bei welcher alle Schülerinnen und Schüler entscheiden, ob sie Paul Grüninger als einen mutigen Helden mit Zivilcourage oder einen Verräter seines Amtes und Vaterlandes betrachten. Das Ergebnis der Abstimmung wird auf dem Hellraumprojektor dem Whiteboard oder der Wandtafel notiert (ca. 5‘). 3. Anschliessend setzen sich die Pround Kontra-Gruppen zusammen und bereiten ihre Argumente vor. Dazu können eigene Recherchen oder die unten angefügten Texte (nächste Seiten) verwendet werden (ca. 10‘). Aussagen der Teilnehmer/innen und achten darauf, dass das Gespräch fair verläuft. Es dürfen auch Fragen vom Publikum (wenn vorhanden) gestellt werden. 8. Am Ende wird eine Auswertungsrunde durchgeführt, hierbei sollten alle Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen. Anschliessend fasst die Moderatorin der Moderator die Diskussion mit Hilfe der Protokollführerin des Protokollführers, zusammen. Die Beobachter/ innen entscheiden, ob die Pro – und Contragruppe überzeugend waren, indem sie Argumente und Stichworte aufzählen. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 50 2.5 Paul Grüninger ideensAMMLunG: te te FüR dAs stReitGesPRÄch Nach den Akten zu schliessen wurde Paul Grüninger wegen Urkundenfälschung und Amtspflichtverletzung suspendiert. Nach Ansicht der Behörden hatte er seinen Chef hintergangen und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement zu täuschen versucht. Er hatte unrichtige Dokumente angefertigt und falsche Auskünfte gegeben. Als der Untersuchungsrichter seine Ermittlungen weiterzog, kamen bald noch zusätzliche Vergehen ans Licht, und die entdeckten Straftatbestände häuften sich angeblich „von Tag zu Tag. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 9. Als Grüningers Entlassung sechs Wochen später endgültig beschlossen war, präzisierte eine zweite regierungsrätliche Bekanntmachung, es handle sich bei den Vergehen des Hauptmanns „im wesentlichen um Amtspflichtverletzung und Anstiftung zur Urkundenfälschung. Diese Delikte stünden im Zusammenhang „mit der Einreise von Emigranten. Entscheidungen und Grenzen Einreisen sollten nur bewilligt werden, „wenn einwandfrei festgestellt ist, dass es sich nicht um Juden handelt, mahnt Bundesrat Johannes Baumann am 16. Juli noch einmal, selbst das Vorliegen einer kantonalen Arbeitsbewilligung dürfte von dieser Prüfung nicht entbinden, denn es komme vielleicht vor, dass sich ein Kanton „in Bezug auf die Zugehörigkeit eines Gesuchstellers zum Judentum täusche. Die Regierung in Bern passt sich den deutschen Rassengesetzen umstandslos an. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 29. In einem Rapport ärgert sich Kantonspolizist Gabathuler am 15. August, dass andere weitermachen dürfen, er schrieb: „Bei Diepoldsau sollen zur Zeit massenhaft Juden schwarz einreisen. Was tut denn dort die Grenzwache? In dem kleinen Grenzabschnitt sollte es doch möglich sein, dieser Masseneinwanderung etwas Halt zu bieten, sonst sind unsere Zurückweisungen in Buchs oben auch zwecklos, wenn die Flüchtlinge wissen, dass sie in Diepoldsau ungehindert schwarz einreisen können. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 45. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 22. In der Diskussion liefert dann ausgerechnet der Präsident der Schweizerischen Zentralstelle für Flüchtlingshilfe, der Zürcher Polizeidirektor Robert Briner, das entscheidende Stichwort: „Können wir unsere Grenzen nicht besser verschliessen? Die Entfernung der Flüchtlinge ist schwieriger als ihre Fernhaltung, sagt Briner, fügt jedoch sofort bei, wenn andere Länder willens wären, Flüchtlinge aus der Schweiz zu übernehmen, wäre man eher wieder bereit, neue hereinzulassen. Im Kanton Zürich sind seit März 1938 rund vierhundert österreichische Jüdinnen und Juden ohne Visum eingetroffen; in Basel-Stadt leben zur Zeit 587, in Schaffhausen 120. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 47. Valentin Keel äussert sich laut Protokoll wie folgt:„St. Gallen ist ausgesprochener Einreisekanton. () Auch wir wünschen eine Verstärkung der Grenzkontrolle, können jedoch die Kosten nicht übernehmen. Der Bund muss beitragen. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 48. Es gilt sicher, dass Paul Grüninger im Jahr vor seiner Absetzung mehrere hundert, vielleicht einige tausend Menschen gerettet hat. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 9. Harry Weinreb lebt heute in Genf. Er ist zweiundsiebzig Jahre alt, 1938 war er siebzehnjährig, Verkäuferlehrling. Am 11. August ging er ohne Visum über den Strassenzoll bei Diepoldsau in die Schweiz. Er sagt: „Paul Grüninger hat mir das Leben gerettet. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 31. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 51 2.5 Paul Grüninger Entscheidungen und Grenzen Die Ausführungen des Thurgauer Kollegen seien für ihn überraschend, sagt Grüninger, denn: „Die Rückweisung der Flüchtlinge geht schon aus Erwägungen der Menschlichkeit nicht. Wir müssen viele hereinlassen. Wir haben ein Interesse daran, diese Leute möglichst zusammen zu erhalten, damit die Kontrolle erfolgen kann und ebenfalls aus hygienischen Gründen. Wenn wir die Leute abweisen, kommen sie eben schwarz und unkontrollierbar. Vollkommene Abschliessung der Grenze ist nicht möglich. Am 24. August schafft es die neunzehnjährige Schneiderin Frieda Prossner, trotz aller Kontrollen mit einer Freundin bei Diepoldsau durchzukommen. Sie schreibt aus Flushing, New York: „It was Hauptmann Grüninger, dem wir unser Leben danken können. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 48-49. Alfred Saam, Velomechaniker bei der freiwilligen Grenzschutzkompanie 6, wegen Arbeitslosigkeit drei Jahre lang Berufssoldat und 1938 im Einsatz bei Diepoldsau, sagt heute: „Es war doch etwas Verrücktes, wenn man junge Leute, die mit Hoffnungen kamen, zurückschicken musste. Man hat damals einfach alles so hingenommen und nicht weiter geforscht. Alfred Saam erinnert sich zum Beispiel an eine Frau, die durch Wasser watet, den Koffer hochhielt und der ein Schweizer Leutnant entgegenbrüllte: „Machen Sie, dass Sie zurückkommen, sonst jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf! Er selbst, sagt Saam, sei nach drei Tagen vom Wachtdienst befreit worden, weil in dem unwegsamen Gelände am Alten Rhein so viele Militärvelos kaputtgegangen seien. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 51. Wachtmeister Leonhard Grässli vom Zollamt Diepoldsau schildert in seinen Memoiren unter anderem die Ausschaffung einer jungen Frau, deren Verwandte schon früher in die Schweiz geflohen waren und sie an der Grenze erwarteten. Diese Frau, erinnert sich Grässli, sei dann auf schweizerisches Verlangen von einem deutschen Beamten in Diepoldsau abgeholt worden: „Am Arm packend zieht er sie über die Grenze, schreiend wehrt sie sich, doch der deutsche Zöllner ist stärker! Hinter dem deutschen Zollamt winkt sie ihren glücklicheren Verwandten langsam zurückgehend immer wieder zu. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 67-68. Die Tochter des Wachtmeisters, die damals fünfzehnjährige Nina Grässli, schrieb in einem Schulaufsatz im Herbst 1938: „Eines Tages brachte der Polizist zwei Juden aufs Zollamt. Einer setzte sich sofort auf die Stiege, sein Aussehen war bleich und mager. Man sah sofort, dass dieser Mann schwer gelitten hatte, dazu steckte noch eine Krankheit in ihm. ‚Zum vierten Male sind wir in der Schweiz, und jedesmal werden wir hinaus geschickt. Zu sechst sind wir hereingekommen, und uns zwei Brüder hat das Schicksal getroffen, dass wir wieder am gleichen Fleck sind wie vor zwei Tagen. Aber wir probierens noch ein einmal.‘ Dies erzählte er mit weinender Stimme, indem er nervös mit den Händen zitterte. Ja, mich hat es auch gewürgt auf dem Balkon oben, als ich dies hörte. Dass eine kultivierte Welt solche Zustände haben kann, ist unbegreiflich. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 68. Charles Tenenbaum aus Wien, der mit seiner Frau Jetty Tenenbaum im Juli gekommen war, schreibt heute aus New York: „Meine Eltern waren an der Schweizer Grenze, meine Frau ist zum Herr Grüninger damals gegangen, und er hat ihr versprochen, wenn sie über die Grenze kommen, wird er sie nicht zurückstellen, und so war es. May he rest in peace. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 72. Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe, Zürich 1998, S. 50-51. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 52 2.6 Paul Grüninger .und dann? Fallengelassen und verurteilt. Fallengelassen und verurteilt. Der Umgang mit Paul Grüninger. Aufgabe 1. Lies die beiden Texte von Wulff Bickenbach „Fallengelassen und verurteilt und „Ein Akt der Vergangenheitsbewältigung und notiere die wichtigsten Etappen des Umganges mit Paul Grüninger. Halte Daten und jeweilige Ereignisse in einer eigenen übersichtlichen Chronik fest. 2. Stelle dir folgendes Szenario vor: Der Kanton St. Gallen beschliesst im Sommer 2014, für Paul Grüninger ein Denkmal oder eine Gedenkstätte in der Stadt St. Gallen zu errichten. Ziel ist die Schaffung eines Ortes, an dem in gebührender Form an Paul Grüninger erinnert wird. Wofür würdest du dich entscheiden – ein Denkmal oder eine Gedenkstätte? Was spricht für ein Denkmal? Was dagegen? Wie steht es um eine Gedenkstätte? Entscheide dich für eine Variante und begründe diese mit einem konkreten Entwurf. Hinweis: Eine Recherche (Internet, Bibliothek) nach aktuellen Gedenkstätten oder existierenden Denkmälern kann dir möglicherweise interessante Anregungen liefern. a) Gedenkstätte Wie müsste in deinen Augen eine solche Gedenkstätte aussehen? Entwickle einen Entwurf, in dem du konkret festhälst wie der Ort „Gedenkstätte aussehen muss, der an Paul Grüninger erinnert wie die Ausstellung in der Gedenkstätte aussehen muss, die sein Wirken und seine Geschichte festhalten. Entwirf einen Plan der Gedenkstätte, auf dem du die einzelnen Bereiche der Ausstellung einzeichnest. Bestimme Objekte, Texte, Bilder und allenfalls interaktive Stationen, die in der Ausstellung eingesetzt würden und dokumentiere diese. Begründe jeweils deine Entscheidungen in einigen Sätzen. b) Denkmal Wie müsste in deinen Augen ein Denkmal aussehen? Entwickle einen Entwurf, in dem du konkret aufzeigst wie das Denkmal aussehen muss, das an Paul Grüninger erinnert wie der Text zum Denkmal lauten und die Texttafel aussehen muss, die sein Wirken und seine Geschichte festhalten. Entwirf einen Plan bzw. eine Skizze des Denkmals und dokumentiere diese mit Kommentaren. Begründe deine Entscheidungen in einigen Sätzen. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 53 2.6 Paul Grüninger .und dann? Fallengelassen und verurteilt. Te t 1 Fallengelassen und verurteilt Von Wulff Bickenbach Ende Januar 1939 hat Paul Grüninger das grosszügige wie illegale Hereinlassen jüdischer Flüchtlinge mit seiner ethisch sittlichen Grundhaltung erklärt, die es ihm seit Beginn des Flüchtlingsgeschehens verbot, diese Menschen trotz anders lautender Berner Vorgaben durch Rück- und Ausweisungen „vielleicht dem Tode auszuliefern. Er hatte daher eine persönliche moralische Grenze für sich gezogen und war Bern nicht mehr gefolgt. Anfang 1939 griff Heinrich Rothmund, Chef der Polizeiabteilung und der Fremdenpolizei im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, gemäss dem Berner Verständnis des Vorgangs -, das Fehlverhalten Grüningers auf. Er verlangte von dem Vorgesetzten Grüningers, Valentin Keel, das weisungswürdige Verhalten seines Polizeihauptmanns abzustellen. Keel liess Grüninger sofort fallen, indem er Rothmund zusagte, Grüninger die Flüchtlingskompetenz zu entziehen. Keel fürchtete um seine Wiederwahl als Regierungsrat, die im März 1939 anstand. In den einschlägigen Regierungsbesprechungen schlug er Untersuchungen gegen Grüninger vor und vermittelte seinen Regierungskollegen dabei den Eindruck, dass Grüninger eigenmächtig und ohne sein Wissen gehandelt hätte. Der Vorsteher des Polizeidepartements hatte damit die Angelegenheit auf die oberste politische Ebene des Kantons gehoben. Intern liess er die Vorwürfe durch seinen Departementssekretär prüfen, der Grüninger nicht wohlgesonnen war. Es wäre allerdings möglich gewesen, die Vorgaben von Rothmund auch intern, im administrativen Bereich des Polizeidepartements, zu lösen. Allerdings hätte Keel dann eine Mitverantwortung übernehmen müssen, wenn die Vorwürfe gegen Grüninger öffentlich geworden wären. Keel wollte aber ohne jeden Verdacht einer Beteiligung aus der Sache hervorgehen. Daher erhob er in den Regierungssitzungen im März 1939 massive Vorwürfe gegen Grüninger aufgrund seiner Flüchtlingshilfe. Dabei erwähnte er auch Grüningers Verwicklung in „Urkundenfälschungen, womit er Grüningers Versuche meinte, durch Manipulation von Einreisedaten jüdische Flüchtlinge vor einer möglichen Ausweisung zu schützen. Die nach diesen Vorwürfen Keels durch die Regierung eingeleitete offizielle Untersuchung wurde durch den Untersuchungsrichter parteiisch geführt. Er war bestrebt, Grüninger zu belasten, wie aus den noch erhaltenen Berichten und Vernehmungsprotokollen hervorgeht. Dem Abschlussbericht der Untersuchung zufolge wurden Grüningers entlastende Aussagen und seine Rechtfertigung ignoriert. Grüninger wurde nicht nur seines Dienstes enthoben, sondern auch ohne Anspruch auf Altersbezüge entlassen. Obwohl der oberste Polizeibeamte durch die administrativen Strafmassnahmen schon genug betroffen war, befand die Gesamtheit der Kantonsregierung vor allem Grüningers Verstoss gegen beamtenrechtliche Grundsätze als so schwerwiegend, dass sie eine staatsanwaltliche Strafuntersuchung initiierte. Für die Kantonsregierung war es unvorstellbar, dass einer ihrer obersten Beamten gegen Grundprinzipien der St. Galler Strafmaximen verstossen und Urkunden gefälscht hatte. Der Anlass dieser Fälschungen war für sie unerheblich. Sie wollte den Landjägerhauptmann verurteilt sehen, um das Regierungsmitglied Keel zu schützen, und suchte die gerichtliche Bestätigung dafür, dass ihre sehr harten Massnahmen gegen Grüninger gerechtfertigt waren. In Grüninger wurde schliesslich ein „Sündenbock gefunden, auf den die Verantwortung für die „Verfehlungen im Polizeidepartement abgewälzt werden konnte, eine Verantwortung, die eigentlich bei der Kantonsregierung lag. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 54 2.6 Paul Grüninger .und dann? Fallengelassen und verurteilt. Es dauerte mehr als eineinhalb Jahre, bis die Angelegenheit vor dem Bezirksgericht St. Gallen verhandelt wurde. Die Staatsanwaltschaft akzeptierte, dass Grüningers Bewusstsein für die Rechtswidrigkeit seines Handelns durch rein menschliche Gefühle und ein christlich geprägtes Pflichtbewusstsein in den Hintergrund gedrängt worden war. Daher wurde das Verfahren zum Punkt „Nichtverhinderung bzw. Ermöglichung illegaler Einreisen oder unzulässiger Tolerierung illegal Eingereister aufgehoben und nicht zur Anklage gebracht. Aus Grüningers Rechtfertigungen und Vernehmungen ging jedoch klar hervor, dass er sich der Rechtswidrigkeit seines Handelns sehr wohl bewusst war. Hätte die Staatsanwaltschaft dies aber eingeräumt, wäre die frage nach der Gesamtverantwortung zu stellen gewesen – und damit wäre dann die Verantwortung der Kantonsregierung ins Spiel gekommen. In der Folge hätte sich die Frage der Rechtmässigkeit von Weisungen und Anordnungen gestellt, und im Grunde genommen wäre es die Frage nach der Rechtmässigkeit der Schweizer Flüchtlingspolitik gewesen, die dann hätte verhandelt werden müssen. Das aber musste um jeden Preis verhindert werden. In seiner Urteilsbegründung im Dezember 1940 entschuldigte das Gericht wiederholt Grüningers pflichtwidriges Verhalten. Es wäre menschlich verständlich, unzulässige Grenzübertritte von bedrohten Flüchtlingen aktiv oder passig zu „dulden. Doch handelte das Gericht inkonsequent. Die Richter entschuldigten zwar das „Hauptvergehen Grüningers und liessen eine entsprechende Anklage fallen, die „Folgevergehen aber, die aus eben diesem „Hauptvergehen hervorgegangen waren, wurden nun geahndet: Das Gericht verurteilte Grüninger, weil er gegen St. Gallen bzw. Schweizer Beamtengrundsätze verstossen hatte. Aus: Theater St. Gallen, Szenisches Dokument von Elisabeth Gabriel und Nina Stazol, Paul Grüninger. Ein Grenzgänger, Dokumentation, 2013, S. 7-8. Te t 2 Ein Akt der Vergangenheitsbewältigung Von Wulff Bickenbach Bis Mitte der 1980er-Jahre gelang es der Kantonsregierung, jegliches Rehabilitierungsbegehren für Paul Grüninger abzuwehren. Dann jedoch begann die Abwehrfront der Kantonsregierung brüchig zu werden. Junge sozialdemokratische Abgeordnete des Kantons hatten den Pro-Grüninger-Kurs weiterverfolgt und begannen nun, die Regierung unter Druck zu setzen. Die wiederum gab nur dann nach, wenn es sich nicht mehr vermeiden liess. So kündigte sie zunächst nur an, einen Historiker mit der näheren Aufklärung des Falls zu beauftragen, setzte dieses Vorhaben aber erst 1999 um, als sie einem Historiker des Staatsarchivs einen entsprechenden Untersuchungsauftrag gab. Auf Seiten der Unterstützer Grüningers bündelte man mittlerweile die vorhandenen Kräfte durch die 1991 erfolgte Gründung des „Vereins Gerechtigkeit für Paul Grüninger (VGfPG). Durch eine sehr geschickte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit gewann der Verein langsam die Oberhand in der nicht nachlassenden öffentlichen Auseinandersetzung. Der vom Verein beauftragte Journalist und Historiker Stefan Keller öffnete durch sein ausgezeichnet recherchiertes Buch „Grüningers Fall die Tür zu einer rechtlichen Rehabilitierung. Auch der SIG (Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund) unterstützte jetzt aktiv diese Bemühungen. Ende 1993 musste die Kantonsregierung eine politische Rehabilitierung für Grüninger aussprechen, der Bundesrat folgte 1994, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass eine rechtliche Rehabilitierung auf Bundesebene nicht möglich wäre. Das Rechtsgutachten des Basler Strafrechtsprofessors Mark Pieth bildete eine Zäsur in den Rehabilitierungsbemühungen. Beauftragt vom VGfPG, bemühte sich der Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 55 2.6 Paul Grüninger .und dann? Fallengelassen und verurteilt. Gutachter zu belegen, dass Grüninger unrechtmässig verurteilt worden war und dass für eine Wiedergutmachung gute Gründe sprachen. Erst in der Folge dieses Gutachtens wuchs auch die Bereitschaft der Staatsanwaltschaft, eine Wiederaufnahme zu unterstützen. Paul Rechsteiner, der sich schon 1984 für eine Rehabilitierung Grüningers eingesetzt hatte, übernahm 1995 als Rechtsanwalt der Familie Grüninger vor Gericht Pieths Argumentation. Der Geschäftsleitende Staatsanwalt Rohrer schloss sich Rechsteiner an. Aus Rohrers Rechtsverständnis heraus war Grüninger durchaus Unrecht geschehen. Gegen zeitweilige Widerstände in der St. Galler Staatsanwaltschaft wollte er deshalb auch Wiederaufnahme und Freispruch. Das Bezirksgericht St. Gallen folgte der Beweisführung des Verteidigers und des Anklagevertreters. Es liess die Wiederaufnahme zu und sprach Grüninger posthum frei. Der zehnte Rehabilitierungsversuch für den Polizeihauptmann war von Erfolg gekrönt. Alle drei Instanzen – den Verteidiger, den Staatsanwalt und das Gericht – vereinte eine Überzeugung, nämlich dass das Urteil gegen Grüninger in einer „für das Gerechtigkeitsempfinden unerträglichen Weise als offensichtlich falsch erwiesen hatte. Das wollten alle drei Prozessbeteiligten korrigieren, oder, wie es der Geschäftsleitende Staatsanwalt Rohrer am Schluss seines Plädoyers formuliert hatte, sie wollten einen „Akt der Vergangenheitsbewältigung vollziehen. Grüningers Schicksal hat die Schweizer Zeitgeschichte beeinflusst. Seine Rehabilitierung hat dazu beigetragen, dass der Bundesrat 1996 die „Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg einsetzte und dass die Schweiz ein Gesetz zur Rehabilitierung Schweizer Flüchtlingshelfer beschloss, das 2004 in Kraft trat. Aus: Theater St. Gallen, Szenisches Dokument von Elisabeth Gabriel und Nina Stazol, Paul Grüninger. Ein Grenzgänger, Dokumentation, 2013, S. 10-11. Diese Unterrichtsmaterialien wurden an der PH Luzern am Zentrum Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (ZGE) in Kooperation mit C-FILMS erarbeitet und in Teilen erprobt. 56