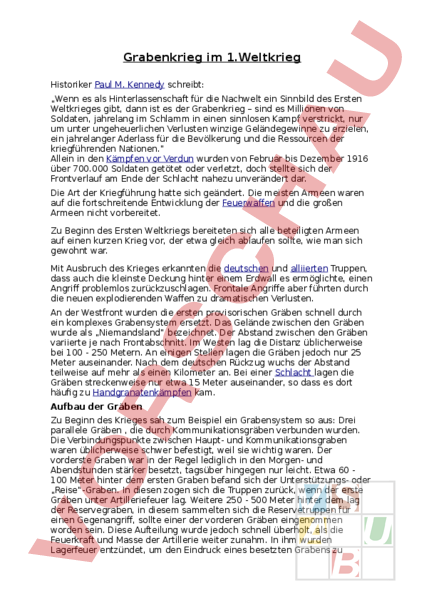Arbeitsblatt: 1. Weltkrieg, Grabenkrieg
Material-Details
Beschreib
Geschichte
Neuzeit
8. Schuljahr
6 Seiten
Statistik
147341
1159
4
18.05.2015
Autor/in
Rita Diener
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Grabenkrieg im 1.Weltkrieg Historiker Paul M. Kennedy schreibt: „Wenn es als Hinterlassenschaft für die Nachwelt ein Sinnbild des Ersten Weltkrieges gibt, dann ist es der Grabenkrieg – sind es Millionen von Soldaten, jahrelang im Schlamm in einen sinnlosen Kampf verstrickt, nur um unter ungeheuerlichen Verlusten winzige Geländegewinne zu erzielen, ein jahrelanger Aderlass für die Bevölkerung und die Ressourcen der kriegführenden Nationen. Allein in den Kämpfen vor Verdun wurden von Februar bis Dezember 1916 über 700.000 Soldaten getötet oder verletzt, doch stellte sich der Frontverlauf am Ende der Schlacht nahezu unverändert dar. Die Art der Kriegführung hatte sich geändert. Die meisten Armeen waren auf die fortschreitende Entwicklung der Feuerwaffen und die großen Armeen nicht vorbereitet. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs bereiteten sich alle beteiligten Armeen auf einen kurzen Krieg vor, der etwa gleich ablaufen sollte, wie man sich gewohnt war. Mit Ausbruch des Krieges erkannten die deutschen und alliierten Truppen, dass auch die kleinste Deckung hinter einem Erdwall es ermöglichte, einen Angriff problemlos zurückzuschlagen. Frontale Angriffe aber führten durch die neuen explodierenden Waffen zu dramatischen Verlusten. An der Westfront wurden die ersten provisorischen Gräben schnell durch ein komplexes Grabensystem ersetzt. Das Gelände zwischen den Gräben wurde als „Niemandsland bezeichnet. Der Abstand zwischen den Gräben variierte je nach Frontabschnitt. Im Westen lag die Distanz üblicherweise bei 100 250 Metern. An einigen Stellen lagen die Gräben jedoch nur 25 Meter auseinander. Nach dem deutschen Rückzug wuchs der Abstand teilweise auf mehr als einen Kilometer an. Bei einer Schlacht lagen die Gräben streckenweise nur etwa 15 Meter auseinander, so dass es dort häufig zu Handgranatenkämpfen kam. Aufbau der Gräben Zu Beginn des Krieges sah zum Beispiel ein Grabensystem so aus: Drei parallele Gräben die durch Kommunikationsgräben verbunden wurden. Die Verbindungspunkte zwischen Haupt- und Kommunikationsgraben waren üblicherweise schwer befestigt, weil sie wichtig waren. Der vorderste Graben war in der Regel lediglich in den Morgen- und Abendstunden stärker besetzt, tagsüber hingegen nur leicht. Etwa 60 100 Meter hinter dem ersten Graben befand sich der Unterstützungs- oder „Reise-Graben. In diesen zogen sich die Truppen zurück, wenn der erste Graben unter Artilleriefeuer lag. Weitere 250 500 Meter hinter dem lag der Reservegraben, in diesem sammelten sich die Reservetruppen für einen Gegenangriff, sollte einer der vorderen Gräben eingenommen worden sein. Diese Aufteilung wurde jedoch schnell überholt, als die Feuerkraft und Masse der Artillerie weiter zunahm. In ihm wurden Lagerfeuer entzündet, um den Eindruck eines besetzten Grabens zu erwecken, auch wurden Schäden umgehend repariert. Es wurden außerdem provisorische Gräben gebaut. Wenn ein grosser Angriff geplant war, wurden Sammelgräben nahe dem ersten Graben gebaut. Diese Gräben dienten als geschützter Sammelpunkt für die Truppe, die der ersten Welle nachfolgte. Die erste Angriffswelle griff üblicherweise aus dem ersten Graben heraus an. Laufgräben waren provisorische Gräben, oft unbemannte Sackgassen, die in das Niemandsland gegraben wurden. Sie dienten für einen Überraschungsangriff. Hinter dem Frontsystem lagen normalerweise einige teilweise ausgebaute Gräben für den Fall eines Rückzuges. Die Deutschen benutzten öfters mehrere hintereinander liegende, funktionsgleiche Grabensysteme. Konstruktion Gräben wurden niemals gerade gebaut, sondern immer in einem sägezahnartigen Muster, welches den Graben in Buchten einteilte, die durch Quergräben (Traversen) verbunden waren. Ein Soldat konnte nie mehr als maximal zehn Meter den Graben entlang sehen. Dadurch konnte, wenn ein Teil des Grabens durch Feinde besetzt war, nicht der gesamte Graben unter Feuer genommen werden. Auch die Splitterwirkung einer Artilleriegranate, die genau im Graben landete, wurde so begrenzt. Die Seite des Grabens, die dem Feind zugewandt war, nannte man Parapet (Brustwehr). Auf dieser Seite befand sich außerdem eine Stufe, die es ermöglichte, über den Rand des Grabens zu schauen. Die abgewandte Seite hieß Parados und schützte die Soldaten vor Splittern, falls eine Granate hinter dem Graben einschlug. Die Seiten des Grabens wurden durch Sandsäcke, Holzbretter und Drahtgeflecht verstärkt; der Boden war mit Holzbrettern abgedeckt. Um es den Soldaten zu ermöglichen, die gegnerischen Linien zu beobachten, ohne dafür ihren Kopf aus dem Graben zu erheben, wurden Scharten in die Brustwehr gebaut. Dies konnte einfach eine Lücke zwischen den Sandsäcken sein, welche aber manchmal mit einer Stahlplatte (Grabenschild) geschützt wurde Leben in den Gräben Die Zeit, die ein Soldat an der direkten Frontlinie verbrachte, war üblicherweise kurz. Sie reichte von einem Tag bis zu zwei Wochen, bevor die Einheit abgelöst wurde. Das Australische 31. Bataillon verbrachte 53 Tage an der Front bei Villers-Bretonneux (Somme). Aber eine solche Dauer war eine seltene Ausnahme. Das typische Jahr eines Soldaten konnte in etwa folgendermaßen aufgeteilt werden: 15 Frontgraben 10 Unterstützungsgraben 30 Reservegraben 20 Pause 25 anderes (Krankenhaus, Reisen, Ausbildung, etc.) Tagsüber machten Scharfschützen und Artilleriebeobachter jede Bewegung sehr gefährlich, so dass es meist ruhig war. In den Gräben wurde meist in der Nacht gearbeitet, wenn im Schutz der Dunkelheit Einheiten und Nachschub bewegt, die Gräben ausgebaut und gewartet und der Gegner ausgekundschaftet werden konnten. Posten in vorgeschobenen Stellungen im Niemandsland lauschten auf jede Bewegung in den feindlichen Linien, um einen bevorstehenden Angriff erkennen zu können. Um Gefangene zu machen, wichtige Dokumente zu erbeuten und Beute zu machen, wurden Überfälle auf den gegnerischen Graben verübt. Dies wurde jedoch mit hohen Verlusten erkauft. Tägliche Ration eines deutschen Soldaten 750g Brot, oder 500g Feldzwieback, oder 400g Eiergebäck 375g frisches oder gefrorenes Fleisch, oder 200g Dosenfleisch; 1.500g Kartoffeln, oder 125 bis 250g Gemüse, oder 60g getrocknetes Gemüse, oder 600g Kartoffeln und getrocknetes Gemüse gemischt; 25g Kaffee, oder 3g Tee; 20g Zucker; 25g Salz; 2 Zigarren und 2 Zigaretten, 1 oz. Pfeifentabak, oder 9/10 oz. Stopftabak, oder 1/5 oz. Schnupftabak; Nach Ermessen des kommandierenden Offiziers: ein Glas Branntwein (0,08 l), Wein (0,2 l) oder Bier (0,4 l). Ab etwa Ende 1915 existierten diese Mengen allerdings nur noch in den Lehrbüchern. Die Fleischration wurde während des Kriegs nach und nach reduziert und ein fleischfreier Tag wurde ab Juni 1916 eingeführt; am Ende dieses Jahres waren es 250g Frischfleisch oder 150g Dosenfleisch oder 200g Frischfleisch für Unterstützungspersonal. Gleichzeitig lag die Zuckerration bei nur 17g. Gegen Ende des Krieges wurde Fleisch zur Mangelware. Selbst das Brot wurde mit Holzspänen u. ä. versetzt, um es zu strecken. Deutsche Eiserne Ration 250g Zwieback; 200g Dosenfleisch oder 170g Speck; 150g Konservengemüse; 25g (9/10 oz.) Kaffee; 25g (9/10 oz.) Salz Sterben in den Gräben Durch die Intensität der Kämpfe starben während des Krieges etwa 10 der kämpfenden Soldaten. Zum Vergleich: Im Zweiten Weltkrieg bei 4,5 %. Für die Soldaten aller beteiligten Armeen lag die Wahrscheinlichkeit, während des Krieges verwundet zu werden, bei ca. 56 %. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass für jeden Frontsoldaten etwa drei Soldaten hinter der Front beschäftigt waren (Artillerie, Sanitäter, Nachschub etc). Daher war es sehr unwahrscheinlich für einen Frontsoldaten, den Krieg unverletzt zu überstehen. Viele Soldaten wurden sogar mehrfach verwundet. Insbesondere die häufige Verwendung von Splittergeschossen führte zu äußerst entstellenden Verletzungen. Besonders gefürchtet waren schwere Gesichtsverletzungen. Soldaten mit einer derartigen Verwundung waren in Deutschland als Kriegszermalmte und Menschen ohne Gesicht bekannt. Die medizinische Versorgung zur Zeit des Ersten Weltkrieges war vergleichsweise primitiv. Lebensrettende Antibiotika gab es noch nicht, und so erwiesen sich auch relativ leichte Verletzungen durch Infektionen und Wundbrand schnell als tödlich. Aus Untersuchungen ist bekannt, dass Verletzungen durch kupferummantelte Geschosse weniger Tote durch Sepsis forderten als Verletzungen durch Geschosse, die nicht mit kupferhaltigen Metallen ummantelt waren. Die deutschen Mediziner stellten fest, dass 12 aller Bein- und 23 aller Armverwundungen für die Betroffenen tödlich endeten. Die Ärzte der US Army ermittelten statistisch, dass 44 aller verletzten Amerikaner, die Wundbrand bekamen, starben. Die Hälfte aller Kopfverletzungen endete tödlich, und nur 1 der Soldaten mit Bauchschüssen überlebten. Drei Viertel aller Verletzungen entstanden durch die Splitterwirkung der Artilleriegranaten. Die so entstandenen Verletzungen waren oftmals gefährlicher und schrecklicher als Schusswunden. Durch die Trümmer der Granaten, die in die Wunde drangen, waren Infektionen sehr viel häufiger. Dadurch starb ein Soldat mit einer dreimal höheren Wahrscheinlichkeit an einer Splitterverletzung im Brustraum als an einer Schusswunde. Ebenso konnte sich die Druckwelle der explodierenden Granate als tödlich erweisen. Zusätzlich zu den körperlichen Verletzungen kam es zu psychischen Störungen. Soldaten, die ein lange andauerndes Bombardement durchstehen mussten, erlitten häufig einen Granatenschock („shell shock, dt. Kriegszitterer), ein posttraumatisches Stresssyndrom. Wie in früheren Kriegen wurden zahlreiche Soldaten Opfer von Infektionskrankheiten. Die sanitären Verhältnisse in den Gräben waren katastrophal, die Soldaten erkrankten an Ruhr, Typhus und Cholera. Viele Soldaten litten unter Parasiten und damit verbundenen Infektionen. Die feuchten und kalten Gräben begünstigten auch den sogenannten „Grabenfuß. Das hatte meistens eine Amputation zur Folge. Die Bestattung der Toten wurde oftmals als Luxus betrachtet, den sich keine Seite leisten wollte. Die Leichen verblieben im Niemandsland, bis die Fronten sich verschoben. Da eine Identifikation dann meist nicht mehr möglich war, wurden metallene Erkennungsmarken eingeführt, um Gefallene sicher identifizieren zu können. Zu verschiedenen Zeiten während des Krieges, jedoch hauptsächlich zu seinem Beginn, wurden offizielle Waffenruhen vereinbart, um die Verwundeten zu versorgen und die Toten zu begraben. In der Regel wurde jedoch jegliches Lockern der Offensive aus humanitären Gründen durch die jeweiligen Heeresleitungen abgelehnt. Den Truppen wurde daher befohlen, die Arbeit der feindlichen Sanitäter zu unterbinden. Diese Befehle wurden jedoch von den Soldaten im Felde meist ignoriert. Daher wurden, sobald die Kämpfe nachließen, die Verwundeten von den Sanitätern geborgen und oftmals auch Verwundete ausgetauscht. Gas als Waffe Tränengas wurde erstmals im August 1914 eingesetzt. Es war jedoch nicht sonderlich erfolgreich, da der Gegner allenfalls kurzzeitig außer Gefecht gesetzt wurde. Außerdem war die Munition für den Einsatz in geschlossenen Räumen entwickelt worden, unter freiem Himmel verflüchtigte sich der Stoff zu schnell. Am 22. April 1915 wurde erstmals Chlorgas eingesetzt. Eine genügend große Dosis wirkte tödlich, jedoch war das Gas leicht am Geruch und der dichten Gaswolke zu erkennen. Das Gas führte zu schweren dauerhaften Lungenschäden. Phosgen, erstmals verwendet im Dezember 1915, hatte eine schon sehr viel tödlichere Wirkung und war auch nicht so leicht zu entdecken wie das Chlorgas. 1916 wurde es zu Diphosgen weiterentwickelt, welches u. a. gegenüber Wasser weniger anfällig war. Das effektivste Gas war jedoch das Senfgas, welches erstmals im Juli 1917 eingesetzt wurde. Es war nicht so tödlich wie Phosgen, jedoch blieb es auf Oberflächen bestehen und führte so zu einer lange andauernden Wirkung. Außerdem wirkte das Gas auch auf die Haut, was den Schutz vor dem Gas erschwerte. Um den Stoff zum Feind zu bringen, wurde zunächst das Habersche Blasverfahren verwendet, mit dem das Chlorgas (schwerer als Luft und daher in Bodennähe konzentriert) nicht verschossen, sondern aus Behältern bei entsprechender Windrichtung in die Schützengräben geblasen wurde. Dies war jedoch sehr risikoreich, da bei sich ändernder Windrichtung das Gas in die eigenen Reihen geweht wurde. Später wurde das Gas per Wurfmine oder Artilleriegranate verschossen. Die genaue Anzahl der im Ersten Weltkrieg durch Kampfgas Vergifteten und Toten ist nur schwer festzustellen, zumal ein Großteil der Soldaten erst nach dem Krieg an den Spätfolgen verstarb: Schätzungen gehen von etwa 496.000 Vergifteten und 17.000 Toten aus, wobei die Zahl der Toten wahrscheinlich noch viel höher angesetzt werden muss. Dabei wurde der Vorteil von Kampfgasen auch weniger in der Tötung als in der Verwundung der Feinde gesehen. Ein verwundeter Soldat bindet mehr Kräfte als ein getöteter Soldat. Minen (Sprengladungen) Die Krater dieser und vieler anderer Explosionen sind heute immer noch sichtbar. Bei Messines wurden mindestens 24 Minen vergraben, von denen jedoch nicht alle zündeten. Eine wurde von den Deutschen entdeckt und entschärft, eine weitere explodierte 1955 in einem Gewitter. Mindestens drei werden noch unter der Erde vermutet, eine davon direkt unter einem Bauernhof. Bei den Kämpfen zwischen Italien und Österreich-Ungarn ab 1915 in den Alpen wurden ebenfalls massiv Minen eingesetzt, da die Stellungen in den Bergen nicht zu erobern waren. Dabei wurden ganze Berggipfel weggesprengt. Auf beiden Seiten wurden Truppen eingesetzt, die in den Stellungen horchen sollten, ob der Feind den Berg untertunnelt. Auch wurden Sprengungen benutzt, um Lawinen auszulösen. Stacheldraht Stacheldraht und andere Barrieren wurden eingesetzt, um den Vormarsch feindlicher Truppen zu verlangsamen. So musste der Angreifer erst den Drahtverhau vor den feindlichen Gräben mühselig entfernen, in der Zeit konnte er gut unter Beschuss genommen werden. Teilweise wurden auch Fallen gebaut. Aus Materialknappheit entwickelten die Deutschen einen Stacheldraht, der aus Blech gestanzt war und ein Vorläufer des heutigen NATO-Drahtes ist. Strategie Die grundlegende Strategie des Stellungskrieges ist die Abnutzung: Die Ressourcen des Gegners sollen kontinuierlich verbraucht werden, bis dieser nicht mehr in der Lage ist, einen. Kommunikation Eine der grössten Schwierigkeiten der Angreifer war eine verlässliche Kommunikation. Die kabellose Kommunikation steckte noch in den Kinderschuhen und war noch nicht einsatztauglich. Daher verwendete man Telefon, Semaphor, Signallampe, Signalpistole, Brieftaube, Meldehund und Meldeläufer. Keine dieser Methoden war jedoch zuverlässig. Das Telefon war die effektivste Methode, jedoch waren die Kabel gegen Artilleriefeuer sehr anfällig und wurden meistens schon früh in der Schlacht durchtrennt. Um dies auszugleichen, wurden die Kabel im leiterartigen Muster verlegt, damit mehrere redundante Leitungen zu Verfügung standen. Leuchtgeschosse wurden zur Erfolgsmeldung genutzt oder um einen vorher abgesprochenen Artillerieangriff zu starten. Es war nicht ungewöhnlich, dass ein kommandierender Offizier zwei bis drei Stunden auf Meldungen über den Verlauf einer Schlacht warten musste. Dadurch wurden schnelle Entscheidungen unmöglich gemacht. Deutscher Stoßtrupp im Ersten Weltkrieg Auch wenn der Zweite Weltkrieg mobiler war als der Erste, bleibt dennoch ein Vermächtnis des Grabenkriegs bis in die heutige Kriegsführung erhalten. Dieses Vermächtnis ist die massive Feuerkraft, die über eine große, nun mobile Front verfügbar war. Diese Entwicklung führte zu Zerstörungen, die im Vergleich zu denen der Kriege des 18. und 19. Jahrhunderts erschreckend waren. Zusätzlich hatten die taktischen Neuerungen, die den Stellungskrieg überflüssig machten, einen immensen Einfluss auf die Kriegsführung. Noch heute ist die Basis des modernen Landkriegs eine kleine quasi-autonome Einheit, das sogenannte Fire Team, und eine reibungslose Kommunikation ist der Schlüssel, um die Initiative gegenüber dem Feind zu gewinnen und zu behalten. Auch in Filmen wurde der Stellungskrieg früh aufgegriffen, so versuchte Charlie Chaplin bereits 1918, den Krieg in Gewehr über (Shoulder Arms) ein wenig auf die leichte Schulter zu nehmen, ohne ihn jedoch zu verharmlosen. Die amerikanische Remarque-Verfilmung Im Westen nichts Neues von 1930 war ein internationaler Erfolg und gilt noch heute als einer der beeindruckendsten Antikriegsfilme. Auch heute noch wird der Grabenkrieg immer wieder in Film und Fernsehen thematisiert. Die letzten sechs Folgen der britischen ComedyFernsehserie Black Adder, die zentrale Epochen der englischen Geschichte satirisch darstellt, spielen in Schützengräben des Ersten Weltkriegs.