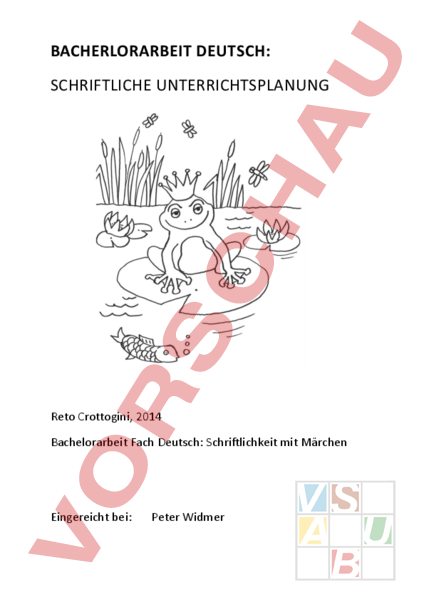Arbeitsblatt: Unterrichtseinheit Comics schreiben
Material-Details
Eine Unterrichtseinheit für das Verfassen von Comics
Deutsch
Texte schreiben
8. Schuljahr
33 Seiten
Statistik
147482
1331
14
21.05.2015
Autor/in
Peter Lampert
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
BACHERLORARBEIT DEUTSCH: SCHRIFTLICHE UNTERRICHTSPLANUNG Reto Crottogini, 2014 Bachelorarbeit Fach Deutsch: Schriftlichkeit mit Märchen Eingereicht bei: Peter Widmer INHALTSVERZEICHNIS 1 Bedingungsanalyse 3 2 Sachanalyse . 3 2.1 2.2 2.3 2.4 Inhaltliche Analyse 3 Sprachlernthema: Schreiben . 6 Bezug von Märchen und Schreiben . 10 Strukturskizze 11 3 Fachdidaktische Zielanalyse 12 4 Fachdidaktische Begründungsanalyse. 14 5 Analyse der Unterrichtsmaterialien 15 6 Planungen 16 6.1 6.2 Grobplanung 16 Feinplanung . 19 7 Anhang. 25 8 Literaturverzeichnis . 33 1 BEDINGUNGSANALYSE Die folgende Unterrichtseinheit wurde für eine 1. Oberstufenklasse Niveau in Rothenthurm entwickelt, welche während meines Profilpraktikums meine Klasse bildete. Die Klasse besteht aus 23 Schülerinnen und Schülern, jeweils aufgeteilt auf 8 Jungen und 15 Mädchen. Ungeachtet des jeweiligen Lernbereichs wurde viel Wert auf die Schriftlichkeit gelegt, so wurden auch Grammatikblätter auf eine saubere und korrekte Schreibweise kontrolliert und korrigiert. Die Klasse ist es sich sehr gewohnt, selbstständig und exakt zu arbeiten und müssen daher nicht rund um die Uhr kontrolliert werden. Ebenfalls ein zentraler Punkt im Unterricht waren die Feedbackregeln. Alle Schülerinnen und Schüler kennen die Feedbackregeln und können ohne besondere Hilfe der Lehrperson ein eigenständiges Feedback formulieren. Märchen sind ein Bestandteil unserer Kindheit und das unterscheidet sich auch in Rothenthurm nicht. Zwar wachsen die Kinder nicht mehr so intensiv mit Märchen auf wie unsere Generation, aber durch die verschiedenen Medien sind sie immer noch mit Märchen konfrontiert und kennen auch einige. Dennoch möchte ich, wie es in der Unterrichtssequenz zu erkennen ist, mit einem berühmten Märchen (Dornröschen) einsteigen, damit sicher alle die Funktion und Inhalte der Märchen verstanden haben (Vgl. Unterrichtsplanung). 2 2.1 SACHANALYSE INHALTLICHE ANALYSE 2.1.1 Allgemein Der Begriff Märchen bezeichnet eine literarische Textsorte und kann als Untergattung der Epik verstanden werden. „Das Märchen zählt zu den ältesten mündlich tradierten Erzählformen. Durch die Märchensammlung der Gebrüder Grimm zu Beginn des 19. Jh. hat das Märchen die Bedeutung erhalten, welche wir mit ihm verbinden.1. Es zeichnen sich fliessende Grenzen zu anderen Texten, wie Sage, Fabel oder Fantasy ab. Aufgrund der Gemeinsamkeiten ist eine eindeutige Zuordnung oft nicht einfach. Märchenhaft wird im Alltag als Synonym für besonders schön verstanden. Die Redewendung Erzähl mir keine Märchen meint Lüge oder Übertreibung. Diese Ableitungen vom Märchenbegriff machen Sinn, da sie der Vorstellung zum Märchen, passen. Es handelt sich beim Märchen, gleich wie bei der Kurzgeschichte oder Satiren, um eine kurze Prosa-Erzählung. Als formales Merkmal verläuft die Handlung gradlinig. Die Sprache gestaltet sich phrasenhaft, gleichförmig, schablonenhaft und wirkt eher eintönig. Erzählt wird im Präteritum. Die Konstellation der Figuren und das Auftreten von magischen Ereignissen, als inhaltliche Merkmale, lassen es als Genre charakterisieren2. 1 2 zit. nach o. A, Märchen Definition, o.J Vgl. Märchen Definition, o. Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 3 2.1.2 Arten von Märchen Volksmärchen: Als „Volksmärchen werden Märchen bezeichnet, welche aus dem Volksmund stammen, ohne dass man weiss, wer sie einmal erfunden hat. Sie sind ein uraltes und wertvolles Kulturgut. Sie wurden über eine lange Zeit mündlich von Märchenerzähler überliefert, wie sie heute noch im Orient zu finden sind, von Generation zu Generation. Dass sie überlebt haben verdanken wir den Märchenerzählern. Durch das einander Weitererzählen wurden sie stets verändert. So entstanden unterschiedliche Ausführungen vom gleichen Märchen. Die Brüder Grimm, als bekannteste Märchensammler haben unzählige Märchen aufgeschrieben. Bei der Verschriftlichung wurden oftmals unterschiedliche Versionen durcheinandergebracht, Ausschmückungen vorgenommen, Formulierungen geändert und die Märchen stark gekürzt. „Durch die starke sprachliche Bearbeitung haben die Gebrüder Grimm haben eine unverkennbare stilistische Form gegeben3. 4 Kunstmärchen: Im Unterschied zu den Volksmärchen sind die Urheber des Kunstmärchens bekannt: Hans Christian Andersen und Wilhelm Hauff. Im Unterschied zu den Volksmärchen gehen die Kunstmärchen etwas grosszügiger mit den Märchenmerkmalen um. Trotzdem reichen die verbleibenden Merkmale aus, um die Erzählungen der Gattung des Genre „Märchen zuzuordnen. Die Inhalte beschäftigen sich mehr mit realitätsnahen Themen. Meist sind sie länger als die Volksmärchen und erhalten so einen novellenartigen Charakter. 5 Moderne Märchen: Unterschiedlichste Erzählungen werden als sogenannt „Moderne Märchen bezeichnet. Die Begriffsdefinition „ Modernes Märchen ist sehr unklar. Subjektive Vorstellungen werden mit objektiven Merkmalen und wissenschaftlicher Begrifflichkeit durcheinander gebracht. „Moderne Märchen, welche sich intertextuell auf grimmsche Märchenbeziehen sind jedoch in der Gegenwartsliteratur weiterhin aktuell, und zwar sowohl in der Kinder- als auch in der Erwachsenenliteratur.6 Schwankmärchen: Dies sind Märchen der Grimmschen Sammlung, mit schwankhaften Zügen. 7„Auch im Schwankmärchen gewinnt der Held das Glück, aber nicht durch wunderbare Hilfe (wie im Zaubermärchen), sondern durch Klugheit und Mut.8 Feenmärchen: Französische Feenmärchen waren im 18. Jh. weit verbreitet. Sie wurden für ein höfisches Publikum geschrieben. 9 3 zit. Spinner, 2012, S. 13 Spinner, 2012, S. 13-14 5 Vgl. Spinner, 2012, S.14 6 Moderne Märchen, o. 7 Spinner, 2012, S. 14 8 Spinner, 2012, S. 14 9 Vgl. Spinner, 2012, S.14 4 Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 4 2.1.3 Merkmale von Märchen Handlung: Es gibt meist einen linearen Handlungsstrang. Es muss eine Aufgabe gemeistert werden, die eine grosse Herausforderung darstellt. Die Handlung hat einen logischen Aufbau und folgt konsequent der Reise ohne Ortswechsel oder Rückblenden. Der Protagonist, Held entwickelt sich im Verlaufe der Geschichte immer weiter, bis er am Schluss die Aufgabe gemeistert hat. „Ein immer wiederkehrendes Hauptmotiv ist der Auszug der Hauptfigur, das Bestehen von Abenteuern, die Begegnung mit wunderbaren Wesen und ein gutes Ende10. Das Märchen endet also immer mit einem Happy End. Figuren: „Sie sind typisiert, meist klar in Gute und Böse aufgeteilt.11 Formelhafte Sprache: Die Formelhaftigkeit verleiht der Märchensprache Struktur. Beispiele dafür ist die Einleitung des Märchens mit dem dazugehörigen „Es war einmal, so wie das Ende „und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute die exemplarisch für die formelhafte Sprache stehen. Dazu gibt es noch andere immer wiederkehrende Formulierungen, die häufig anzutreffen sind. Magische Zahlen: Zahlen wie drei, sieben und zwölf sind im Märchen besonders bedeutsam und sehr oft anzutreffen. Auch sie tragen mit ihrem wiederholten Erscheinen zur klaren Strukturierung des Märchens bei. Magie: Der Märchentext ist gekennzeichnet durch Fabelwesen und magische Gestalten wie Hexen, Zauberer, Zwerge, Drachen etc. sowie auch durch magische Ereignisse die zum Geschehen beitragen. Isolation: Der Held die Heldin hat die Aufgabe meist allein zu bewältigen. Jedoch stehen ihm fast immer Figuren bei, die ihm bei der Bewältigung der Herausforderung helfen. Es handelt sich meist auch um Aussenseiterfiguren. Zum Beispiel könnte es niemals ein König sein. Es ist stets zwingend jemand der allein, wie der Held, unterwegs ist oder jemand der abseits der „Zivilisation lebt (z. B. Zwerge). Gesellschaftsform: Das klassische Märchen spielt in einer königlich und landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft. Es spiel weit in der Vergangenheit und eindeutig vor der Industrialisierung (niemals kommen Maschinen, Eisenbahnen etc. vor). Nur moderne Märchen, dessen Definition äusserst unklar ist, bilden die Ausnahme. Flächenhaftigkeit: Gewalt und Brutalität werden flächenhaft, ohne Tiefengliederung vermittelt, wobei das Böse bestraft wird und meistens nicht überlebt. Figuren empfinden keinen Schmerz, sie bleiben, 10 11 Spinner, 2012, S.14 Vgl. Spinner, 2012, S. 14 Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 5 wie sie sind, jung oder alt etc., auch wenn sie hundert Jahre geschlafen haben. Einzelheiten werden nur erzählt, wenn sie unerlässlich sind. Die Menschen haben keine lebendige Innenwelt.12 Wichtige Merkmale in Kürze:13 2.2 2.2.3 Märchen enthalten prinzipiell nichts Wirkliches und sind eher in einer wunderbaren oder abstrakten Welt angesiedelt. Der Ort und die Zeit sind unbestimmt und werden nicht näher erläutert. Figuren haben ganz bestimmte Charaktereigenschaften. Sprüche, Lieder und Verse spielen eine zentrale Rolle im Märchen. Häufig gibt es Zauberformeln oder magische Reime. Die Erzählung endet immer glücklich, wobei häufig eine Moral ans Ende gesetzt wird. Der Verfasser des Märchens unbekannt, da es aus Sammlungen (Volksmärchen) stammt. SPRACHLERNTHEMA: SCHREIBEN Schreiben als Prozess Das Verfassen eines Textes ist ein Prozess. Dieser Prozess beginnt mit einem Schreibimpuls und endet mit der Entscheidung, den Text als abgeschlossen, also fertig, anzusehen. Krings (1992, S. 89) definiert Schreibprozesse daher wie folgt: Unter Schreibprozess sollen „[.]alle mentalen Prozesse und alle zugeordneten materiellen Handlungenverstanden werden, die ein Schreibprodukt[.]überhaupt erst entstehen lassen. Der Schreibprozess beginnt somit mit der Wahrnehmung einer vorgegebenen oder dem Bewusstwerden einer selbstgestellten Schreibaufgabe und endet mit der ›Verabschiedung‹ des Textproduktes in einer aus der subjektiven Sicht des Textproduzenten endgültigen Form. Der Schreibprozess ist die ›Ontogenese‹ eines Textproduktes. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass der Schreibprozess vor allem in inneren des Menschen zustande kommt. Das Produkt sieht man natürlich äusserlich, allerdings sind die Hauptelemente des Schreibens die kognitiven Gedankenvorgänge, welche für andere Menschen nicht sichtbar sind. 2.2.4 Schreibförderung – Die vier Aspekten des Schreibens Das Schreiben selbst besteht nicht nur aus dem Aspekt des Schreibens selbst. Es sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen und auch im Unterricht zu üben. Das alleinige Schreiben von möglichst vielen Texten wird schlussendlich nicht zum Erfolg führen, da wohl die Motivation für das Schreiben bei den meisten Schülerinnen und Schüler markant abnehmen würde und man meist nur einen der folgenden Aspekte des Schreibens behandeln würde. Deshalb ist es wichtig, eine gewisse Varietät in den Schreibunterricht einzubringen. Die folgende Aufzählung zeigt die vier Aspekte und unterlegt sie mit Unterrichtsideen. 12 13 Vgl. Bloom, 2001, S. 3ff Merkmale eines Märchens, o.J Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 6 Die vier Aspekte des Schreibens:14 1. 2. 3. 4. Kommunikative Bewältigung Inhalt-sachliche Bewältigung Formale Bewältigung Sprachliche Bewältigung Die Kommunikative Bewältigung bezieht sich auf die Absicht und das Schreibziel im Schreiben. Welches Ziel verfolge ich mit diesem Text? Soll dieser Text informieren oder erzählen? Die verschiedenen Textsorten müssen geübt werden und auf die jeweiligen Adressaten ausgerichtet werden. Diese Kompetenz ist insofern zentral, da unsere Schülerinnen und Schüler später Bewerbungsschreiben verfassen müssen, bei denen grossen Wert auf einen hochstehenden und flüssigen Text gelegt wird. Man spricht beim Sprechen auch unter Kollegen anders als mit einem Vorgesetzten, dies muss auch für das Schreiben gelten. Wird diese Kompetenz missachtet und man lässt nur immer eigene Texte schreiben, haben Schülerinnen und Schüler sicherlich eine geringere Chance auf ihre Lehrstelle. 15 Der zweite Aspekt liegt in der inhaltlich-sachlichen Bewältigung. Im Zentrum stehen hier die Gesamtidee und die thematische Entfaltung des Textes. Die Lernenden sollen fähig sein, einen Text nach eigenen Ideen zu schreiben und können auch einzelne Strukturen (Anfang, Ende) eigenständig verändern. Die Kompetenz zur inhaltliche Gestaltung und Ideenfindung ist natürlich eine Voraussetzung für einen guten Schreiber, ohne konkrete Basis kann man auch keinen guten Text aufbauen. Hier kann man als Lehrperson aber sehr gut unterstützen, zum Beispiel mit einer einfachen Erzählung zu einem bestimmten Ereignis oder Geschichtenketten bilden. 16 Die formale Bewältigung bildet den dritten Aspekt. Es geht um die Textdarstellung mit ihren Komponenten Titel, Absätzen und Illustrationen. Die Reihenfolge der Passagen ist zum Beispiel für eine Erörterung zentral, denn ohne einen guten Aufbau kann sie nicht funktionieren. So sollte die Lehrperson die Lernenden in die Formen der Textgestaltungen einführen, damit diese einen guten Aufbau vorweisen können. Mit einer Gliederung wird auch das Schreiben an sich einfacher, da sie sich selber einen konkreten Schreibplan formulieren können. Der Bewerbungsbrief ist auch hier wiederum das beste Beispiel, denn eine unsaubere Gestaltung macht einen schlechten ersten Eindruck und dieser ist ja heutzutage meistens ausschlaggebend.17 Der vierte und letzte Aspekt bildet die sprachliche Bewältigung. Sie wird unterteilt in die sprachliche Angemessenheit und die sprachliche Richtigkeit. Bei der sprachlichen Angemessenheit werden die verschiedenen Ausdrucksweisen, Wortwahl und Satzbau geübt. Dies kann durch Lücken in einem Text oder mit der einfachen Ersatzprobe geübt werden. Der zweite Teilaspekt wurde früher in den Schulen praktisch ohne Pause behandelt, denn hier liegt der Schwerpunkt auf der Rechtsschreibung und Grammatik. Natürlich bildet es auch heute noch einen Schwerpunkt, denn eine falsche Rechtschreibung ist eine Peinlichkeit und Hindernis im späteren Berufsleben. 18 14 Vgl. Fachgruppe DEVO, 2012, S. 28ff Vgl. Fachgruppe DEVO, 2012, S. 28 16 Vgl. Fachgruppe DEVO, 2012, S. 29/30 17 Vgl. Fachgruppe DEVO, 2012, S. 30 18 Vgl. Fachgruppe DEVO, 2012, S. 31ff 15 Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 7 2.2.5 Die vier Schreibschritte Die verschiedenen Schreibschritte bilden eine wichtige Grundlage für das erfolgreiche Schreiben. Deshalb sind diese Schreibschritte elementar und werden in die Unterrichtsplanung miteinbezogen (Vgl. Unterrichtsplanung). Die vier Schreibschritte sehen folgendermassen aus: Ideen finden Formulieren Überarbeiten Korrigieren (Fachgruppe DEVO, 2012) Diese Schreibschritte weisen eine grosse Anzahl von Unterrichtsmöglichkeiten aus. So kann jeder Schritt individuell oder kooperativ angegangen werde. Die innere Differenzierung während eines Schreibprozesses ist somit gegeben, denn der Text kann selbstständig oder in Gruppen von den Schülerinnen und Schülern verfasst werden. Im Folgenden werden einige praktische Unterrichtsbeispiele anhand der vier Schreibschritte aufgeschrieben: 1. Ideen finden 2. Formulieren individuell kooperativ (PA/GA) Mindmap 6-3-5 Methode Cluster Text aus Wörtern Kärtchen mit W-Fragen Reihumgeschichte Internetrecherche 3. Überarbeiten 4. Korrigieren Automatisches Schreiben Personenkarten Erzählpartitur Stichwortliste Kriterienraster zur Selbstbeurteilung Anleitung für die Überarbeitung Schreibkonferenz Textlupe Kriterienraster: Gegenseitiges Lesen Korrekturprogramm Redaktionsstube Gedankenreise in einer Gruppe Erzählpartitur Anfänge verschiedener Märchen schreiben (Fachgruppe DEVO, 2012) Man kann anhand der Tabelle erkennen, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten und didaktische Umsetzungen im Unterricht gibt. Jede dieser Schritte weisst viele konkrete Methoden auf und sind so im Unterricht auf der SEK Stufe umsetzbar. Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 8 2.2.6 Schreibstrategien Der Schreibprozess wurde bei der Definition von Punkt 2.2.3 immer als Gesamtes betrachtet. Ich finde es aber auch sehr wichtig für eine Lehrperson, sich der Individualität der verschiedenen Schreibstrategien bewusst zu sein. So gibt es Lernende, welche zuerst etwas schreiben müssen, damit ihnen gute Ideen kommen und andere, für jene eine gute Vorbereitung zentral ist. Aus Ortner (2000, S. 565) fand ich diese Zusammenstellung der zahlreichen Schreibstrategien: Nicht-zerlegendes Schreiben Einen Text zu einer Idee schreiben Mehrversionen oder Neuversionen schreiben Versionen redigieren Planendes Schreiben Aus dem Kopf niederschreiben Schritt für Schritt schreiben Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Text wird ohne langes Nachdenken und ohne Zwischenkorrekturen in einem Zug niedergeschrieben. Schreibdidaktische Bedeutung: Kreatives Schreiben Textproduktion geht von einem Thema, Idee oder Vorstellung aus; in der Aufsatzdidaktik im Allgemeinen erste Schreibstrategie, die Schülern beigebracht wird. Schreibdidaktische Bedeutung: traditioneller Schulaufsatz zu einem Thema Zu einem bestimmten Schreibimpuls bzw. einer Idee werden verschiedene Textvarianten verfasst. Schreibdidaktische Bedeutung: Neufassung schreiben, statt einen Text in mühevoller Kleinarbeit zu überarbeiten Zur Textproduktion wird zunächst eine Vorfassung erstellt, die dann überarbeitet wird. Danach wird der Text noch einmal geschrieben; punktuelles Überarbeiten des Textes Schreibdidaktische Bedeutung: Weiterführen und Überarbeiten von Texten, Fragelawine, Textlupe, Schreibkonferenz, Experten-Team, Ein Schreibplan, z.B. ein Gliederungsentwurf, wird erstellt: Dieser leitet den Schreibprozess bis zum Ende der Textproduktion; Schreibdidaktische Bedeutung: Verfassen eines Textes auf der Grundlage einer Gliederung oder mit Hilfe von andren Hilfen zur Entlastung wie z. B. Vorgaben zur Situation, Bildimpulse etc,) Beim Niederschreiben aus dem Kopf wird ein schon im Gedächtnis in groben Zügen entwickelter (Prä-)Text (extraliterale Textentwicklung) niedergeschrieben (Zuerst denken, dann schreiben) Schreibdidaktische Bedeutung: kaum ausgeprägt; Prätexterevisionen Die Textproduktion wird der Produktionslogik folgend so in Schritte zerlegt, dass ein Schritt auf den anderen folgt, z. B. Sichtung des Stoffes, Recherchieren, Konzipieren, Gliedern und Formulieren etc.; systematisches Hintereinander; Schreibdidaktische Bedeutung: Detaillierte Anleitungen für umfangreichere Schreibvorhaben wie z. B. Projekte, Referate, Facharbeiten Reto Crottogini 9 Working by Chaos Synkretistisches Schreiben Textteile schreiben Schreiben nach dem Puzzle-Prinzip Schrittwechsler; Beim Schreiben fängt man immer wieder mit neuen Textteilen an und lässt dafür alte liegen; Verknüpfung der Textteile miteinander; unsystematisches Hintereinander; Schreibdidaktische Bedeutung: schulisches Schreiben meist dafür nicht geeignet; am ehesten möglich beim Schreiben nach Clustering Statt in der späteren Reihenfolge der Textteile zu schreiben, werden Textteile ganz unabhängig davon verfasst (z. B. erst Hauptteil, dann Schluss und schließlich die Einleitung) Schreibdidaktische Bedeutung: Formen des kooperativen Schreibens; kollaborative Textproduktion am PC, Schreibateliers, extrem produktzerlegendes Schreiben in einer Art PuzzlePrinzip; Textproduktion ohne Überblick und vorherige Gliederung; Risiko, dass ein Text nicht beendet wird, weil das Ende der Textproduktion häufig nicht feststeht Schreibdidaktische Bedeutung: Verfassen eines schlüssig zusammenhängenden (kohärenten) Textes am PC, der u. a. auch auf Recherchen im Internet beruht Die Tabelle weist also eine grosse Zahl von verschiedenen Strategien auf. Als Lehrperson ist es wichtig, eine Auswahl von diesen Schreibstrategien vorzustellen, sie aber den Schülerinnen und Schülern nicht aufzuzwingen. 2.3 BEZUG VON MÄRCHEN UND SCHREIBEN Zugänge zu einem Märchen führen über verschiedene Wege. Dies kann sicherlich auch durch das Schreiben von selbst erzählten Märchen passieren. Durch das eigne Schreiben setzt man sich intensiver mit der Thematik Märchen auseinander und setzt sie in eigene Kontexte. Natürlich kann man auch soziale Konflikte aus dem Alltagsleben übernehmen und gleich selbst in einem Märchen lösen. Durch das eigene Schreiben wird jede Schülerin und jeder Schüler sehen, dass Märchen nicht real sind, aber durchaus Thematiken aus dem Alltag beinhalten und gedeutet werden können. Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 10 2.4 STRUKTURSKIZZE Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 11 3 FACHDIDAKTISCHE ZIELANALYSE Im Folgenden sind die Grobziele aus dem Lehrplan „Deutsch (2.Auflage, 2002) aufgeführt an die ich mich weitgehend orientieren werde. 3.1 Grobziele aus dem Lehrplan: 3. Schriftliche Kommunikation 3.1. Angemessene schriftliche Kommunikation Inhalt und Umfang eines Textes richten nach der Schreibsituation der Adressatin dem Adressaten den persönlichen Bedürfnissen. Wortwahl und Satzbau der Textsorte anpassen. Die grafischen Präsentationsformen der wichtigsten Textsorten kennen. 6. Das sprachliche Kunstwerk 6.1. Auseinandersetzung mit sprachlichen Kunstwerken Sprachliche Kunstwerke kennenlernen, sich mit ihnen auseinandersetzen, um Zugang zu ihnen und eine persönliche Beziehung zu einzelnen Werken zu finden Konkretere Ziele für das 7.Schuljahr Niveau indem ich Unterrichten werde sind: 3.2 Kennenlernen von Märchen Elemente des Märchens herausfinden Schreiben eines Märchens mit den zentralen Elementen Feinziele 3.2.1 Kognitive Ziele Die Lernenden fassen einen Text zusammen, indem sie die zentralen Aussagen aufschreiben.(K2) SuS wissen, welche wesentlichen Merkmale ein Märchen aufweist und können diese mit Beispielen erklären. (K3). Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 12 Die Lernenden schreiben die Inhalte klar und verständlich, so dass die anderen das Geschriebene nachvollziehen und begreifen können. (K2) Die Lernenden interpretieren den Hintergrund der Taten der Charaktere des Märchens und geben mögliche Gründe für dessen Aktionen wieder. (K5) Die Lernenden analysieren ihre eigenen Märchen vergleichen diese mit den Mitschülern. (K3 K4) SuS lernen eigenständig eine Märchengeschichte zu beenden und andere zu lesen. (K4). 3.2.2 Instrumentelle Ziele Die Lernenden arbeiten zu in Gruppen an der Bearbeitung und Korrektur der Aufsätze und nutzen dieses Angebot gemeinsam. (K3) Die Lernenden arbeiten selbständig am selbstgeschriebenen Märchen und teilen sich die dafür gegebene Zeit gut ein (K3) 3.2.3 Affektive Ziele Die Lernenden vollziehen einen Perspektivenwechsel, indem sie von einem übernommenen Märchen eine Rückmeldung geben können. (K5 K6) Die Lernende reflektieren ihre geschriebenen Märchen, sowie auch diejenigen der Klassenkameraden/innen. (K6) Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 13 4 FACHDIDAKTISCHE BEGRÜNDUNGSANALYSE 4.1 Wieso Märchen? Immer wieder stellt sich die Frage, ob Märchen in der heutigen Zeit überhaupt noch zeitgemäss sind. Diese Frage kann man ganz klar mit Ja beantworten. Nach Schmelz (2013) gibt es dafür folgende Gründe: Entwicklung über Jahrhunderte in allen Völkern Symbole- und Bilderverwendungen Heldenstatus Lösungsmöglichkeiten aus Konflikten Anregung der Fantasie Dies sind alles zentrale Beispiele, wieso man auch Märchen im Unterricht behandeln sollte. Da aber primär nach dem Sprachlernthema Schreiben gefragt ist, werde ich diesen Aspekt genauer deuten. 4.2 Gegenwartsbedeutung Das Schreiben erlaubt es den Jugendlichen sich in ihrem Alltagsleben mit Mitmenschen zu verständigen, sich auszudrücken, Informationen auszutauschen und vieles mehr. Die Jugendlichen befinden sich in einer sensiblen Phase, in der sich ihre Fähigkeit zu schreiben schnell weiterentwickelt und auch ihre kognitiven Fähigkeiten sich ausreifen. Die Schule hat den Auftrag den Lernenden dazu Übungsmöglichkeiten zu biete, damit dies auch erfolgreich geschehen kann. Da die Jugendlichen von heute kein starkes Bedürfnis haben, selbstständig zu schreiben, ist es sehr wichtig, dass sie sich in der Schule mit diesem Thema befassen. Schriftlichkeit wird fächerübergreifend gebraucht und muss geübt werden, damit sie sich in ihrer Umwelt immer besser zurecht finden können. Wer nicht schreiben kann, hat ein grosses Handicap. Das Märchen eignet sich gut für die Jugendlichen, da sie viele Themen beinhaltet für die sich die Jugendlichen in diesem Alter interessieren und mit denen sich auch zu kämpfen haben und/oder bereits Erfahrungen gemacht haben. 4.3 Zukunftsbedeutung In der Arbeitswelt, so wie aber auch im normalen Alltag eines Erwachsenen spielt die Schriftlichkeit eine wichtige Rolle und wird in Zukunft immer wichtiger. Alles ist miteinander vernetzt und man Kommuniziert per Schreiben über die ganze Welt hinweg. Wir leben im Kommunikationszeitalter. Das Leben ist es ist von grossem Vorteil wenn man sich per Schreiben korrekt und verständlich ausdrücken kann. Je mehr die SuS die Möglichkeit bekommen solche Fähigkeiten zu entwickeln, desto früher sind sie reif genug, sich in der Welt zurecht zu finden und Möglichkeiten der Schriftlichkeit zu finden. 4.4 Exemplarische Bedeutung Sei es nur der Bericht in einer regionalen Zeitung, das Schreiben einer Bewerbung oder bei einem ganz normalen Nachrichtenverkehr bei dem es darum geht, wo man mit den Kollegen essen gehen will. Überall wird Schriftlichkeit gebraucht. Meist erfolgt es heute in Kurzmitteilungen, aber immer noch per Schreiben. Also kann man durch die Schriftlichkeit mit Menschen verständigen, seine Mitmenschen Überzeugen und Ziele erreichen. Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 14 4.5 Identitätsbildung Natürlich muss man nicht überall seine Meinung einbringen und Schriftlichkeit wird auch oft von der Mündlichkeit ersetzt. In der Adoleszenz geht es darum seine Persönlichkeit, eigene Wertvorstellungen, Glaubenssysteme und Interessen zu finden und zu festigen um seinen eigenen Weg und Platz auf der Welt zu finden. Die SuS können sich für das eigene Märchen entscheiden, ihre Meinung bilden, miteinander verschriftlichen, durch Gegenlesen voneinander lernen, beeinflussen und beeinflussen lassen um dies zu bewerkstelligen. Sie beschäftigen sich mit Themen, die für sie wichtig sind und mit ihren eigenen Problemen und Problemen ihrer Mitmenschen. 5 ANALYSE DER UNTERRICHTSMATERIALIEN 7.1 Arbeitsblatt: Merkmale von Märchen untersuchen Das Arbeitsblatt ist sehr geeignet für die Bestimmung der verschiedenen Merkmale von Märchen. Mit dem Originalmärchen Dornröschen können die einzelnen Faktoren herausgefunden und sogleich auch aufgeschrieben werden. Es ist eine gute Zusammenfassung der Merkmale und ich denke auch sehr schüler- und stufengerecht. 7.3 Dornröschen: Arbeitsblatt Das Märchen Dornröschen ist ein sehr berühmtes und typisches Märchen der Gebrüder Grimm. Es ist sehr schülergerecht geschrieben und hat viel Potenzial für Interpretationen. Die Problematik der undurchdringbar scheinenden Dornen, die sich im Nachhinein als Rosen herausstellen, kann man auch sehr gut im Alltagsleben finden. Zum Beispiel Prüfungsangst? Bei dieser Unterrichtseinheit ist das Märchen ebenfalls geeignet, weil es alle wichtigen Inhalte eines Märchens wiederspiegelt. Mit der Zusammenfassung beschreiben die SuS ihre Eindrücke in eigenen Worten und erhalten einen eigenen Überblick. 7.4 AB: Wie schreibe ich ein Märchen? Dieses Arbeitsblatt fand ich perfekt geeignet als Vorbereitung für den Aufsatz. Alle wichtigen Punkte werden beschrieben und mit einem Beispiel ausgeschmückt. Die SuS haben die Möglichkeit, die Ideen für ihren eigenen Aufsatz gleich hinzuschreiben und haben daher auch eine gute Planungsgrundlage. Das Kriterienraster bindet sich auch an dieses Arbeitsblatt, da die Inhalte sehr gut erläutert werden. 7.5 Kriterienraster für den Aufsatz des Märchens Das Kriterienraster bildet die Grundlage für die Bewertung des Aufsatzes. Die einzelnen Bewältigungen des Schreibens werden im Kriterienraster abgebildet und bewertet. Grob kann gesagt werden, dass es die Hälfte der Punkte für einen inhaltlich gutes Märchen gibt und die andere Hälfte für eine orthografisch saubere Arbeit. Ich denke, dies ist schülergerecht und regt dank der hohen inhaltlichen Punktzahl zu einem kreativen Märchenschreiben an. Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 15 6 6.1 PLANUNGEN GROBPLANUNG Unterrichtsplanung: 4 Doppellektionen – insgesamt 8 Lektionen à je 45 Minuten Unterrichts Einheiten im Bereich Schriftlichkeit: Märchen Lektion en (2 Lek) Thema Inhalt, Aufgaben Begrüssung, Einführung in das Thema Märchenschreiben Märchenmerkmale Erzählmerkmale Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Ziele LP sammelt die Erfahrungen der SuS in Zusammenhang mit Märchen mit einer Mind-Map an der Wandtafel. Die jeweiligen Stichworte werden kurz kommentiert. Das Märchen Dornröschen wird einzeln gelesen und nach dem Lesen kurz von den SuS zusammengefasst. Allerdings wird das Ende des Märchens nicht gezeigt. Die SuS sollen selber ein Ende schreiben. Anschliessend werden 4er Gruppen gebildet und sie lesen sich das Ende gegenseitig vor. Schlussendlich liest die LP der Klasse das Originalende vor. Mit der Originalgeschichte und dem AB Merkmale von Märchen werden die verschiedenen Merkmale von Dornröschen aufgeschrieben und durch die LP erklärt. Schlussendlich sollen die SuS drei wichtige Merkmale aufschreiben. Reto Crottogini 16 SuS kennen die wichtigsten Merkmale und den Aufbau eines Märchens. SuS lernen eigenständig eine Märchengeschichte zu beenden und andere zu lesen. Die Lernenden fassen einen Text zusammen, indem sie die zentralen Aussagen aufschreiben. Die Lernenden vollziehen einen Perspektivenwechsel, indem sie von einem gelesen Ende eines Märchens eine mündliche Rückmeldung geben können. Material Das Märchen „Dornrösch en AB Märchenm erkmale (2 Lek) Ideen finden Formulieren (2 Lek) Überarbeiten Korrigieren Repetition: Frage der LP: Was sind besondere Merkmale von Märchen? Aufschrieben einzeln ins Arbeitsheft. Anschliessende Zusammentragung an der Wandtafel. Erklärung des Ziels: Schreiben eines Aufsatzes. Einführung in das Schreiben eines Märchens mit dem AB: Wie schreibe ich ein Märchen?. AB wird gemeinsam besprochen und durchgearbeitet. SuS können jeweils gleich ihre eigenen Notizen machen. Das geschieht selbstständig, bei Ideenlosigkeit können Gespräche mit MitSuS helfen, welche selbstständig gemacht werden dürfen. LP gibt das Kriterienraster für die Bewertung ab. Selbstständiges Formulieren eines Aufsatzes. Die Lernenden wissen, welche Kriterien beim Schreiben der Märchen wichtig sind. Die Lernenden arbeiten selbständig am Aufsatz und teilen sich die dafür gegebene Zeit gut ein. Die Lernenden arbeiten zu in Gruppen an der Bearbeitung und Korrektur der Aufsätze und nutzen dieses Angebot gemeinsam. Selbstständige Arbeit am Aufsatz. Einrichten von Inseln: Bei Beendigung des Textes werden die Texte bei der Insel gegengelesen und korrigiert. Jede Schülerin und jeder Schüler muss ihren/seinen Text zur Überarbeitung geben. Deadline zur Abgabe des Textes: Ende dieser Doppelstunde. SuS müssen auf ihrem Kriterienraster eine Selbstbeurteilung abgeben, bei welchem sie sich selbst Punkte geben können. Die Lernenden arbeiten selbständig Einrichtung am Aufsatz und teilen sich die dafür der Inseln gegebene Zeit gut ein Die Lernenden arbeiten zu in Gruppen an der Bearbeitung und Korrektur der Aufsätze und nutzen dieses Angebot gemeinsam Die Lernenden vollziehen einen Perspektivenwechsel, indem sie von einem übernommenen Märchen eine Rückmeldung geben können. Die Lernende reflektieren ihre geschriebenen Märchen, sowie auch diejenigen der Klassenkameraden/innen Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 17 Kriterienras ter AB „7 Schritte zum Märchener zähler Märchenbu ch Grimm Kriterienras ter. (2 Lek) Gegenseitiges Lesen der Texte Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Die SuS teilen sich in verschiedene Gruppen auf und verteilen sich im Schulhaus. Jede Schülerin und jeder Schüler kann seine Umgebung frei wählen. In der Gruppe werden die Märchen gegenseitig gelesen und eine kurzes Feedback gegeben. LP Notenbekanntgabe durch die LP. Selbstständige Korrektur des Märchens. Reto Crottogini 18 SuS wissen anhand des Kriterienrasters, wo sie sich noch verbessern können. Die Lernenden arbeiten zu in Gruppen an der Bearbeitung und Korrektur der Aufsätze und nutzen dieses Angebot gemeinsam. Die Lernenden reflektieren ihre geschriebenen Märchen, sowie auch diejenigen der Klassenkameraden/innen. Notengebu ng Lesen der Arbeiten. 6.2 FEINPLANUNG Unterrichtsplanung Praxislehrperson: Name: Reto Crottogini Fach: Deutsch Klasse: 1A Rothenthurm Thema: Einstieg ins Thema Märchenschreiben Märchenmerkmale Erzählmerkmale (Mittel) Bausteinthema, Schwerpunkt: Datum: Voraussetzungen: Die SuS haben schon einmal etwas von Märchen gehört. Lernziele: SuS kennen die wichtigsten Merkmale und den Aufbau eines Märchens. SuS lernen eigenständig eine Märchengeschichte zu beenden und andere zu lesen. Die Lernenden fassen einen Text zusammen, indem sie die zentralen Aussagen aufschreiben. Die Lernenden vollziehen einen Perspektivenwechsel, indem sie von einem gelesen Ende eines Märchens eine mündliche Rückmeldung geben können. Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 19 Zeit Unterric htsschritte Lernproz Verlaufsplanung: ess Teilziel Inhalt Methode – Aktivität der Lehrperson – Aktivität der Schüler EI 25‘ Medien PADUA EI – ER ES 15‘ Didaktischer Kommentar (Begründung der Verlaufsplanung) Soz. form ER LP begrüsst die Lernenden. Als Einstieg sammelt die LP die Erfahrungen der SuS in Zusammenhang mit Märchen mit einer Mind-Map an der Wandtafel. Die jeweiligen Stichworte werden in die entsprechende Verbindung gebracht. Es werden zwischen den Titeln und den Merkmalen von Märchen unterschieden. Die Ergebnisse werden gesammelt und ausgetauscht. Mit der Mind-Map leitet die LP über zum Märchen Dornröschen. LP gibt keinen grossen Kommentar ab, sondern teilt das AB Dornröschen an den verschiedenen SuS aus mit dem Auftrag, es still und einzeln zu lesen. Nach Beendigung des Lesens sollen sie in drei Sätzen eine kurze Zusammenfassung schreiben. KA Wandtafel EA WT LP fragt die Klasse, ob ihnen etwas an diesem Märchen aufgefallen ist. Das Ende des Märchens fehlt. Die SuS sollen selbstständig ihr eigenes Ende in diesem Märchen schreiben. Wer die Originalfassung kennt, muss eine Variante davon schreiben mit einem anderen Ausgang. Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 20 Durch die Begrüssung soll den SuS klar sein, dass der Unterricht begonnen hat. Zudem erhalten sie einen Einblick davon, was sie in der kommenden Stunde und Wochen erwartet. Ich möchte den SuS den Unterricht transparent machen. Durch das Bekanntgeben der Lernziele, wissen die SuS genau, was sie können müssen. Ich möchte einen lernzielorientierten Unterricht nach Hilbert Meyer führen. Der Unterricht soll ein Ziel verfolgen. Durch das Mind-Map werden die Vorkenntnisse der SuS miteinbezogen und im Unterricht aktiv benutzt. Das Erstellen einer MM ist sehr übersichtlich und hilft den SuS, den entsprechenden Sachverhalt zu verstehen. Durch das Weglassen des Endes wird die eigene Kreativität gefördert und verschiedene Zugänge zu den Märchen möglich gemacht. 15‘ ER 30‘ ER/ES SuS teilen sich in vier verschiedene Gruppen auf die verschiedene Endungen werden gegenseitig gelesen. Die Leser formulieren mündlich ein kurzes Feedback auf die Frage: Was hat dir an diesem Ende gefallen? Was nicht? LP liest den SuS das Ende der Originalgeschichte vor. Anschliessend verteilt die LP das AB „Merkmale von Märchen. Die SuS sollen in PA die gemeinsamen Punkte herausfinden und aufschreiben. Anschliessend werden die Lösungen in der Klasse besprochen. GA Inseln PA Merkmale von Märchen In Gruppenarbeiten wird besser zugehört und man kann sich auf ausgewählte Texte konzentrieren. Durch das Feedback werden die ersten Erfahrungen mit Märchen gemacht. Die Originalgeschichte gibt den SuS einen Eindruck von einem „echten Märchen. So können die Merkmale herausgefunden werden. Die Merkmale werden selbstständig herausgefunden und im Text überprüft. Vergleich im Plenum: War euer selbstgeschriebenes Ende ein gutes Ende für ein Märchen? Erkenntnisse werden gesammelt und gemeinsam besprochen. Als ES schreiben sich die SuS drei wichtige Merkmale in ihr Arbeitsheft. 5‘ Abschluss der Lektion. Die Lehrperson gibt den SuS ein kleines Feedback zur Stunde und fragt auch die SuS wie sie die Lektion erlebt haben. Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini Durch das kleine Feedback am Ende der Stunde, zeigt die Lehrperson den SuS auf, wie sie gearbeitet haben und welchen Eindruck die Lehrperson von der Klasse hat. Auch die SuS geben Auskunft über das Erlebte. KA 21 Unterrichtsplanung Praxislehrperson: Name: Reto Crottogini Fach: Deutsch Klasse: 1A Rothenthurm Thema: Ideen finden und formulieren Bausteinthema, Schwerpunkt: Datum: Voraussetzungen: Die SuS haben schon Vorkentnisse von Merkmalen der Märchen. Lernziele: Zeit Die Lernenden wissen, welche Kriterien beim Schreiben der Märchen wichtig sind. Die Lernenden arbeiten selbständig am Aufsatz und teilen sich die dafür gegebene Zeit gut ein. Die Lernenden arbeiten zu in Gruppen an der Bearbeitung und Korrektur der Aufsätze und nutzen dieses Angebot gemeinsam. Unterrichts Lernproz Verlaufsplanung: -schritte ess Teilziel Inhalt EI – ER ES Soz. form PADUA Methode – Aktivität der Lehrperson – Aktivität der Schüler 10‘ EI Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 LP begrüsst die Anwesenden und stellt sogleich eine Arbeitsauftrag: Schreibe drei verschiedene Merkmale von Märchen auf. Reto Crottogini KA Didaktischer Kommentar (Begründung der Verlaufsplanung) Medien/Mat erial AB Merkmale 22 Durch die Begrüssung soll den SuS klar sein, dass der Unterricht begonnen hat. Zudem erhalten sie einen Einblick davon, was sie in der kommenden Stunde erwartet. Ich möchte den SuS den Unterricht transparent machen. Durch den 20‘ ER Die LP verteilt das AB „Wie schriebe ich Märchen? Dieses Arbeitsblatt wird einzeln gelesen und eventuell schon mit eigenen Ideen ergänzt. LP verteilt nach Beendigung des Arbeitsblatts das Kriterienraster, welches die Grundlage für die Benotung des Aufsatzes bildet. LP teilt den SuS klar mit, dass die Benotung durch dieses Kriterienraster erfolgt. Ebenfalls wird das Enddatum des Aufsatzes genannt. 55‘ ES von Märchen SuS schreiben ihre Antworten in ihr Arbeitsheft und vergleichen sie anschliessend mit dem Nachbarn. Es erfolgt eine Selbstkorrektur mit dem AB „Merkmale von Märchen. Anschliessend werden die wichtigsten Merkmale von der LP noch einmal repetiert. Anschliessend gibt die LP das Ziel der heutigen Lektion bekannt: Schreiben eines Aufsatzes. Wandtafel KA EA SuS haben eine gute Grundlage für das Schreiben Kriterienrast ihrer Märchen. Sie wissen, wie es bewertet wird er und haben mit dem AB „Wie schreibe ich Märchen einen Plan. Durch die Nennung der Deadline für AB Wie den Aufsatz werden die SuS in ihrer schreibe ich Eigenständigkeit gefördert und können sich ihre Arbeit selbst einteilen. Märchen SuS schreiben selbstständig an ihrem Aufsatz. SuS haben EA/G Insel die Möglichkeit, ausserhalb des Raumes zusammen Kärtchen Ideen zu finden und besprechen. Zudem stellt die LP eine Insel zur Verfügung, welche für diejenigen benutzt werden können, die ihren Auftrag schon fertig formuliert haben. Die Aufgabe darin besteht Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini Arbeitsauftrag wird an das Vorwissen angeknüpft und wieder präsent gemacht. 23 LP passt sich den verschiedenen Strategien des Schreibers an. Durch die verschiedenen Zugänge kann jede/r sein/ihr Potenzial ausschöpfen und das Maximum an Leistung erbringen. Die innere Differenzierung nach Schreibtempo ist ebenfalls gegeben, es werden weitere Aufträge formuliert. darin, gegenseitig Arbeiten zu lesen und aufgrund des Kriterienrasters ein Feedback zu erstellen. 5‘ Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Durch das kleine Feedback am Ende der Stunde, zeigt die Lehrperson den SuS auf, wie sie gearbeitet haben und welchen Eindruck die Lehrperson von der Klasse hat. Auch die SuS geben Auskunft über das Erlebte. Abschluss der Lektion. Die Lehrperson gibt den SuS ein kleines Feedback zur Stunde und fragt auch die SuS wie sie die Lektion erlebt haben. Reto Crottogini 24 7 ANHANG 7.1 Arbeitsblatt: Merkmale von Märchen untersuchen Titel: Dornröschen Märchenanfang (Mit welchen Worten beginnt das Märchen?) Der Märchenheld befindet sich in einer Notlage (Er verliert etwas, wird verstossen oder ist unzufrieden) Die Märchenhelden sind namenlos (Sie werden nur nach ihrem Beruf oder sozialen Stand benannt, z.B. Prinzessin König, Müller, jüngster Brüder) Besondere Dinge und Wesen (Zwerge, sprechende Tiere, Hexen, goldener Schlüssel, Riesen) Zaubersprüche, Reime oder Verse (Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, und wirf Gold und Silber über mich!) Aufgaben (Welche Aufgaben muss der Märchenheld lösen?) Übernatürliche Kräfte (Fliegender, Zauberring) Eine Reise (Begibt sich der Märchenheld auf eine Wanderung? Wohin geht er?) Zahlen (3 Königssöhne, 3 Schwestern, 7 Raben) Gegensätze (Gut und böse, faul und fleißig) Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 25 Märchenende (Mit welchem Satz endet das Märchen?) Quelle: 7.2 Dornröschen Original Dornröschen Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: Ach, wenn wir doch ein Kind hätten! und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade sass, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach: Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen, das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste und ein grosses Fest anstellte. Er ladete nicht bloss seine Verwandte, Freunde und Bekannte, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer dreizehn in seinem Reiche, weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben: die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum, und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als elfe ihre Sprüche eben getan hatten, trat plötzlich die dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war, und ohne jemand zu grüssen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme: Die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und verliess den Saal. Alle waren erschrocken, da trat die zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur ihn mildern konnte, so sagte sie: Es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt. Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, liess den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreiche vebrannt werden. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, dass es jedermann, er es ansah, lieb haben musste. Es geschah, dass an dem Tage, wo es gerade fünfzehn Jahr alt ward, der König und die Königin nicht zu Haus waren, und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es allerorten herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust hatte, und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf, und gelangte zu einer kleinen Türe. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel, und als es umdrehte, sprang die Türe auf, und sass da in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. Guten Tag, du altes Mütterchen, sprach die Königstochter, was machst du da? Ich spinne, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf .Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt? sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung, und sie stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 26 wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreite sich über das ganze Schloss: der König und die Königin, die eben heimgekommen waren und in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen und der ganze Hofstaat mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hofe, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward still und schlief ein, und der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, liess ihn los und schlief. Und der Wind legt sich, und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward, und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinauswuchs, dass gar nichts davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf den Dach. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so ward die Königstochter genannt, also dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen, und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land, und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte, es sollte ein Schloss dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit hundert Jahren schliefe, und mit ihr der König und die Königin und der ganze Hofstaat. Er wusste auch von seinem Grossvater, dass schon viele Königssöhne gekommen wären und versucht hätten, durch die Dornenhecke zu dringen, aber sie wären darin hängengeblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling: Ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen. Der gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte. Nun waren aber gerade die hundert Jahre verflossen, und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter grosse schöne Blumen, die taten sich von selbst auseinander und liessen ihn unbeschädigt hindurch, und hinter ihm taten sie sich wieder als Hecke zusammen. Im Schlosshof sah er die Pferde und scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen, auf dem Dach sassen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand, der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken, und die Magd sass vor dem schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. Ende: Wird nur von der LP fertig gelesen. Da ging er weiter und sah im Saale den ganzen Hofstaat liegen und schlafen, und oben bei dem Throne lag der König und die Königin. Da ging er noch weiter, und alles war so still, dass einer seinen Atem hören konnte, und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und gab ihm einen Kuss. Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte, und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab, und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat, und sahen einander mit grossen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich; die Jagdhunde sprangen und wedelten; die Tauben auf dem Dache zogen das Köpfchen unterm Flügel hervor, sahen umher und flogen ins Feld; die Fliegen an den Wänden krochen weiter; Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 27 das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das Essen; der Braten fing wieder an zu brutzeln; und der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige, dass er schrie; und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. * ENDE * Quelle: 7.3 Dornröschen Original: Arbeitsblatt Dornröschen Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: Ach, wenn wir doch ein Kind hätten! und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade sass, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach: Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen, das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste und ein grosses Fest anstellte. Er ladete nicht bloss seine Verwandte, Freunde und Bekannte, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer dreizehn in seinem Reiche, weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben: die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum, und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als elfe ihre Sprüche eben getan hatten, trat plötzlich die anzusehen, rief sie mit lauter Stimme: Die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und verliess den Saal. Alle waren erschrocken, da trat die zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur ihn mildern konnte, so sagte sie: Es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt. Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, liess den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreiche vebrannt werden. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, dass es jedermann, er es ansah, lieb haben musste. Es geschah, dass an dem Tage, wo es gerade fünfzehn Jahr alt ward, der König und die Königin nicht zu Haus waren, und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es allerorten herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust hatte, und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf, und gelangte zu einer kleinen Türe. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel, und als es umdrehte, sprang die Türe auf, und sass da in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 28 Guten Tag, du altes Mütterchen, sprach die Königstochter, was machst du da? Ich spinne, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf .Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt? sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung, und sie stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreite sich über das ganze Schloss: der König und die Königin, die eben heimgekommen waren und in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen und der ganze Hofstaat mit ihnen. Da schliefen das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward still und schlief ein, und der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, liess ihn los und schlief. Und der Wind legt sich, und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward, und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinauswuchs, dass gar nichts davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf den Dach. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so ward die Königstochter genannt, also dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen, und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land, und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte, es sollte ein Schloss dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit hundert Jahren schliefe, und mit ihr der König und die Königin und der ganze Hofstaat. Er wusste auch von seinem Grossvater, dass schon viele Königssöhne gekommen wären und versucht hätten, durch die Dornenhecke zu dringen, aber sie wären darin hängengeblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling: Ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen. Der gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte. Nun waren aber gerade die hundert Jahre verflossen, und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter grosse schöne Blumen, die taten sich von selbst auseinander und liessen ihn unbeschädigt hindurch, und hinter ihm taten sie sich wieder als Hecke zusammen. Im Schlosshof sah er die Pferde und scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen, auf dem Dach sassen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand, der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken, und die Magd sass vor dem schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. Schreibe eine kurze Zusammenfassung (3 Sätze) Quelle: Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 29 7.4 AB: Wie schreibe ich ein Märchen? Wie schreibe ich ein Märchen? Der Anfang: Notizen „Es war einmal und dann? Überlegt euch zuerst einmal eine Figur Held oder Heldin ). Eure Figur sollte Aufgaben lösen, und Abenteuer bestehen, um am Ende dafür den Lohn zu erhalten. Z.B. Schneewittchen; sie soll erschossen werden, kann aber – dank des mitleidigen Jägers in den Wald flüchten, muss viele Abenteuer und Anschläge auf ihr Leben überstehen und wird letztendlich, durch die Liebe des jungen Prinzen, dafür belohnt. Alles wird gut! Die Hauptfigur: Held oder Heldin? In der Regel ist die Figur meistens jung, oftmals sehr arm und verzweifelt, unglücklich und allein. Doch am Ende der Geschichte wird sie glücklich, geliebt und vielleicht sogar reich und mächtig sein. Abenteuer und Aufgaben: Die guten Figuren sollten abenteuerliche und auch manchmal gefährliche Aufgaben bestehen. Böse Drachen oder mächtigen Wesen werden oftmals durch Kämpfe oder List besiegt. Auch das Erlösen von Verwunschenen oder die Rettung anderer guter Personen, sind in der Regel die Aufgabe deines Helden oder Heldin. Bestehen oder Lösen der Abenteuer und Aufgaben: In der Regel durch Mut, List, Gewitztheit, Güte und Klugheit der Figur oder auch der Eingriff eines guten Wesens, z.B. eines übermächtigen Zauberers oder eine Fee. Märchenhafte Wesen, die dabei sein können: Die Guten und Lieben! Held oder Heldin Gutmütiger König die Figur, die gerettet werden muss Fabeltiere gute Feen oder andere Helferlein, die z.B. deiner Fantasie entspringen freundliche Trolle Die Bösen und Gemeinen! die böse Stiefmutter, Stiefschwestern, Stieftante, etc. Hexen oder böse Feen mächtige gemeine Zauberer Drachen, bösartigen Monster und Fabelwesen Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 30 Die Märchensprache: Wichtig ist, dass ihr den klaren Gegensatz von Gut und Böse zum Ausdruck bringt. In der Regel werden falsches und richtiges Handeln aneinandergereiht. Gerne könnt ihr Aufzählungen benutzen, wie das erste Kind, das zweite Kind, das dritte Kind. Märchen sind meistens zeitlos (z.b. „ Es war einmal. „) und namenlos z.B. der älteste Bruder ). Woran ihr immer denken solltest, dass ihr Wiederholungen von Sprüchen, Reden, Formeln oder Wünschen und Gebeten in euer Märchen einbaut. Das „glückliche Ende: Ein Märchen sollte immer gut ausgehen. Getreu dem Motto „Ende gut – alles gut. Das Gute siegt über das Böse. Der erlösende Kuß und die anschließende glückliche Hochzeit. Das Überwinden von Flüchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute Quelle: Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 31 7.5 Kriterienraster für den Aufsatz des Märchens Pkt. Kriterium Aufsatz Märchen Selbstbewertung Wieso? Inhaltliche Bewältigung (10) 1 Anfang Die Geschichte beginnt mit „Es war einmal Der Anfang fesselt den Leser und regt zum Weiterlesen an. Die Hauptfigur wird in die Geschichte eingeführt. 3 2 Hauptteil Das Märchen beruht auf einem Abenteuer, das gelöst wird. Es kommen kreative märchenhafte Wesen in der Geschichte vor. Es gibt Gute und Böse in deinem Märchen. 5 3 Schluss Das Gute gewinnt gegenüber dem Bösen. Du schreibst ein HappyEnd in der Geschichte. 2 Eine märchentypische Schlusshandlung wird beschrieben (Kuss, Hochzeit, usw.) „wenn sie nicht gestorben sind,. Formale und sprachliche Bewältigung Der formale Rahmen wird eingehalten (ca. 1,5 A4 Seiten) Das Märchen ist interessant erzählt und leserfreundlich geschrieben. Die Märchensprache wird eingehalten 5 Die Rechtschreibung und die Grammatik sind korrekt verwendet. (pro 5 Fehler gibt es einen halben Punkt Abzug) TOTAL 5 20 NOTE KOMMENTAR Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 32 8 LITERATURVERZEICHNIS Bloom, I. (2001). Zur Bedeutung von Märchen für die Entwicklung des Kindes, dargestellt an ausgewählten Beispielen für den Grundschulunterricht. (besucht am 10.5.14). Fachgruppe Deutsch (2012). Unterrichtsbilder – Unterrichtskonzepte im Deutschunterricht. Luzern: PHZ Luzern. Krings, H-P (1992). Schwarze Spuren auf weißem Grund- Fragen, Methoden und Ergebnisse der empirischen Schreibprozessforschung im Überblick. In: Krings, Hans P. /Antos, Gerd (Hg.): Textproduktion. Neue Wege der Forschung. Trier: WVT. o. (o. J). Märchen-Definition. (besucht am 10.5.14). o. (o. J). Merkmale eines Märchens. (besucht am 10.5.14). o. (o. J). Moderne Märchen. (besucht am 10.5.14). Ortner, H. (2000): Schreiben und Denken. Tübingen: Niemeyer. Schmelz, A. (o. J). Wie Märchen die Entwicklung Ihres Kindes unterstützen. (besucht am 10.5.14). Spinner, K. (2012). Kurzgeschichten Kurze Prosa. Grundlagen Methoden Anregungen für den Unterricht. Seelze: Kallmeyer. Spörl, Uwe (2004). Basislexikon Literaturwissenschaft. Paderborn: Verlag Ferdinand Schönigh. Bachelorarbeit Deutsch FS 2014 Reto Crottogini 33