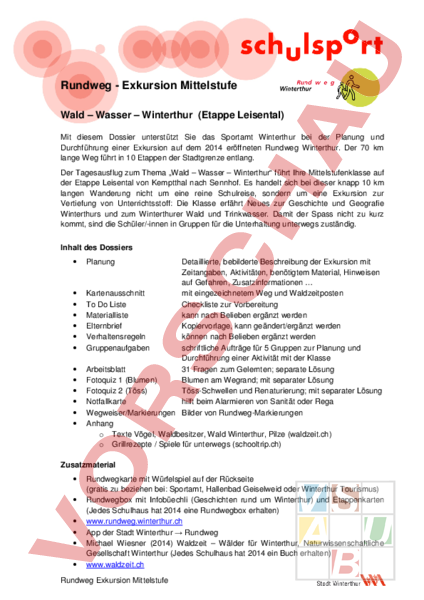Arbeitsblatt: Exkursion "Wald - Wasser - Winterthur"
Material-Details
Eine Ganztages-Exkursion auf dem Rundweg Winterthur. Das Dossier umfasst alles Nötige zur Vorbereitung: Zeitplan, Karte, To Do Liste, Materialliste, Vorlage Elternbrief, Gruppenaufgaben, Arbeitsblätter, Zusatzmaterial
Diverses / Fächerübergreifend
Gemischte Themen
4. Schuljahr
62 Seiten
Statistik
150084
771
8
17.08.2015
Autor/in
Sportamt Winterthur (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Rundweg Exkursion Mittelstufe Wald – Wasser – Winterthur (Etappe Leisental) Mit diesem Dossier unterstützt Sie das Sportamt Winterthur bei der Planung und Durchführung einer Exkursion auf dem 2014 eröffneten Rundweg Winterthur. Der 70 km lange Weg führt in 10 Etappen der Stadtgrenze entlang. Der Tagesausflug zum Thema „Wald – Wasser – Winterthur führt Ihre Mittelstufenklasse auf der Etappe Leisental von Kemptthal nach Sennhof. Es handelt sich bei dieser knapp 10 km langen Wanderung nicht um eine reine Schulreise, sondern um eine Exkursion zur Vertiefung von Unterrichtsstoff: Die Klasse erfährt Neues zur Geschichte und Geografie Winterthurs und zum Winterthurer Wald und Trinkwasser. Damit der Spass nicht zu kurz kommt, sind die Schüler/-innen in Gruppen für die Unterhaltung unterwegs zuständig. Inhalt des Dossiers • • • • • • • • • • • • • Planung Detaillierte, bebilderte Beschreibung der Exkursion mit Zeitangaben, Aktivitäten, benötigtem Material, Hinweisen auf Gefahren, Zusatzinformationen Kartenausschnitt mit eingezeichnetem Weg und Waldzeitposten To Do Liste Checkliste zur Vorbereitung Materialliste kann nach Belieben ergänzt werden Elternbrief Kopiervorlage, kann geändert/ergänzt werden Verhaltensregeln können nach Belieben ergänzt werden Gruppenaufgaben schriftliche Aufträge für 5 Gruppen zur Planung und Durchführung einer Aktivität mit der Klasse Arbeitsblatt 31 Fragen zum Gelernten; separate Lösung Fotoquiz 1 (Blumen) Blumen am Wegrand; mit separater Lösung Fotoquiz 2 (Töss) Töss-Schwellen und Renaturierung; mit separater Lösung Notfallkarte hilft beim Alarmieren von Sanität oder Rega Wegweiser/Markierungen Bilder von Rundweg-Markierungen Anhang Texte Vögel, Waldbesitzer, Wald Winterthur, Pilze (waldzeit.ch) Grillrezepte Spiele für unterwegs (schooltrip.ch) Zusatzmaterial • • • • • • Rundwegkarte mit Würfelspiel auf der Rückseite (gratis zu beziehen bei: Sportamt, Hallenbad Geiselweid oder Winterthur Tourismus) Rundwegbox mit Infobüechli (Geschichten rund um Winterthur) und Etappenkarten (Jedes Schulhaus hat 2014 eine Rundwegbox erhalten) www.rundweg.winterthur.ch App der Stadt Winterthur Rundweg Michael Wiesner (2014) Waldzeit – Wälder für Winterthur, Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur (Jedes Schulhaus hat 2014 ein Buch erhalten) www.waldzeit.ch Rundweg Exkursion Mittelstufe Planung Rundweg Exkursion Mittelstufe Etappe: Leisental: Kemptthal Bahnhof Sennhof Thema: Wald, Wasser, Winterthur Distanz: Wanderzeit: Anfahrt: Rückfahrt: Zeit Ort Details, Informationen Aktivität ??? Schulhaus Besammlung, Begrüssung Verhaltensregeln vorstellen ??? Anfahrt 8.38 Hauptbahnhof 8.42 Bahnhof Kemptthal ehemalige Maggi-Fabrik S7 bis Kemptthal; Abfahrt Gleis 6 Ankunft Gleis 3; kein WC! kleiner Kiosk (nur morgens/abends geöffnet) Geschichte Industrialisierung heute: Givaudan, Nestlé 9.3 km 2h30min S7 S26 Arbeitsblatt Material Klassenliste, Verhaltensregeln Kollektivbillet; Halbtax oder GA evtl. Führung? Unterführung unter der Bahnlinie durch zur grünen Seite (Wegweiser Richtung Rossberg) Infos zum Rundweg und zur Exkursion 8.45 Tafel Rundweg Etappe Leisental 8.55 8.55 Links, dann rechts über die Brücke Querung Forststrasse, dann Weg einem kleinen Bächli entlang Gabriela Regli; Juli 2015 Arbeitsblatt verteilen und erklären Fragen 1-6 Gruppe 1 erklärt ihren Auftrag „Entdecken Arbeitsblätter kopiert Rundwegkarte Liste Entdecken Fluss Kempt im Wald, leicht bergauf Rundweg-Exkursion Mittelstufe Seite 1 Zeit Ort Details, Informationen Abzweigung: Abstecher zum südlichsten Punkt von Winterthur 9.00 9.159.30 Südlichster Punkt Winterthurs 9.309.45 Gleicher Weg zurück bis Abzweigung Aktivität Arbeitsblatt Material Fragen 7-9 Rundwegkarte schmaler, steiler Weg bergauf durch den Wald vorbei an einem Hochsitz, viele Walderdbeeren und Brombeeren, am Schluss Treppenstufen, am Waldrand rechts gehen sonniger Waldrand mit Aussicht auf Felder/Berge, 610 müM, 1 Bänkli, kein Abfalleimer Viele Fichten und Föhren Aussicht nach Dättnau und Brütten Wegweiser gut beachten! Trinkpause Grenzverlauf auf der Etappe Leisental studieren Frage 10 rechts, bei Verzweigung links und gleich wieder rechts kleiner Pfad runter 9.55- Infotafel Waldzeit Nr. 9: 10.00 Vögel im Wald Gabriela Regli; Juli 2015 Bach queren Vorsicht bei Nässe! 30-40 Vogelarten im Winterthurer Wald Nist- und Futterplätze Rundweg-Exkursion Mittelstufe Fragen 11,12 Text Waldzeit „Vögel Seite 2 Zeit Ort Details, Informationen Aktivität Arbeitsblatt Material Frage 13 RundwegBüechli S. 104 Fragen 14-18 Znüni Text Waldzeit: „Waldbesitzer bergauf, dann flach Golfplatz Rossberg (eröffnet 2004) nicht betreten! Teerstrasse, dann Feldweg durch den Golfplatz Rossberg geschichtlicher Hof und Kapelle (Infos im Rundweg-Büechli) Restaurant, Platz, Uhr, einzelne Bänkli Parkplatz Golfplatz Kyburg, dann vorbei an Driving Range Einzelne Bänkli, Trinkbrunnen 1 Bänkli am Waldrand im Schatten 10.20- Infotafel Waldzeit Nr. 8: 10.50 Wem gehört der Wald? kleiner Pfad runter 11.00 Infotafel Waldzeit Nr. 7a: Haselmaus Gabriela Regli; Juli 2015 Flaschen auffüllen Znünipause Waldbesitzer: 2/3 Stadt Winterthur, Rest Kanton Zürich, Private Kleines Spiel (Gr. 2) Treppenstufen im Wald Treppenstufen zählen Frage 19 Kreuzung nach Tümpel, grosse Wiese mit hohem Gras Haselmaus: nachtaktiv (Infos Büechli) Rundweg-Exkursion Mittelstufe RundwegBüechli S. 106 Seite 3 Zeit Ort Details, Informationen Aktivität Arbeitsblatt Abstecher zur Haselmausbrücke Links bis zur Tafel und wieder zurück Infotafel Waldzeit Nr. 7b: nach rechts bis zur Schranke dann links zur Waldweg Brunibrücke 11.05Infotafel Waldzeit Nr. 6 11.10 Holzbrücke aus dem Jahr 1839, wurde 1974 von Pfungen hierher verlegt. (Infos im Büechli) Im Halbschatten, viele Wurzeln, diverse kleine Feuerstellen (weniger ideal für die ganze Klasse), z.T. Bänkli Weg der Töss entlang 11.25Infotafel Waldzeit Nr. 5 11.30 Frage 20 Blick durch Fenster (immer nur 1 Kind auf Leiter!) (Grundwasserpumpwerk) Kurz nach der Tafel Abstecher links in den Wald und wieder zurück auf den Weg. des Winterthurer Trinkwassers stammt von hier, Trinkbrunnen (Infos im Büechli) Rundweg-Exkursion Mittelstufe Fragen 21-22 RundwegBüechli S. 97 Fotoquiz 12: Blumen und Schwellen entdecken und nummerieren Kopien Fotoquiz 12 Fragen 23, 24 Flasche auffüllen am Trinkbrunnen Text Waldzeit: „Winterthurer Wald Tafel am Ende der Brücke; Brücken-Konstruktion abzeichnen Grundwasser: Der Wald als Trinkwasserfilter Reservoir Gabriela Regli; Juli 2015 RundwegBüechli S. 106 Waldnutzung früher und heute Brunibrücke Material RundwegBüechli S. 102 RundwegBüechli S. 102 Seite 4 Zeit 11.4513.00 Ort Details, Informationen Bänkli Alternative Möglichkeit für Mittagspause Infotafel Waldzeit Nr. 4: zwischen Fels und Pflanzenwelt renaturierte Töss, grosser Tisch, Bänke, Feuerstelle, Abfalleimer Infotafel Lebensraum Töss: Glögglifrosch, Eisvogel, Silberweide Weg der Töss entlang Aktivität Arbeitsblatt Mittagspause Feuer machen, bräteln, sich verweilen, Frage 25 Füsse baden Material Mittagessen Rundweg Büechli S. 102 Witz erzählen (Gr. 3) Jetzt Töss Grenze (zur Gemeinde Kyburg) Ungefährliche Kiesbänke an der Töss Schiefer-Wettkampf Ergänzung zu Frage 7 Infotafel Waldzeit Nr. 3 Wald statt Hangrutsch (Felssturz 1995, Gamser Schutzwald, Infos im Büechli) 13.1513.20 Fragen 26,27 Rundweg Büechli S. 107 Abfalleimer grosser Tisch, Bänke, Abfalleimer Feuerstelle 13.25 Infotafel Waldzeit Nr. 2 Gabriela Regli; Juli 2015 Naturschutz aber sicher Vorrangfunktionen im Leisentaler Wald Rundweg-Exkursion Mittelstufe Achtung: Hier nicht baden! Gefährliche Schwellen Frage 28 Seite 5 Zeit Ort Details, Informationen Aktivität Arbeitsblatt Material Rechts über kleines Holzbrüggli 13.30Schöne Feuerstelle 13.40 Weg auf Damm Parkplatz vor der Kyburgbrücke 13.55 Kyburgbrücke evtl. Abstecher zur Kyburg Strassenquerung Infotafel Phänomen Tösswasserversickerung Gabriela Regli; Juli 2015 Zvieri-Pause; Gleich nach dem Brüggli rechts unten. Auflösung Fotoquiz Mit Holzbänken (sonnig) Töss ist immer noch Grenzverlauf Diverse Kiesbänke, mehrere Feuerstellen Steinmannli-Türme bauen auf Kiesbank Zwei schattige Feuerstellen mit je drei Holzbänkli, Abfalleimer älteste erhaltene Holzbrücke, die noch am ursprünglichen Ort steht (Jahr 1846) Nach der Brücke links langer Treppenweg hoch; Burg erbaut um 1100 (Infos im Büechli) Weiter geradeaus der Töss entlang Lösungen Fotoquiz 12 Vor der Strasse warten bis alle da sind! Frage 29 RundwegBüechli S. 97 RundwegBüechli S. 96 Strasse gemeinsam als Klasse queren Im oberen Tösstal trocknet die Töss teilweise ganz aus, in diesem Abschnitt hier nie Rundweg-Exkursion Mittelstufe Seite 6 Zeit Ort Details, Informationen Aktivität Weiter geradeaus der Töss entlang evtl. blind gehen? (In Zweier-Gruppen) Arbeitsblatt Material Eisenbrücke über die Töss Töss-Uferweg Trinkbrunnen auf der anderen Seite der asphaltierten Strasse Vorsichtige Querung zum Flaschen füllen Klassenaufgabe(Gr.4) 14.15 Infotafel Waldzeit Nr. 1 Töss-Uferweg bis Sennhof 14.30 Spinnerei Bühler Pilze und Flechten Text Waldzeit: „Pilze Etliche kleine Feuerstellen und einzelne Bänkli am Wiesenbord; Blick auf erste Häuser von Sennhof (1500 Einwohner; Infos im Büechli), nach der Kurve Blick zur Kyburg, dann auf die Spinnerei Bühler RundwegBüechli S. 98/99 aus dem Jahr 1860 Letzte Grossspinnerei in der Schweiz Eigenes Kraftwerk (Infos im Büechli) Geradeaus weiter der Töss entlang Frage 30 RundwegBüechli S. 100 Strassenquerung bei Brücke Gabriela Regli; Juli 2015 Rundweg-Exkursion Mittelstufe Seite 7 Zeit Ort 14.35 Schulhaus Sennhof Querung der Hauptstrasse auf Höhe von Blitzkasten Details, Informationen Aktivität Arbeitsblatt Material Frage 31 Lösung Arbeitsblatt Spielplatz, Teerplatz mit Goals und Basketballkörben, WC Fussgängerstreifen, Wegweiser zum Bahnhof folgen Ganze Klasse gemeinsam über den Fussgängerstreifen Bahnhof Sennhof-Kyburg 14.45 Warten auf dem Parkplatz, WC 15.06 Rückfahrt ??? Schulhaus S26; fährt alle halben Stunden bis Winterthur Hauptbahnhof; Im Bahnhof Seen Umsteigemöglichkeiten auf den Bus Nr. 2, 3 Verabschiedung Auflösung Arbeitsblatt Buskarte kursiv zusätzlich bis wenig bis viel zusätzliche Zeit einberechnen Gabriela Regli; Juli 2015 Rundweg-Exkursion Mittelstufe Seite 8 Rundweg Exkursion Mittelstufe To Do Liste Wann? Was? Wer? 1 Quartal vorher 1 Quartal vorher Datum (evtl. Reservedatum) festlegen Exkursion in Quartalsbrief aufnehmen 1 Monat vorher 1 Monat vorher 1 Monat vorher 1 Monat vorher Begleitperson suchen Fahrplan raussuchen Schulleitung informieren Rekognoszieren* 1 Woche vorher 1 Woche vorher 1 Woche vorher 1 Woche vorher 1 Woche vorher 1 Woche vorher Elternbrief: Vorlage anpassen und verteilen Vorinformation der Klasse Gruppen einteilen und Gruppenaufgaben vorbereiten Materialliste: festlegen, wer was mitnimmt Abklärung: Spezielle Allergien etc. Bus/Zug – Reservation, Billet bestellen 1 Tag vorher 1 Tag vorher 1 Tag vorher 1 Tag vorher Entscheid Durchführung ja/nein (Mitteilung an SL, Eltern) Notfallkarten ausdrucken für Begleitpersonen Arbeitsblatt, Fotoquiz 1 und Fotoquiz 2 für jede Gruppe kopieren Material bereit machen Exkursionsmorgen Handynummern der Begleitpersonen austauschen Nachher Nachher Nachher Auswerten Präsentation Diashow oder Fotoroman Abrechnen Das Rekognoszieren ist bei guten Grundkenntnissen im Kartenlesen und ohne Änderungen zur vorgeschlagenen Exkursionsplanung nicht nötig. Rundweg Exkursion Mittelstufe Materialliste Was? Lehrperson Begleitung Schüler/in Rundweg-Karte Rundweg-Büechli (aus der Box) Zeitplan Exkursion Verhaltensregeln Unterlagen aus Rundweg-Dossier Buskarte Stadt Winterthur Kollektiv-Billet nach Kemptthal Halbtaxabo GA Notfallkarte Apotheke Telefonnummern Klasse, Schulleitung Sonnencrème Zeckenspray Fotokamera Schreiber (Pro Kind 1 Stück) Notizpapier Schreibunterlagen (Pro Kind 1 Stück) Material für Spiele unterwegs Feldstecher Taschenmesser Feuerzeug Zeitungen Zwischenverpflegung Lunch Getränk Sonnenhut, Sonnenbrille Regenschutz kostenlos bei: Sportamt Winterthur, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur, 052 267 40 00 Download Dossier „Rundweg Exkursion Mittelstufe: www.schulsport.winterthur.ch Absender Schule Rundweg – Exkursion „Wald – Wasser – Winterthur am Datum Sehr geehrte Eltern Zum Winterthurer 750Jahre Jubiläum wurde 2014 Jahr der Rundweg eröffnet. Der 70 km lange Weg führt in 10 Etappen der Stadtgrenze entlang ( www.rundweg.winterthur.ch). Unsere Klasse wird eine Exkursion auf der Etappe Leisental von Kemptthal nach Sennhof durchführen. Wir passieren dabei den südlichsten Punkt von Winterthur, setzen uns mit dem Winterthurer Wald auseinander, verweilen über den Mittag an der renaturierten Töss und kommen an der letzten Grossspinnerei der Schweiz vorbei. Datum: Datum Verschiebedatum: Verschiebedatum Begleitung: Begleitung 1 (Name, Vorname, Funktion) Begleitung 2 (Name, Vorname, Funktion) Begleitung 3 (Name, Vorname, Funktion) Treffpunkt: Rückkehr: Zeit Uhr Schulhaus Name Schulhaus ca. 15.30 Uhr Schulhaus Name Schulhaus Mitnehmen: gutes Schuhwerk (Turnschuhe) bequeme Kleider, die schmutzig werden dürfen kleiner Tagesrucksack mit: Zwischenverpflegung (Frucht, Getreideriegel) Lunch (etwas zum Bräteln, Brot, Gemüse) Trinkflasche mit ungesüsstem Getränk (Wasser, Tee) Sonnenschutz (Sonnenhut, Sonnenbrille, Sonnencrème) Regenschutz (Regenjacke) evtl. Taschenmesser Schreibzeug Über die Durchführung werde ich die Klasse am Datum Entscheid informieren. Ich freue mich jetzt schon auf diesen Ausflug. Freundliche Grüsse Name, Unterschrift Rundweg Exkursion Mittelstufe Verhaltensregeln • • • • • • • • • • • • Anweisungen der Lehrperson und Begleitpersonen beachten Im Bus und Zug zusammen sitzen und Lautstärke drosseln Beim Umsteigen in Zweier-Reihen gehen Am Bahnhof hinter den Sicherheitslinien bleiben Lehr- oder Begleitperson zuvorderst nicht überholen Vorsicht bei Nässe: rutschige Steine, Wurzeln und Holzbrücken Strassen gehend gemeinsam queren Nicht baden in der Töss (teilweise gefährliche Schwellen!) Alle Abfälle entsorgen oder wieder einpacken Keine Handys oder anderen elektronischen Geräte Rundweg Exkursion Mittelstufe Gruppenaufgaben Die Klasse wird in fünf Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe erhält einen schriftlichen Auftrag zur Unterhaltung der Klasse während oder nach der Exkursion. ( Einzelne Auftrage: siehe folgende Seiten). Gruppe 1: Entdecken 2 bis 4 (auch schwache) Schüler/-innen Gruppe 2: Kleines Spiel 3 bis 4 Schüler/-innen Gruppe 3: Witz oder Sketch 3 bis 5 Schüler/-innen Gruppe 4: Klassen-Aufgabe 2 bis 4 Schüler/-innen Gruppe 5*: Diashow/Fotoroman 2 bis 6 (starke) Schüler/-innen braucht mehr Zeit in der Vor- und Nachbereitung als andere Aufgaben! Zeitbedarf 1 bis 2 Lektionen vor der Exkursion: • Vorstellen der Gruppenaufgaben • Gruppen einteilen • Vorbereitungsarbeiten in den Gruppen • evtl. Würfelspiel auf der Rückseite der Rundwegkarte 1 bis 2 Lektionen nach der Exkursion: • evtl. Auflösung Arbeitsblatt (wenn nicht direkt am Ende der Exkursion) • Feedback zur Exkursion einholen • Zusammenstellen der Diashow/des Fotoromans (Gruppe 5) • Vorführen der Diashow oder Präsentation Fotoroman (Gruppe 5) Zusatzaufgabe: Arbeitsblatt Jede Gruppe erhält zusätzlich ein Arbeitsblatt mit Fragen, die im Verlauf der Exkursion beantwortet werden können. Welche Gruppe hat am Schluss die meisten richtigen Antworten? Rundweg Exkursion Mittelstufe Gruppe 1 Auftrag: Entdecken 2 bis 4 Schüler/-innen Ziel: Ihr notiert alles, was ihr auf der Exkursion entdeckt habt. Vor der Exkursion: Ihr überlegt euch, was man auf der Exkursion entdecken könnte und ergänzt damit die Liste unten. Aufgaben untereinander aufteilen: Wer macht was? Material bereit machen und mitbringen Während der Exkursion: Ihr erklärt der Klasse, was eure Aufgabe ist. (die Lehrperson sagt euch, wann ihr dran seid). Ihr fordert die Klasse auf, euch alles zu melden, was interessant sein könnte Ihr kreuzt alles an, was ihr (oder jemand der Klasse) unterwegs entdeckt hat. Eisvogel Ente Fisch Fischreiher Flugzeug Frosch Golfspieler Grenzstein Kinderwagen Kirschbaum Libelle Linde Mountainbiker Orchidee Raubvogel Raupe Robi-Dog Schmetterling Schneckenhaus schwarzer Stein Specht Spinne Nach der Exkursion: Ihr zählt die Anzahl entdeckten Objekte und notiert sie hier: Anzahl Objekte: Rundweg Exkursion Mittelstufe Tannzapfen Vogelhäuschen Vogelnest Weinbergschnecke Gruppe 2 Auftrag: Kleines Spiel 3 bis 4 Schüler/-innen Ziel: Ihr unterhält die Klasse mit einem kleinen Spiel (Dauer: 5-10 Minuten) Vor der Exkursion: Ein kleines Spiel für unterwegs vorbereiten (z. B. Kreisspiel, Fangis, ). Wichtig: Es sollte eine Überraschung für die anderen sein! Aufgaben untereinander aufteilen: Wer macht was? Material für Spiel bereit machen und mitbringen Während der Exkursion: Ihr erklärt das kleine Spiel und führt es mit der Klasse durch (die Lehrperson sagt euch, wann ihr dran seid). Gruppe 3 Auftrag: Witz oder Sketch 3 bis 5 Schüler/-innen Ziel: Ihr unterhält die Klasse mit einem Witz oder Sketch. Vor der Exkursion: Einen Witz oder Sketch für unterwegs vorbereiten. Wichtig: Es sollte eine Überraschung für die anderen sein! Aufgaben untereinander aufteilen: Wer macht was? Material bereit machen und mitbringen Während der Exkursion: Durchführung eurer Überraschungsaktivität (die Lehrperson sagt euch, wann ihr dran seid). Rundweg Exkursion Mittelstufe Gruppe 4 Auftrag: Klassen-Aufgabe 2 bis 4 Schüler/-innen Ziel: Ihr stellt der Klasse eine kurze Aufgabe(Dauer: 5-10 Minuten), die alle gemeinsam lösen müssen. Vor der Exkursion: Ihr bereitet eine kurze Aufgabe für die ganze Klasse vor (z. B. schaffen wir es, alle gemeinsam 10 Sekunden lang nicht zu lachen?) Wichtig: Es sollte eine Überraschung für die anderen sein! Aufgaben untereinander aufteilen: Wer macht was? Material für Aufgabe bereit machen Während der Exkursion: Durchführung eurer Überraschungsaktivität (die Lehrperson sagt euch, wann ihr dran seid). Rundweg Exkursion Mittelstufe Gruppe 5 Auftrag: Diashow oder Fotoroman 2 bis 6 Schüler/-innen Ziel: Ihr präsentiert der Klasse eine Diashow oder einen Fotoroman von der Exkursion. Vor der Exkursion: Ihr überlegt euch, was ihr unterwegs fotografieren wollt (einzelne Bilder von Landschaft, Portraits, oder kurzer Fotoroman?) Wenn Fotoroman: Kurze Geschichte erfinden und aufschreiben Aufgaben untereinander aufteilen: Wer macht was? Material bereit machen (wer bringt einen Fotoapparat mit?) Während der Exkursion: Fotografieren evtl. Szenen spielen Nach der Exkursion: Fotos auf den Computer laden Die besten Bilder auswählen Diashow/Fotoroman zusammenstellen Diashow/Fotoroman der Klasse präsentieren Evtl. Bilder auf Schul-Webseite laden? Rundweg Exkursion Mittelstufe Rundweg Exkursion Mittelstufe Arbeitsblatt zur Etappe Leisental 1 2 3 4 5 6 Wann wurde der Rundweg Winterthur eröffnet? Zu welchem Jubiläum wurde der Rundweg eröffnet? Welche Farbe hat die Rundweg-Markierung auf den Wegweisern? Wie viele Kilometer misst die Rundweg-Etappe Leisental? Wie nennt man das Leisental auch noch? Wie heisst der Fluss im Leisental? 7 Welche Gemeinden grenzen auf der Etappe Leisental an Winterthur? Wie hoch ist der südlichste Punkt des Rundwegs? Wie heisst der höchste Punkt des Rundwegs? Zähle 8 Baumarten im Wald auf: 8 9 10 11 12 Wie viele Vogelarten nisten im Winterthurer Wald? Zähle fünf Vögel auf, die im Wald leben: 13 Wie heissen der Golfclub und der Golfplatz? Wie viel der Fläche von Winterthur ist bewaldet? Wie viel des Winterthurer Waldes gehört der Stadt Winterthur? 14 15 Rundweg Exkursion Mittelstufe 16 17 18 19 20 21 22 23 Wem gehört der Rest? Wie viele Bäume gibt es im Winterthurer Wald? Wie viele Km messen alle Waldränder von Winterthur zusammen? Wie viele Treppenstufen führen vom Golfplatz hinunter zur Infotafel über die Haselmaus? (die Wasserschwellen nicht mitzählen) Zähle drei Waldfunktionen auf: Aus welchem Jahr stammt die Brunibrücke? Wann wurde sie von Pfungen hierher versetzt? 25 26 27 28 29 Wie gross ist der Anteil am Winterthurer Trinkwasser aus dem Leisental? Wozu braucht es die Schwellen in der Töss? Wie wird der Glögglifrosch auch noch genannt? In welchem Jahr passierte der Hangrutsch am Gamser? Wie viele Prozent der Winterthurer Waldfläche sind Schutzwald? Welche Farbe hat die Vorrangfunktion „Naturwald auf der Infotafel 2?_ Wie heisst die älteste Holzbrücke Winterthurs? 30 31 Seit wann gibt es die Spinnerei Bühler? Wie hoch liegt der Bahnhof Sennhof-Kyburg? 24 Rundweg Exkursion Mittelstufe Rundweg Exkursion Mittelstufe Lösungen Arbeitsblatt zur Etappe Leisental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wann wurde der Rundweg Winterthur eröffnet? 2014 Zu welchem Jubiläum wurde der Rundweg eröffnet? 750 Jahre Stadtrecht Winterthur Welche Farbe hat die Rundweg-Markierung auf den Wegweisern? grün Wie viele Kilometer misst die Rundweg-Etappe Leisental (Kemptthal – Sennhof)? 9.3 km Wie nennt man das Leisental auch noch? Linsental Wie heisst der Fluss im Leisental? Töss Welche Gemeinden grenzen auf der Etappe Leisental an Winterthur? Kemptthal und Kyburg Wie hoch ist der südlichste Punkt des Rundwegs? 610 m.ü.M Wie heisst der höchste Punkt des Rundwegs? Hulmen Zähle 8 Baumarten im Winterthurer Wald auf Fichte, Weisstanne, Föhre, Buche, Eiche, Ahorn, Esche, Haselnuss, Nussbaum, Linde, Weide, Lerche Wie viele Vogelarten nisten im Winterthurer Wald? 30 bis 40 Zähle fünf Vögel auf, die im Wald nisten Rotmilan, Sperber, Mäusebussard, Ringeltaube, Waldkauz, Schwarzspecht, Buntspecht, Zaunkönig, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Singdrossel, Misteldrossel, Wintergholdhähnchen, Sommergoldhähnchen, Haubenmeise, Tannenmeise, Kleiber, Waldbaumläufer, Eichelhäher, Fichtenkreuzschnabel, Gimpel, Kernbeisser, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Habicht, Trauerschnäpper Wie heissen der Golfclub und der Golfplatz? Golfclub Kyburg, Golfplatz Rossberg Wie viel der Fläche von Winterthur ist bewaldet? 26.8 km2 39.4 über ein Drittel Wie viel des Winterthurer Waldes gehört der Stadt Winterthur? 1690ha über 3/5 knapp 2/3 Wem gehört der Rest? Kanton Zürich (Staatswald), Private, Holzkorporationen, Kirche Wie viele Bäume gibt es im Winterthurer Wald? 10x so viele wie Menschen ( über 1 Million) Rundweg Exkursion Mittelstufe 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Wie viele Km messen alle Waldränder von Winterthur zusammen? 130km gesamte Länge der Thur (vom Säntis bis zum Rhein) Autodistanz Winterthur – Andermatt (Kanton Uri) Wie viele Treppenstufen führen vom Golfplatz hinunter zur Infotafel über die Haselmaus? (die Wasserschwellen nicht mitzählen) 208 Zähle drei Waldfunktionen auf Schutz, Erhohlung, Holzwirtschaft, Ökologie (Sauerstoff) Aus welchem Jahr stammt die Brunibrücke? 1839 Wann wurde sie von Pfungen hierher versetzt? 1974 Wie gross ist der Anteil vom Winterthurer Trinkwasser, der aus dem Leisental stammt? Rund 1 Viertel Wozu braucht es die Schwellen in der Töss? Damit der Untergrund bei Hochwasser nicht mitgeschwemmt wird (Erosion) und der Wasserstand unter den Grundwasserspiegel sinkt. Wie wird der Glögglifrosch auch noch genannt? Geburtshelferkröte In welchem Jahr passierte der Hangrutsch am Gamser? 1995 Wie viele Prozent der Winterthurer Waldfläche sind Schutzwald? 12.6 Prozent (335 ha) Welche Farbe hat die Vorrangfunktion „Naturwald auf der Infotafel Nr. 2? gelb Wie heisst die älteste Holzbrücke Winterthurs? Kyburgbrücke Seit wann gibt es die Spinnerei Bühler? 1860 Wie hoch liegt der Bahnhof Sennhof-Kyburg? 479 m. ü. M. Rundweg Exkursion Mittelstufe Rundweg Exkursion Jede Begleitperson erhält eine solche Notfallkarte. Auf der Hinterseite die Namen von Kindern mit Allergien oder andere wichtige Angaben notieren. Rundweg Exkursion Wegweiser und Markierungen Rundweg Exkursion Mittelstufe Fotoquiz 1 Blumen am rechten Wegrand Aufgabe: Findest du alle Blumen? Nummeriere sie der Reihe nach von 1 bis 7, so wie du ihnen am Wegrand begegnest. Rundweg Exkursion Mittelstufe Fotoquiz 1 Blumen am Wegrand (Lösung) 2 1 7 6 3 5 4 Bemerkung: Diese Lösung galt im Juni 2015. Je nach Jahreszeit blühen andere Blumen oder an anderen Standorten! Rundweg Exkursion Mittelstufe Fotoquiz 2 Töss-Schwellen und Renaturierung Die Schwellen in der Töss verhindern, dass bei Hochwasser der Untergrund mitgeschwemmt wird und der Wasserstand unter den Grundwasserpegel sinkt! Aufgabe: Schau dir die unterschiedlichen Schwellen in der Töss genau an. Nummeriere die Stellen der Reihe nach von 1 bis 6, so wie du ihnen auf dem Weg begegnest. Rundweg Exkursion Mittelstufe Töss-Schwellen und Renaturierung (Lösung) 4 5 1 2 3 6 Fotoquiz 2 Anhang: Texte aus dem Buch „Waldzeit – Wälder für Winterthur (Michael Wiesner (2014), Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur) bzw. www.waldzeit.ch Archiv der Kategorie „Vögel 1 Der Wald, die Heimat vieler Vogelarten 26. Dezember 2012 Es ist Mitte Februar. Die Tage werden spürbar länger. Die Sonne scheint bereits etwas kräftiger durch das noch laublose Astwerk der Waldbäume und verzaubert den Wald in ein geheimnisvolles Spiel mit dem Licht. Noch etwas zaghaft ertönen die ersten Vogelstimmen. Vorab ist es die Misteldrossel mit ihrem etwas melancholischen und leicht flüchtig hingeworfenen, dem Amselgesang ähnlichen Lied. Sie erfreut die Waldbesuchenden aus den oberen Regionen der noch kahlen Baumkronen. Die Singdrossel – sie ist knapp so gross wie ein Star – nimmt kein Blatt vor den Schnabel und trägt ihr Lied klar und deutlich, einzelne Motive oft wiederholend, in den Vorfrühlingswald. Auch Sie bevorzugt für Ihren Gesangsvortrag die oberen Regionen der Nadelbäume. Längst vor diesen beiden Drosselartigen, nämlich im Dezember war der Waldkauz bereits auf Brautschau und hat mit seinem «huuh» mit dem anschliessenden tremolierenden «u-u-u-u» sein Brutrevier gegenüber Artgenossen «ausgerufen». Wer im Dezember und Januar nach dem Eindunkeln den Winterwald im Schnee nicht scheut, hat mit etwas Geduld grosse Chancen, den «Nachtheuel» zu hören. Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 1 2 Erste Singvögel kehren ins Sommerquartier zurück Frühlingswald am Beerenberg (Foto: Michael Wiesner) So Anfang März kommen dann die ersten kleinen Singvögel aus ihrem Überwinterungsgebiet in Südwesteuropa in ihr Sommerquartier zurück. Die Mönchsgrasmücke verrät sich mit ihrer angenehm und fröhlich klingenden Strophe. Dazu gesellt sich der Zilp-Zalp, ein kleiner unscheinbar gefärbter Zweigsänger. Seine zweisilbige Singstrophe hat ihm seinen Namen gegeben. Mönchsgrasmücke und Zilpzalp sind Bewohner von Hecken und suchen sich deshalb die lichten Partien im Wald aus für ihr bevorstehendes Brutgeschäft. Auch der Schwarzspecht kündet mit seinem von weitem hörbaren «Gliüü» die wärmer werdenden Tage an. Die Ringeltauben gurren wieder hoch oben in den Bäumen und vollführen mit klatschenden Flügelbewegungen ihren Revierflug. Die Hohltauben haben ihr Revier bereits bezogen. Von ihnen hört man nur selten ein leises fast etwas zögerliches Gurren. Sie sind sehr Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 2 selten, denn zum Brüten sind sie auf Höhlen in Bäumen, vorzugsweise auf verlassene Schwarzspechthöhlen angewiesen. Diese gibt es in unserer Gegend ausschliesslich in hochschaftigen Buchen. Von Tag zu Tag kommt jetzt mehr Leben in den Wald. Alle diese Flugkünstler sind mit einem Fernglas gut zu beobachten, denn die Bäume haben noch keine Blätter ausgetrieben, die uns die Sicht verdecken. Weitere Wald bewohnende Vögel kommen laufend in ihr Sommerquartier zurück und teilen den Lebensraum mit denjenigen Arten, die den Winter über hier bleiben oder sich nur teilweise in wärmere Gegenden zurückgezogen haben. Einer der spätesten Ankömmlinge ist der Trauerschnäpper. Er erscheint so gegen Ende April Anfangs Mai. Sein etwas abgehackter trotzdem aber wohlklingender Gesang verrät ihn. Finden kann man ihn in eher warmen trockenen lichten und parkähnlichen Waldpartien, wo er sich auf der mittleren Etage der Laubbäume am wohlsten fühlt. 3 Jede Nische im Wald gefüllt mit Vogelleben Lichter Laubmischwald im Hardholz (Foto: Michael Wiesner) Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 3 Das neue lichte Laubgrün schenkt dem Wald eine spezielle Atmosphäre. Viele unterschiedliche Waldpartien wechseln sich ab. Lichte Stellen wechseln ab mit dunkleren Partien, Junges Holz mit altem Holz, feuchte Tobel mit trockenen Kuppen, nährstoffreiche mit mageren Standorten, dazwischen Übergangsbereiche. Jede dieser Zonen weist eine speziell an sie angepasste Flora und Fauna auf. Die gefiederten Bewohner profitieren von diesem Reichtum und finden darin den ihnen zusagenden Lebensraum. Jetzt, Anfangs Mai, ist sozusagen jede Nische im Wald gefüllt mit Vogelleben. Die Männchen stimmen frühmorgens ein in das grosse Vogelkonzert. Alle singen sie durcheinander. Trotzdem tönt es nicht falsch, nichts von Disharmonie, ein wunderschönes Erlebnis. Wer sich die Mühe nimmt, die Stimmen der einzelnen Vogelarten kennen zu lernen, dem öffnet sich sozusagen eine neue Dimension, eine staunenswerte neue Welt, und erst noch vor der eigenen Haustüre. 4 Permanente Überwachung des Brutvogelbestandes im Kanton Zürich Laubmischwald am Hulmen-Nordhang (Foto: Michael Wiesner) Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 4 Das Brutgeschäft ist Anfangs Mai zum Teil bereits im Gange, zum Teil beginnen die Spätankömmlinge erst mit dem Nestbau. Welche Vogelart brütet jetzt aber wo im Wald und wie entwickelt sich ihr Bestand? Eine permanente Überwachung des Brutvogelbestandes im Kanton Zürich gibt Aufschluss darüber. Verschiedene Landschaftsräume über den ganzen Kanton verteilt, wie Wald, Kulturland und Siedlung unterstehen einem jährlichen Monitoring. Seltene Vogelarten, die spezielle Ansprüche an ihren Lebensraum stellen, sowie solche, die sehr grosse Reviere beanspruchen, werden separat erfasst. Zusätzlich wurden in den Jahren 1986–1988 und 2006–2008 die brütenden Vogelarten im ganzen Kanton flächendeckend durch rund 250 freiwillige Ornithologen und Ornithologinnen erfasst. Somit stehen heute aussagekräftige Vergleichszahlen über die Entwicklung des Brutvogelbestandes bis auf Gemeindeebene zur Verfügung. Der Projektträger dieser Bestandesaufnahmen ist der Verband der Natur- und Vogelschutzvereine ZVS/BirdLife Zürich. Unterstützt wird das Projekt vom Amt für Landschaft und Natur bei der kantonalen Baudirektion. Die Tabelle 1 zeigt die Entwicklung von 25 im Wald vorkommenden Vogelarten in systematischer Reihenfolge, bezogen auf die Waldfläche in der Stadtgemeinde Winterthur. Der Leser und die Leserin mögen sich nun fragen, wie denn die Vögel gezählt werden. Kann man Vögel überhaupt zählen? Ja, man kann das. Die wissenschaftliche Forschung zeigt nämlich auf, dass die Mehrzahl der Singvögel während der Brutzeit einen Landschaftsraum mit einer bestimmten Grösse beanspruchen, um sich damit die erforderliche Menge Futter für die hungrigen Jungen zu sichern. 5 Unterschiedliche Waldtypen, unterschiedliche Vogelarten Dieses sogenannte Revier verteidigt das Männchen und das Weibchen gegenüber artgleichen Eindringlingen. Mitunter sind dabei heftige Kämpfe um die Reviergrenze zu beobachten. Alle anderen Arten werden dabei toleriert, denn bei der Futterbeschaffung teilen sie sich verschiedene Nischen, indem jede Art spezielle Partien an Bäumen und Sträuchern nutzt. Zudem schliessen sich einzelne Arten zum vornherein aus, weil sie unterschiedliche Waldtypen bevorzugen und sich dadurch nicht in die Quere kommen. Ab und zu naschen beim Nachbarn ist trotzdem Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 5 erlaubt, abgesehen davon, dass die Territoriumsgrenzen grosszügig ausgelegt werden. Nach der Brutzeit lösen sich die Reviere wieder auf. Die Männchen signalisieren also mit ihrem Gesang, dass sie hier zu Hause sind und in ihrem Revier keine Artgenossen dulden. Erfahrene Ornithologinnen und Ornithologen machen sich diese Forschungsergebnisse zu Nutze, indem sie solche singenden Männchen aber auch Sichtbeobachtungen nach einer bestimmten Methode registrieren. Jedes singende Männchen lässt nun auf ein Revier schliessen. Durch mehrmaliges Begehen der Untersuchungsfläche während der Fortpflanzungszeit der Vögel kann die Erhebungsgenauigkeit verbessert werden. Dieses Vorgehen erlaubt es, dass man am Ende der Brutzeit relativ genaue Angaben zur Revierzahl von jeder Vogelart geliefert bekommt. Dies setzt jedoch voraus, dass die erfassende Person den Gesang und die verschiedenen Rufe jeder Vogelart genau kennt und sie bei Sichtkontakt zweifelsfrei bestimmen kann. Konzentriertes Arbeiten ist da gefragt. Tabelle 1: Anzahl Brutpaare in Winterthur von Vogelarten, die ausschliesslich oder grossenteils im Wald oder in waldähnlichen Gehölzen vorkommen oder ihren Brutplatz dort haben. Art Brutpaare im Trend Winterthurer Kanton Wald Zürich 2008 Lebensraum 1988 Quelle: Zürcher Vogelfinder, ZVS/BirdLife Zürich Wespenbussard 3 0 Horstbäume im Waldinnern 12 4 Horstbäume im Wald oder in Pernis apivorus Rotmilan Milvus milvus Habicht Gehölzen 2 1 grosse Horstbäume im Waldinnern 9 3 Stangengehölze im Waldinnern 37 27 Generalist 5 2 Exponierte Horstbäume im Wald 1 6 Bäume mit Höhlen des Accipiter gentilis Sperber Accipiter nisus Mäusebussard Buteo buteo Baumfalke Falco subbuteo Hohltaube Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 6 Tabelle 1: Anzahl Brutpaare in Winterthur von Vogelarten, die ausschliesslich oder grossenteils im Wald oder in waldähnlichen Gehölzen vorkommen oder ihren Brutplatz dort haben. Art Brutpaare im Trend Winterthurer Kanton Wald Zürich 2008 1988 Columba oenas Ringeltaube Lebensraum Schwarzspechts 360 230 Generalist 20 12 /- Generalist 2 5 – 19 9 Hochschaftige, alte Buchen 200 200 /- Generalist 0 3 Eichenreiche Wälder 3ha 740 630 Generalist 170 180 /- Generalist 1400 1400 /- Generalist 980 1200 /- Generalist 76 61 Generalist 6 270 –– Buchen über grasigem Boden 560 1100 /- Generalist Columba palumbus Waldkauz Strix aluco Grauspecht (Auen) Wälder mit Laubhölzern Picus canus Schwarzspecht Dryocopus martius Buntspecht Dendrocopos major Mittelspecht Dendrocopus medius Zaunkönig Troglodytes troglodytes Heckenbraunelle Prunella modularis Rotkehlchen Erithacus rubecula Singdrossel Turdus philomelos Misteldrossel Turdus viscivorus Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix Wintergoldhähnchen Regulus regulus Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 7 Tabelle 1: Anzahl Brutpaare in Winterthur von Vogelarten, die ausschliesslich oder grossenteils im Wald oder in waldähnlichen Gehölzen vorkommen oder ihren Brutplatz dort haben. Art Brutpaare im Trend Winterthurer Kanton Wald Zürich 2008 Sommergoldhähnchen Lebensraum 1988 1000 1800 5 46 – Generalist Regulus ignicapillus Trauerschnäpper –– Ficedula hypoleuca Haubenmeise Waldränder, Grate und HochstammObstgärten 23 9 Generalist 580 930 /- Generalist 390 400 /- Alte Bäume 89 80 /- Generalist 230 200 /- Generalist 9 19 /- Nischen an Gebäuden, Bäume mit Parus cristatus Tannenmeise Parus ater Kleiber Sitta europaea Waldbaumläufer Certhia familiaris Eichelhäher Garulus glandarius Dohle Corvus monedula Kolkrabe Schwarzspechthöhlen 3 0 überragende Horstbäume im Wald 11 62 –– Generalist 27 41 – Generalist 20 78 – lichte Laubholzbestände 6983 9008 Corvus corax Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra Gimpel Pyrrhula pyrrhula Kernbeisser Coccothraustes Alle Arten zusammen Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 8 Die Veränderung des Bestands von einzelnen Arten ist zum Teil massiv und nicht in jedem Fall erklärbar. Da fallen zum Beispiel die Gewinner mit recht hohen Zunahmen auf. Bei den Greifvögeln sind es der Rotmilan und der Sperber. Ihr Brutbestand hat sich in den vergangenen 20 Jahren praktisch verdreifacht. Der Rotmilanbestand folgt einem gesamtschweizerisch beobachteten Aufwärtstrend, der seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts anhält. Bis weit in die Voralpentäler hinein beobachtet man den Rotmilan heute auf der Nahrungssuche. Mit einer respektablen Flügelspannweite von stattlichen 1,60 fliegt er gemessenen Fluges tief über die Dächer der Siedlungen und der Felder. Er ist sehr anpassungsfähig bei der Nahrungssuche. Diese besteht aus Kleinsäugern, auch Vögel, Aas und Abfälle verschmäht er nicht. Als sogenannter Ubiquist findet er in der Schweiz offensichtlich ihm zusagende Lebensbedingungen. Seinen Horst aus Reisigen baut er in Gehölzen, meist weit oben in den Kronen von Laub- und Nadelbäumen. Er ist ein Zugvogel, der in Südeuropa und in Nordafrika überwintert. Vermehrt bleiben heute viele Altvögel den Winter über in der Schweiz, während die diesjährigen Jungen in wärmere Gefilde wegziehen. Das auffallend eingekerbte Schwanzende des Rotmilans ist ein sicheres Bestimmungsmerkmal (Foto: Marcel Ruppen) Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 9 Der Sperber, der kleinste brütende Greif in der Schweiz, hat sich seit seinem Tiefstand Ende der sechziger Jahre recht gut erholt, nachdem das Versprühen gewisser persistenter Insektizide in der Landwirtschaft, wie zum Beispiel das DDT, verboten wurde. Als oberstes Glied in der Nahrungskette nahm er über seine Beutetiere so viel Gift in seinen Körper auf, dass sein Gelege zu dünne Eischalen aufwies, und deshalb zerbrach. In Winterthur leben heute mindestens 10 Paare. Es dürften aber eher mehr sein, denn er lebt während der Brutzeit sehr heimlich und ist deshalb ein schwieriger Kandidat zum erfassen. Der Sperber ist ein geschickter wendiger Jäger und verschwindet so schnell zwischen den Bäumen und Häusern wie er gekommen ist. Ab und zu kreist er mit oder ohne Beute in die Höhe. Auffallend ist seine zügige und geradlinige Flugweise, bei der sich kurze schnelle Flügelschlagsequenzen mit längeren Gleitphasen abwechseln. Auf seinem Speisezettel stehen ausschliesslich Singvögeln, die er im Winter häufig auch im Siedlungsraum jagt. Bevorzugte Standorte für seinen Horst sind Nadelholzdickichte. Ein Sperberweibchen schraubt sich in die Höhe (Foto: Michael Gerber) Ein weiterer Gewinner ist der Schwarzspecht, ein typischer Waldvogel, denn seine Bruthöhle und seine Nahrungsgründe liegen vorzugsweise im Wald. Das ganze Jahr über hört man im Forst seinen von weitem hörbaren Grügrügrü-Flugruf und den Gliüü-Ruf. Intensiv hört ihn die Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 10 Waldbesucherin und der Waldbesucher im März und April, wo er an sonnigen Frühlingstagen seinen Balzruf, von weit her hörbar, zum besten gibt. Sein Vorkommen ist an grössere Waldkomplexe mit alten, starken, nicht zu dicht stehenden Bäumen gebunden. Er baut sich eine Höhle für die Kinderstube. Zu diesem Zweck sucht er sich in unserer Gegend fast ausschliesslich hochschaftige Buchen aus, die er relativ frei anfliegen kann. 6 Schwarzspecht profitiert vom Totholz Auf Totholz findet der Specht Ameisen und andere Insekten (Foto: Michael Wiesner) Von ihm beleben heute um die 20 Paare die Winterthurer Wälder, doppelt so viele wie vor 20 Jahren. Wie ist eine solch hohe Zunahme zu erklären? Ein Grund dürfte sicher sein, dass die Förster heute Buchen mit Schwarzspechthöhlen, wenn betriebswirtschaftlich möglich, stehen lassen. Bekanntestes Beispiel dafür ist das Geissbühl, südwestlich angrenzend an den Tierpark Bruderhaus. Dort hat der Schwarzspecht im Laufe der Jahre mehrere Höhlen in diverse alte Buchen gezimmert. Davon profitieren heute die Dohlen und die Hohltauben, denn als Sekundärbewohner ziehen sie gerne in solche verlassene Brutstätten ein. Dies ist auch ein Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 11 gelungenes Beispiel der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den Forst-Fachleuten und dem Natur- und Vogelschutzverein Winterthur Seen. Auch werden vermehrt abgestorbene Bäume stehen und Totholz liegen gelassen. Darauf findet der Specht Holz bewohnende Ameisen und andere Insekten. Die Bestandszunahme kann aber nicht allein mit der verbesserten Lebensgrundlage erklärt werden, denn dann hätte parallel dazu auch der häufigste Specht in unseren Wäldern, der Buntspecht, seinen Bestand vergrössern müssen. Mit etwa 200 Paaren ist sein Bestand aber stabil geblieben. Möglicherweise verzeichnete der Buntspecht bereits während der Bestandeserfassung von 1988 eine für ihn optimale Revierverteilung. «Bitte nicht stören, ich bin konzentriert auf Nahrungssuche»: der Schwarzspecht (Foto: Marcel Ruppen) Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 12 In der Tabelle 1 sind auch Verlierer auszumachen, deren markanter Rückgang nur schwer zu erklären ist. Zum Beispiel der Waldlaubsänger – ein Vertreter der Gattung der Zweigsänger – verzeichnete 1988 rund 270 Reviere. 2008 dürften es noch rund 6 Reviere gewesen sein und heute brütet er kaum mehr in unseren Wäldern. Aus vielen Gebieten des Mittellandes ist er verschwunden. Mit seinem auffallenden Gesang und dem Balzflug in den Baumkronen belebt der Waldlaubsänger unsere buchenreichen Laubwälder, zu deren lichtgrünem Laub sein lebhaft gelbgrünes Gefieder bestens passt. Das Nest – ein kunstvoller Kugelbau aus Halmen – errichtet er am Boden. Die Einflussfaktoren, die zu diesem drastischen Rückgang führen, sind sehr komplex und werden wissenschaftlich untersucht. Die Zusammensetzung der Baumarten hat sich zwar in den letzten 20 Jahren Richtung Laubwald, d. h. zu Gunsten seiner Ansprüche an den Lebensraum verändert. Die Bodenvegetation hat sich aber zum Teil von einer gering ausgebildeten Krautund Strauchschicht hin zu einer mastigeren Vegetation, hauptsächlich hin zu gebietsweise geschlossenen Brombeerteppichen entwickelt. Dies als Folge des zu hohen Stickstoffeintrags aus der Luft, verursacht durch die Verbrennungsmotoren von Autos, Maschinen und Traktoren sowie durch die Heizungen. Dies dürfte aber nur eine der Ursachen für seinen massiven Rückgang sein. Es werden auch ungünstige Einflüsse auf dem Zugweg und im Überwinterungsgebiet südlich der Sahara vermutet. Sein Kleid passt ausgezeichnet zum lichten Laub der Buche: der Waldlaubsänger (Foto: Michael Gerber) Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 13 Ein weiterer Kummervogel ist der Trauerschnäpper. Seinen Namen dürfte er wegen dem schwarz befrackten weissen Kleid des Männchens bekommen haben. Er ist wie der Waldlaubsänger ein Langstreckenzieher der im tropischen Afrika überwintert. Mit fünf Paaren beträgt sein Bestand gerade noch etwa 10% im Vergleich zu 1988. Innerhalb der Schweiz ist vor allem der Kanton Zürich von seinem Rückgang betroffen. Was ist mit ihm geschehen? An der Waldstruktur kann es kaum liegen, denn diese entspricht heute mit ihrem erhöhten Laubholzanteil und den lichten Waldpartien eher seinen Habitatswünschen als die früheren Nadelholzforste. Die Schweiz liegt allerdings an der südlichen Verbreitungsgrenze des Trauerschnäppers. Hat er eventuell wegen der Erderwärmung sein Verbreitungsgebiet etwas nach Norden verschoben? Oder ist es einfach eine naturbedingte Fluktuation, von der wir erwarten dürfen, dass der Tiefstand nach einigen Jahren oder Jahrzehnten vorbei ist, und der sympathische Kleinvogel in unseren Wäldern wieder heimisch wird? Bekannt ist nämlich, dass der Trauerschnäpper vor 1920 in der Schweiz nicht vorkam. Da der Trauerschnäpper erst Ende April/Anfang Mai ins Brutgebiet zurück kehrt sind seine Bruthöhlen meistens schon durch andere gefiederte Waldbewohner, hauptsächlich von Meisen besetzt. Er weiss sich zwar gegen die unerwünschten «Hausbesetzer» energisch zu wehren. Nichts destotrotz haben die Natur- und Vogelschutzvereine unter der Initiative des Forstbetriebs im Jahr 2012 eine Ansiedlungs-Aktion gestartet. Dabei werden an geeigneten Standorten jeweils erst Ende April Nistkästen für diese Spätankömmlinge aufgehängt. 2012 wohnte wenigstens 1 Paar im Ohrbühlwald in einem der aufgehängten Nistkasten und schritt dort auch zur Brut. Nach wenigen Jahren wird sich dann zeigen, ob diese Unterstützungsmassnahmen dem Trauerschnäpper eine Hilfe sind. Seine Flügel trägt es leicht hängend: Das Männchen des Trauerschnäppers (Foto: Michael Gerber) Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 14 Der Rückgang bei den Winter- und Sommergoldhähnchen aber auch beim Fichtenkreuzschnabel ist zum Teil verständlich. Als reine Nadelwaldbewohner profitieren sie nicht vom flächenmässig zunehmenden Mischwaldbestand. Dies allein erklärt die hohen Verluste jedoch nicht. Unbekannte Einflussfaktoren scheinen auch hier zu wirken. Veränderungen im Brutbestand unterliegen selbstverständlich natürlichen Fluktuationen. Die Faktoren, die die Bestandsentwicklung beeinflussen, sind äusserst komplex. Es gibt selten nur einen Grund, weshalb der Brutbestand einer Vogelart zu- oder abnimmt. Einflüsse wie das Nahrungsangebot, der Wetterverlauf der vorjährigen Brutsaison oder die Härte des zurückliegenden Winters können da einwirken. Bei den ziehenden Arten spielen zusätzliche Einflüsse auf dem Zugweg und im Überwinterungsgebiet eine entscheidende Rolle. Auch werden in den südlichen EU-Ländern noch stets Zugvögel gejagt, obwohl dies in der Europäischen Union schon seit Jahren gesetzlich verboten ist. Weitere bestimmende Faktoren, die den Bestand massgebend regulieren, liegen zum Beispiel auch in der Biologie jeder einzelnen Vogelart selber. Anlass zu Bedenken gibt uns der Vergleich des Gesamtbestandes am Ende der Tabelle 1 trotzdem. Warum hat die Zahl der Brutpaare während den vergangenen zwanzig Jahren derart stark von rund 9000 auf 7000 respektive um ganze 22% abgenommen? Einzelne Arten mögen zwar einer gewissen Fluktuation unterliegen, die Gesamtzahl aller Arten dürfte jedoch niemals so stark schwanken. Reagieren die Vögel und die Lebensgemeinschaften, die mit ihnen zusammenhängen, doch sensibler auf die, durch die Menschheit verursachten Umwelteinflüsse, als man gemeinhin annimmt? 7 Vögel mit kantonalem Verbreitungsschwerpunkt in den Winterthurer Wäldern Innerhalb des Kantons Zürich haben einige Vogelarten ihren Verbreitungsschwerpunkt in den Wäldern von Winterthur. Sie sind in der folgenden Tabelle 2 aufgeführt. Gemessen am Gesamtbestand im Kanton Zürich beträgt ihr Anteil beachtliche 5 bis 8%. Für dieses knappe Dutzend Wald-Arten trägt die Stadt Winterthur eine besondere Verantwortung. Es fällt auf, dass nur die Dohle ein Vogel ist, der in Höhlungen nistet. Alle andern Vogelarten sind Freibrüter, die ihre Nester oder Horste im Geäst von Sträuchern und Bäumen bauen. Der zunehmend strukturDossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 15 und artenreicher werdende Winterthurer Wald bietet für ihren Fortbestand gute Voraussetzungen. Tabelle 2: Waldarten mit Kantonalem Verbreitungsschwerpunkt in den Winterthurer Wäldern Art Brutpaare im Brutpaare in Kanton Zürich Winterthur 2008 2008 in Quelle: Zürcher Vogelfinder, ZVS/BirdLifeZürich Baumfalke 79 5 6,3 7400 360 4,8 13000 740 5,7 2700 170 6,3 20000 980 4,9 1600 76 4,8 20000 1000 5 140 9 6,2 4300 230 5,3 160 11 6,9 340 27 7,9 Falco subbuteo Ringeltaube Columba palumbus Zaunkönig Troglodytes troglodytes Heckenbraunelle Prunella modularis Singdrossel Turdus philomelos Misteldrossel Turdus viscivorus Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus Dohle Corvus monedula Eichelhäher Garulus glandarius Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra Gimpel Pyrrhula pyrrhula Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 16 8 • Literaturangaben Burkhart, M./P. Horch/H. Schmid/F. Tobler (2004): Vögel – unsere Nachbarn: Wie sie leben, was sie brauchen. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. • Hagemeijer, J M/M Blair (1997): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. & D Poyser, London. • Keller, Robert Dr. (1932): Die Vögel der Lokalfauna von Winterthur. Beilage zum 17. Bericht an die Mitglieder der Museumsgesellschaft Winterthur. • Knaus, P./R. Graf, J. Guélat, V. Keller, H. Schmid, N. Zbinden (2011): Historischer Brutvogelatlas. Die Verbreitung der Schweizer Brutvögel seit 1950. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. • Maumary, L./L. Vallotton/P. Knaus (2007): Die Vögel der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. • Miranda, B./M. Bürgi (2005): Spechte – anspruchsvolle Waldbewohner. Merkblatt für die Praxis: Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf. • Schmid, H./R. Luder/B. Naef-Daenzer/R. Graf/N. Zbinden (1988): Schweizer Brutvogelatlas. Verbreitung der Brutvögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein 1993–1996. • Schmid, H./M. Burkhardt/V. Keller/P. Knaus/B. Volet/N. Zbinden (2001): Die Entwicklung der Vogelwelt in der Schweiz. Avifauna Report Sempach. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. • Weggler, M./C. Baumberger/M. Widmer/Y. Schwarzenbach/R. Bänziger (2009): Zürcher Brutvogelatlas 2008 Aktuelle Brutvogelbestände im Kanton Zürich 2008 und Veränderungen seit 1988. Herausgeber: ZVS/BirdLife Zürich. Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 17 Archiv der Kategorie „Eigentümer 1 Wem gehört der Winterthurer Wald? Von den mehr als 26,9 Quadratkilometern Wald in Winterthur gehören rund 16,9 Quadratkilometer – also mehr als drei Fünftel – der Stadt selber. Sie besitzt neben den zahlreichen Wäldern auf dem Stadtgebiet auch mehrere Waldgebiete im Tösstal: am Kümberg in Turbenthal (1,8 Quadratkilometer) und im Gebiet Hornsäge südlich der Rämismühle in der Gemeinde Zell (0,28 Quadratkilometer). Waldbesitzverhältnisse auf Stadtgebiet Waldeigentümer Stadt Winterthur Waldfläche 1 691 Hektaren Kanton Zürich 269 Hektaren Holzkorporation Oberwinterthur 152 Hektaren Holzkorporation Hegi 19 Hektaren Kirchgemeinde Wülflingen 19 Hektaren Bund (SBB) 1 Hektare Privatwald 542 Hektaren Waldfläche 2 693 Hektaren Quelle: Forstbetrieb Winterthur, 2010 Fünf Waldgebiete in Winterthur gehören dem Kanton Zürich; sie umfassen eine Fläche von insgesamt rund 2,7 Quadratkilometern: Zu den Staatswäldern gehören ganz oder teilweise die Waldgebiete Orbüel, Höhwald und Holzhuser auf dem Hegiberg, das Gebiet Ebnet in Töss, das Niesenbergholz gegen Kemptthal und eine grössere Fläche zwischen Rossberg und Eschenberg (Bannhalden). Die Staatswälder sind direkt der Staatsforstverwaltung unterstellt. Schliesslich besitzt auch der Bund – genauer: die SBB – eine Hektare1Wald auf Winterthurer Stadtgebiet. Die Holzkorporation Oberwinterthur kaufte 1832 dem Kanton Zürich den nordöstlichen Teil des Lindbergwaldes und etwa 60 Hektaren Wald in Ricketwil (Andelbach) ab. Diese Waldgebiete waren bis dahin mit Nutzungsrechten der Bürger von Oberwinterthur belastet. Später vergrösserte die Holzkorporation ihren Waldbesitz durch Ankäufe auf die heutige Fläche von 152 Hektaren. Der 1836 gegründeten Holzkorporation Hegi gehört das 19 Hektaren grosse Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 18 Waldstück Schönholz an der Grenze zu Wiesendangen. Ebenfalls 19 Hektaren umfasst das am westlichen Wolfensberghang gelegene Waldgebiet Chilenholz. Seit 1844 ist die Kirchgemeinde Wülflingen vollrechtliche Eigentümerin dieses Waldgebiets. 2 Zahlreiche Privatwaldbesitzer Wie die Gemeindewälder entsprangen auch die Korporationswälder dem Gemeinschaftswald der traditionellen bäuerlichen Nutzungsgemeinde. Das Gesetz stellt die Gemeinde- und Korporationswälder auf die gleiche Stufe. Das heisst: Auch die Holzkorporationen müssen einen Förster wählen, Wirtschaftspläne erarbeiten und dem zuständigen Kreisforstmeister des Kantons regelmässig Bericht erstatten. Neben der Stadt, dem Kanton und den Korporationen nennen noch einige hundert Privatpersonen ein mehr oder weniger grosses Stück Winterthurer Wald ihr Eigen. Für Spaziergänger oder Jogger sind die Besitzverhältnisse unerheblich. Wem auch immer ein Stück Wald gehört: Alle dürfen es betreten und darin wild wachsende Beeren pflücken und Pilze2sammeln. Einzig Gebiete, die zum Schutz des Jungwuchses respektive aus Sicherheitsoder aus Naturschutzgründen abgesperrt sind, dürfen nicht betreten werden. Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 19 Archiv der Kategorie „Flächen 1 Winterthur ist die waldreichste Stadt der Schweiz 3. November 2012 Waldgebiete in Winterthur Winterthur ist die waldreichste Stadt der Schweiz. Statistisch gesehen ist hier mehr als jeder dritte Quadratmeter mit Wald bedeckt. Oder anders ausgedrückt: Der Wald beansprucht fast 39 Prozent des Winterthurer Stadtgebiets. Dieser Waldanteil ist hoch. Das bestätigt ein Blick über Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 20 die Stadtgrenzen hinaus: Der durchschnittliche Waldanteil im Kanton Zürich liegt bei 28 Prozent. Im Schweizer Mittelland liegt er noch tiefer, nämlich bei rund 24 Prozent. In Winterthur leben heute rund zehnmal so viele Bäume wie Menschen. Die Wälder nehmen flächenmässig mehr von der Stadt ein als alle Gebäude, Plätze und Strassen zusammen – mehr demnach als das, was die Stadt eigentlich zur Stadt macht. Damit kann Winterthur landschaftlich gesehen auch ohne See jeder anderen Schweizer Stadt das Wasser reichen. Allein die Fläche des Winterthurer Waldes ist grösser als der ganze Walensee und mithin so gross, dass darauf andere Städte – zum Beispiel Genf oder Basel – bequem Platz hätten. Eindrücklich auch eine andere Zahl: Würde man alle Waldränder in Winterthur aneinanderreihen, käme man auf eine Gesamtlänge von 130 Kilometern – das ist mehr als die ganze Länge der Thur. Bodennutzung in der Stadt Winterthur Fläche Gesamtfläche Anteil 6 807 ha 100,0 379 ha 5,6 Hofraum, Garten und Anlagen 1 246 ha 18,3 Acker, Wiesen und Weiden 1 890 ha 27,8 21 ha 0,3% Wald 2 636 ha 38,7% Wald, davon Anteil Stadtwald 1 677 ha Gebäudefläche Rebland Bahnen, Strassen und Wege 566 ha 8,3 Gewässer (Parzellenflächen) 44 ha 0,6 Unkultiviertes Gebiet (Riedland, Felsgebiet 25 ha 0,4 usw.) Quelle: Vermessungsamt Winterthur. Stand Ende 2008 Der Wald prägt die Winterthurer Landschaft – eine Landschaft, die sich in diesem den letzten zwei Jahrhunderten so schnell und so radikal verändert hat wie nie zuvor. Die Stadtvereinigung 1922, später der Wirtschaftsaufschwung und das damit verbundene Bevölkerungswachstum führten zu tiefgreifenden Veränderungen der Landschaftsstruktur: Das Siedlungsgebiet breitete sich rasant zwischen den grünen Hügeln aus. Die Landwirtschaft wurde auf Produktion getrimmt Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 21 um die Landesversorgung sicherzustellen. Bäche wurden begradigt, feuchte Täler entwässert, Erschliessungen gebaut und die ehemals strukturreiche Landschaft ausgeräumt. Winterthur ist zur Grossstadt geworden. Auf ehemaligen Industriearealen entstehen vielfältige Wohn- und Gewerbegebiete. Verdichtung im Innern bremsen den ungehemmten Landverschleiss. Das Freizeitverhalten der Winterthurerinnen und Winterthurer hat sich verändert: Öffentliche Räume werden heute viel intensiver genutzt. Die Ansprüche an die verbleibenden Freiräume steigen; Ökologie und Landschaftsbild gewinnen zunehmend an Bedeutung. Seit rund 170 Jahren hat sich an der Fläche und der Verteilung der Winterthurer Wälder wenig geändert. Auf der Wildschen Karte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist aber zu sehen, dass einige bedeutende Waldgebiete erst seit Erscheinen dieser Karte entstanden oder verschwunden sind: Im Leisental oder auf dem Etzberg zum Beispiel dehnten sich vor 170 Jahren an Stelle der heutigen Wälder noch grössere Acker und Weideflächen aus. Andererseits war damals die Tössebene in der Mühlau bei Sennhof viel stärker bewaldet als heute. Und für die Anbauschlacht im Zweiten Weltkrieg fielen ein grösseres Waldgebiet in Wülflingen (Hardholz) und ein kleineres in Hegi (Stahlhölzli) der Axt zum Opfer. Heute umgeben acht grosse Wälder das Winterthurer Siedlungsgebiet. So verschieden diese Waldgebiete sind, eines haben sie gemeinsam: Sie liegen auf Hügeln. Im Norden der Stadt liegt der Lindbergwald. Ihm gegenüber, im Süden zwischen Seen und Töss, dehnt sich der grösste der Winterthurer Wälder aus: der Eschenbergwald. Den Abschluss im Osten bilden der Etzbergwald und der Hulmen. Und ganz im Westen der Stadt liegt der Beerenbergwald. Grössere Waldgebiete bedecken zudem die Talflanken des Dättnau sowie den Brüelberg und den Wolfensberg. Daneben finden sich Wälder nördlich von Stadel, an der Grenze zu Zell (Schartegg) und schliesslich nördlich der Wallrüti in Oberwinterthur (Schoren). Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 22 Archiv der Kategorie „Pilze Pilze sind für das Ökosystem Wald zentral 20. Mai 2014 Der Wald ist der wichtigste Lebensraum für Pilze: Hier wachsen mehr als zwei Drittel aller einheimischen Pilzarten. Umgekehrt spielen die Pilze für das komplexe Ökosystem Wald eine zentrale Rolle. Sie zersetzen organisches Material wie Holz, Laub oder Nadelstreu und halten so den Nährstoffkreislauf in Schwung. Und für Insekten, Kleinsäuger und Schnecken sind sie selber eine Nahrungsquelle. Was wir als Pilz bezeichnen, ist lediglich der Fruchtkörper. Das Mycel, das feine Pilzgeflecht, wächst für uns verborgen im Boden oder im Holz. Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 23 Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 24 Rund 1600 einheimische Pilzarten leben mit Waldbäumen in einer Symbiose, einer Lebensgemeinschaft also, von der beide profitieren. Diese Pilze, so genannte Mykorrhizapilze, versorgen die Baumwurzeln mit Wasser, verbessern deren Nährstoffversorgung, filtern gewisse Schadstoffe und schützen die Wurzeln vor Krankheitserregern. Umgekehrt erhalten sie vom Baum Zuckerbausteine, die sie mangels Photosynthese nicht selber herstellen können.1 Diese Lebensgemeinschaft ist hochspezifisch: gewisse Pilzarten kommen nur zusammen mit bestimmten Baumarten vor. Andere Pilze, die Saprophyten oder Fäulnisbewohner, leben auf dem Totholz spezifischer Baumarten und bauen die Holzsubstanz ab oder sie bauen zusammen mit weiteren Mikroorganismen anderes organisches Material wie abgestorbene Krautpflanzen, Laub, Nadeln und tote Tiere ab und verwandeln dies wieder in wertvollen Humus. Schliesslich gibt es Pilze, die als Parasiten den Wirtsbaum schädigen und zum Absterben bringen. Auch sie sind unter dem Aspekt des Naturschutzes wichtig, weil sie im Wald eine Dynamik und eine Strukturvielfalt fördern. In der Schweiz kommen rund 5500 Grosspilze vor, wobei die allermeisten ungeniessbar sind. Etwa 200 Grosspilze sind giftig und rund 300 essbar.2 Im Kanton Zürich ist das Sammeln von Pilzen vom ersten bis zum zehnten Tag jedes Monats verboten; an den übrigen Tagen darf man Pilze sammeln – allerdings nur ein Kilogramm pro Person. Die Wälder um Winterthur sind – was die Pilze betrifft – aufgrund der Strukturvielfalt relativ artenreich. Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 25 Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 26 Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 27 Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 28 Zu den bekanntesten Pilzarten unserer Gegend gehört der giftige Fliegenpilz. Er ist von August bis Oktober verbreitet in Fichtenwäldern anzutreffen. Auf dem Lindberg, auf dem Eschenberg oder auf dem Hulmen zum Beispiel ist der Fliegenpilz auf sauren Böden sehr häufig anzutreffen – auch in Laubwäldern, vor allem in der Nähe von Birken und an Waldrändern. Ein anderer bekannter Pilz, die Morchel, gedeiht beispielsweise in den ehemaligen Auenwäldern im Leisental. Auf den sauren, teilweise mit Heidelbeeren bewachsenen Böden am Hulmen findet man den Flockenstieligen Hexenröhrling, den Maronenröhrling oder Steinpilze. Auf den eher basenreichen Böden unterhalb von Eidberg kommt die Schleiereule (blaugestielter Schleimkopf) oder der Trompetenpfifferling vor. In den Nadelholzbeständen des Eschenbergs, etwa beim Gamser, findet man Reizker, diverse Täublinge und ebenfalls Steinpilze. Eierschwämme, den seltenen Ochsenröhrling, Steinpilze, den Kuhröhrling oder den rosaroten Gelbfuss lassen sich auf den sauren Böden um Ricketwil aufspüren. Auf Baumstrünken findet man häufig das Stockschwämmchen oder den Hallimasch und auf Buchenlaub die Herbsttrompeten. Auf Moos und in Fichtenverjüngungen wachsen Eierschwämme und Trompetenpfifferlinge. Und schliesslich finden sich in Lichtungen von Nadelwäldern der Parasol und dern Safranschirmling. Selbstgepflückte Pilze bringt man – zur eigenen Sicherheit – am besten immer zu Pilzkontrollstelle. Gewöhnliche Gelbflechte (Xanthoria parietina) Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 29 Eine Sondergruppe von Pilzen sind jene, die zusammen mit Algen in einer Symbiose leben und so die Flechten bilden. Flechten sind vollkommen selbstständige Organismen. Baumbewohnende Flechten sind vom Boden unabhängig und leben epiphytisch, sitzen also auf Bäumen auf. Dabei schaden sie dem Baum nicht: Sie haben nämlich keine Wurzeln und nehmen die Nährstoffe aus der Luft über den Regen auf, über den Tau, den Wasserdampf oder über das Wasser, das den Stamm herunterfliesst. Die Symbiose von Pilz und Alge stellt ein sensibles Gleichgewicht dar.3 Die Alge ist gewissermassen das Kraftwerk der Flechte: Sie führt dem Pilz den Zucker zu, den dieser nicht selber produzieren kann. Der Pilz andererseits schützt die Flechte vor dem Austrocknen. Viele Flechten benötigen altes oder totes Holz als Unterlage. In der Schweiz ist jede dritte Flechtenart gefährdet. Der Anteil der gefährdeten Baumflechten ist am höchsten in lichten naturnahen Wäldern, Altholzbeständen, lichten Eichen-Mittelwäldern, auf mächtigen Eichen in Wäldern oder an Waldrändern.4 Flechten sind verlässliche Indikatoren für den Zustand des Waldes, vor allem der Luftqualität. Einzelnachweise 1. Senn-Irlet Beatrice et al. (2012): Pilze schützen und fördern. Merkblatt für die Praxis, WSL (Hrsg.), S. 3. 2. ebd. 3. Scheidegger Christoph Clerc Philippe (2002): Rote Liste der gefährdeten Arten der Schweiz: Baum- und erdbewohnende Flechten. Hrsg.: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL Birmensdorf und Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève CJBG. BUWAL-Reihe Vollzug Umwelt, S. 20. 4. ebd., S. 9. Dossier Rundweg Exkursion Mittelstufe Anhang Seite 30 Modul 5: Erlebniswelt Wandern Quelle: www.schooltrip.ch Arbeitsblatt Grillrezepte Name: 1. Auf einem Feuer kann man auch andere Sachen braten als Würste. Ordne dem Bild, den Zutaten und der Zubereitung die richtige Nummer aus dem Titel zu! 1. Feuer--Kartoffeln 2. Schoggi--Banane 3. Schlangenbrot 2 Zutaten pro Person: 1 Banane 4 «Häuschen» Schokolade Zutaten pro Person: 1 grosse Kartoffel (je nach Hunger) Variante: mit 1 Scheibe Schmelzkäse füllen Zubereitung: Die Kartoffeln werden ungeschält in Alufolie gewickelt und so in die Glut gelegt. Während des Garens musst du sie ab und