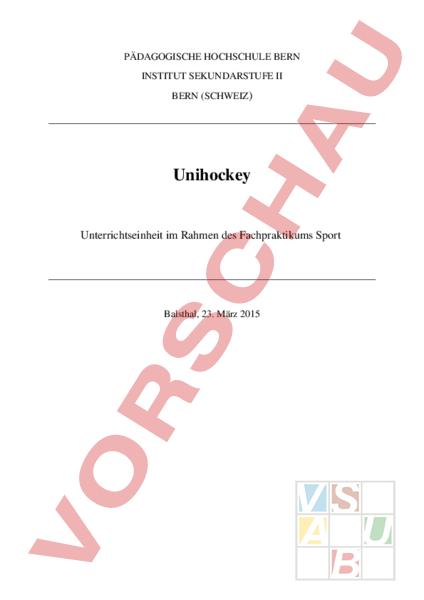Arbeitsblatt: Unterrichtseinheit Unihockey
Material-Details
Gestaltung einer Unterrichtseinheit Unihockey
mit Prüfung
Bewegung / Sport
Spiel
10. Schuljahr
18 Seiten
Statistik
152240
1303
30
11.10.2015
Autor/in
Mathias Hammer
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE BERN INSTITUT SEKUNDARSTUFE II BERN (SCHWEIZ) Unihockey Unterrichtseinheit im Rahmen des Fachpraktikums Sport Balsthal, 23. März 2015 Inhaltsverzeichnis 2 Sachanalyse zum Thema6 3 Didaktische Analyse.7 4 Zielsetzungen.10 5 Begründete Methoden und Medienwahl.12 6 Unterrichtsevaluation.13 7 Unterrichtsverlauf14 8 Anhang.15 Literatur.15 Unihockeytest Technikparcours17 .17 Anleitung Technikparcours.18 Technikparcours Notenberechnung BonusMalus19 Kriterien Spielnote20 Personale Bedingungen Die Klasse 19abc besteht aus 27 männlichen Schülern und ist zusammengesetzt aus den drei Quinta Klassen a, und c. Zwei Schüler sind verletzt und können nur beschränkt am Sportunterricht teilnehmen. Diese Schüler kann man gut als Schiedsrichter, oder für andere Aufgaben einsetzen. Sofern es geht sollten sie jedoch etwas machen, das möglichst nahe an dem ist, was die Klasse macht. Die einzelnen Sequenzen dieser Unterrichtseinheit werden im Teamteaching gehalten. Das bedeutet, dass die Klasse auf zwei Lehrpersonen aufgeteilt wird. Die Planung der Unterrichtssequenzen orientiert sich somit an einer Klassengrösse von nur ca. 13 Schüler. Für diese Schulstufe ist Sport ein Promotionsfach, was bedeutet, dass die Note für die Schüler sehr wichtig ist. Die Lehrperson kann daher davon ausgehen, dass die Schüler gut mitmachen und sich eher unterordnen, als dies vielleicht bei einem nicht benoteten Sportunterricht der Fall ist. Die Sportklasse 19abc ist eine sehr lebendige Klasse, die darauf brennt, sich zu bewegen. Anders als bei der Quarta müssen diese Schüler noch mehr gezügelt werden. Einige Schüler können sich nach dem Anblick eines Spielgerätes kaum mehr auf die Worte der Lehrperson konzentrieren. Bei diesen Schülern ist die Lehrperson gefordert, sie zur Ruhe zu bringen und deren Gedanken auf das Wesentliche zu lenken. Es ist sehr wichtig, transparent zu sein, und den Schülern somit klar zu machen, was einen wichtig ist. Die Klasse bringt aber die Grundvoraussetzungen für einen guten Sportunterricht, nämlich der Wille, sich zu bewegen, mit, was für mich als Lehrperson sehr erfreulich ist. Lieber zu viel Energie auf ein gutes und lernförderliches Niveau eindämmen, als die Schüler für jede Bewegung auffordern und motivieren müssen. Inhaltliche Bedingungen Unihockey ist ein Spiel, das schon in unteren Schulstufen gespielt wird. Zudem ist es auch ein beliebtes Spiel auf „der Strasse, wenn Kinder draussen spielen. Die Schüler bringen somit schon einige Erfahrungen mit der Sportart Unihockey mit. Es hat sich erwiesen, dass das Spielniveau der Schüler sehr unterschiedlich ist. Technisch und taktisch ist noch einiges herauszuholen, worauf diese Unterrichtseinheit auch abzielt. In sechs Einzellektionen, verteilt auf sechs Wochen, sollen die Schüler die Möglichkeit erhalten, technische und taktische Fähigkeiten im Unihockey zu erwerben und/oder zu verbessern und anzuwenden. Die Quinta ist das achte Schuljahr und stellt eine Schnittstelle zur Oberstufe dar, weshalb die Inhalte des achten Schuljahres nicht im Lehrplan für Gymnasien zu finden ist. In einem Fachgruppentreffen mit Sportlehrkräften der Agglomeration Bern wurde ein Kantonaler Lehrplan für Maturitätsschulen entwickelt. Die Grobziele und Inhalte der geplanten Unterrichtseinheit richten sich nach diesem Lehrplan. Für das achte Schuljahr sind im Bereich Spielen folgende Grobziele zu entnehmen: A) Ballspielübergreifende technische Grundfähigkeiten erwerben und anwenden. B) Ballspielübergreifende taktische Grundfähigkeiten erwerben und anwenden; Spielvielfalt hoch halten. Inhalte sind Freilaufen, in den freien Raum zuspielen, und Angreifen gegen individuelle Verteidigung. Die Schüler sollen in technischen und in taktischen Bereichen Übungen durchführen und so die Möglichkeit erhalten, Fähigkeiten zu erwerben und anzuwenden. Im Spiel sollen die Schüler Regeln einhalten, fair spielen und die erworbenen Fähigkeiten anwenden können. Spannende und für den Unterricht sinnvolle Spielformen, sowie auch die wichtigsten Regeln und Evaluationsformen finden sich in einem Dokument des Bundesamtes für Sport (2012) und Swissunihockey (2014). Ebenso liefert das Bundesamt für Sport (2013) interessante Literatur zum Thema Unihockey. Neben verschiedenen Übungsformen werden in diesem Dokument auch Tests für die Schule erläutert. Situative Bedingungen Das Gymnasium KönizLerbermatt verfügt über zwei Einzelhallen und eine Dreifachturnhalle. Die Dreifachturnhalle kann durch verstellbare Trennwände in zwei oder drei Hallen unterteilt werden. Es gibt einen grossen Geräteraum, der von allen Hallen aus zugänglich ist und bezüglich der Ausrüstung von Geräten und Material nichts zu wünschen übrig lässt. Es hat zwei abschliessbare Bereiche für kleinere Geräte, wie Bälle, Gymnastikringe, Töggeli oder auch Magnesium. Die Auswahl und Menge an Geräten und bietet optimale Bedingungen für den Sportunterricht. Im Saubergang zwischen den Hallen und den Umkleideräumen hat es Schränke, wo weiteres Material wie Badmintonschläger und Shuttles, Smolballschläger usw. versorgt sind. Im Geräteraum hat es Notausgänge, die freigehalten werden müssen. Die Sportlehrpersonen sollten darauf achten, dass die Geräte von den Schülern an den richtigen Ort versorgt werden und nicht die Notausgänge versperren. Jede Halle besitzt eine Musikanlage. MP3 Player können problemlos an die Anlage angeschlossen werden. Ebenso hat jede Halle eine Magnetwand und ein Whiteboard, wo allfällige Blätter aufgehängt werden können oder etwas aufgezeichnet werden kann. In Einzellektionen dauert der Unterricht nur 40 Minuten, damit die Schüler genug Zeit haben, sich zu duschen. Bei einer Doppellektion steht der Lehrperson 90 Minuten mit der Klasse zur Verfügung. Die Klasse 19abc hat in einer Woche drei Lektionen Sport, davon eine Doppellektion am Dienstag und eine Einzellektion am Donnerstag. In dieser Unterrichtseinheit wird die Unihockeylektion für gewöhnlich in der Doppelstunde gehalten. Eine Ausnahme bildet die Prüfungslektion, die am Donnerstag angesetzt ist und deshalb nur 40 Minuten dauert. Das Lehrerzimmer der Fachschaft Sport befindet sich im Erdgeschoss des Turnhallengebäudes. Beim Lehrerzimmer können die Schüler und Schülerinnen Spielgeräte wie Tischtennisschläger, Frisbee, Fussball oder Basketball ausleihen. Im Lehrerzimmer befindet sich auch ein ErsteHilfe Koffer und sämtliche Notrufnummern. 2 Sachanalyse zum Thema 3 Didaktische Analyse Exemplarische Bedeutung Unihockey ist eine Ballsportart. Wie auch beim Fussball, Handball, Smolball, Lacross und Basketball ist es das Ziel, Tore zu schiessen und Gegentore zu verhindern. Fähigkeiten wie zum Beispiel das Freilaufen, Überzahlsituationen generieren, Gegentore verhindern, oder Mitspieler wahrnehmen und sie ins Spiel bringen sind Gemeinsamkeiten all dieser Sportarten. Im Volksmund spricht man oft von Spielertypen, und meint damit Personen, denen Sportspiele einfach liegen, egal welche. Die Erklärung, weshalb eine Person eine vorher noch nie ausgeübte Sportart im Nu beherrscht, kann darin gefunden werden, dass viele Spielsportarten ähnliche Fähigkeitsbausteine enthalten und ähnliche Ziele verfolgen. Erwirbt man Fähigkeiten in einer Sportart, können diese gleich für andere Sportarten verwendet werden. Es ist mir deshalb auch ein Anliegen, diese Ähnlichkeit zu anderen Sportarten zu nutzen und nicht nur sportartspezifische Fähigkeiten zu fördern, sondern den Schülern auch die Möglichkeit zu bieten, sich übergreifende Fähigkeiten aneignen zu können, und sich darin zu verbessern. Mit dem Unihockeyspiel lernen Schüler, zu gewinnen und zu verlieren, beziehungsweise damit umzugehen. Es ist das Miteinander und das Gegeneinander, das die Schüler auch in sozialen Kompetenzen weiterbringen kann. Fairplay, der Umgang mit Leistungsunterschieden, oder die Rollenwahrnehmung und –akzeptanz sind alles Aspekte, die in diesem Spiel gefördert werden können und auch in andere Sportarten übertragen werden können. Gegenwartsbedeutung Im Unihockey können sich Schüler technische, taktische und auch soziale Fähigkeiten aneignen. Die Schüler sollen lernen, einen präzisen Flachpass zu spielen, den Ball eng am Stock zu führen, die Mitspieler wahrzunehmen, den öffnenden Pass zu spielen, Überzahlsituationen auszunutzen, mit Sieg und Niederlage umzugehen, Fairplay einzuhalten und vieles mehr. All diese Fähigkeiten und Erfahrungen können die Schüler in verschiedenen Lebenssituationen wieder gebrauchen. In der Schule gibt es immer wieder Unihockeyturniere, bei denen sich die Schüler anmelden können. Es ist daher wichtig, dass sich die Schüler auf diese Turniere vorbereiten können, um sich mit anderen Teams messen zu können. Grundsätzliche Regelkenntnisse, sowie fundamentale technische und taktische Fähigkeiten sind Voraussetzungen, um ein gepflegtes Spiel zu hegen und sich in einem Turnier gegen andere Mannschaften durchsetzen zu können. Mit den im Unterricht erworbenen Fähigkeiten und Kenntnissen werden die Schüler auf Wettkampfformen des Unihockeyspiels vorbereitet. Auch im Alltag können die erworbenen Fähigkeiten zum Tragen kommen. Bei einem lockeren Unihockeymatch mit ein paar Freunden auf der Strasse oder auch bei Plauschturnieren, die von Sportvereinen organisiert werden, sind diejenigen mit mehr Erfahrung im Unihockey im Vorteil gegenüber denen, die Unihockey das letzte mal in der Primarschule spielten. Vermutete Zukunftsbedeutung Die Schüler sollen während der Unterrichtseinheit Fortschritte in technischen und taktischen Belangen erzielen. Durch das Üben werden Schüler in einzelnen Fähigkeiten besser. Damit kann den Schülern vermittelt werden, dass es sich lohnt, zu üben und an einer Sache dran zu bleiben. Sie lernen, dass sie mit Konzentration und Hartnäckigkeit etwas erreichen können. Dies lässt sich einerseits auf den Schulalltag, andererseits auf das spätere Berufsleben übertragen. Beide Bereiche fordern die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können und zu üben und lernen, damit man einen Schritt weiterkommt. Auch der Umgang mit Sieg und Niederlage kann auf den Alltag übertragen werden. Täglich scheitern wir an irgendwelchen Dingen. Im Unihockeyspiel lernen die Schüler, dass eine Niederlage nicht den Weltuntergang bedeutet und es danach weitergeht und die nächste Möglichkeit für einen Sieg kommen wird. Fairplay und soziale Kompetenzen kommen gerade im Unihockey oft zum Tragen, da es ein sehr dynamisches Spiel ist mit vielen Zweikämpfen und vielen umstrittenen Situationen. Die Schüler lernen, Rücksicht auf Mitschüler zu nehmen, und sich auch mal zu „opfern, wenn wieder mal niemand ins Tor will, oder wenn die Auswechselspieler schon lange draussen sind und gewechselt werden sollte. Fleiss, Rücksichtsnahme, Fairplay, der Umgang mit Sieg und Niederlage, oder sich in einem Team einzubringen sind alles Eigenschaften oder Fähigkeiten, die nebst dem Sport auch im privaten und beruflichen Leben eine wichtige Rolle einnehmen. Mit der Akzeptanz von Schiedsrichterentscheiden lernen die Schüler, sich an Spielregeln zu halten und eventuell auch mit Fehlentscheidungen umzugehen. Auch im echten Leben gibt es gewisse Vorgaben, die man einfach einhalten muss. Wer zum Beispiel sein Zugticket nicht vor der Fahrt löst, zahlt eine Busse, auch wenn man es nicht absichtlich gemacht hat. In solchen Situationen geht es darum, Verständnis gegenüber dem System „SBB entgegen zu bringen und deren Entscheidung zu akzeptieren. Betrachtet man die spezifische Bedeutung des Unihockeys, so kann diese in verschiedenen Bereichen gefunden werden. Mit der Einführung dieses Spiels haben die Schüler eine Einstiegsmöglichkeit in ein neues Hobby. Die Schüler kennen die wichtigsten Regeln des Unihockey und können diese bei einem Spiel in der Freizeit anwenden und ein gepflegtes Spiel ermöglichen. Zugänglichkeit Floorball Köniz ist ein sehr erfolgreicher Unihockeyverein mit einer professionellen Nachwuchsförderung. Dementsprechend ist dieser Verein in Köniz auch unter den Schülern bestens bekannt. Zusätzlich zur grundsätzlich hohen Spielmotivation der Klasse ist ein regionaler Verein, der national erfolgreich ist ein Begeisterungsfaktor für die Sportart Unihockey. Einige Schüler haben vielleicht schon Matches gesehen und haben eventuell das Ziel, selbst mal in diesem Verein spielen zu können. Mit diesem Hintergrund können die Schüler motiviert werden, sich im Unterricht vertieft mit dieser Sportart auseinander zu setzen. 4 Zielsetzungen Sinnperspektiven In dieser Unterrichtseinheit sollen verschiedene Sinnperspektiven zum Tragen kommen, um möglichst viele Schüler für diese Sportart begeistern zu können. Die Sportklasse 19abc bringt viel Bewegungsdrang und Spiellust mit in den Unterricht. Diese Bedürfnisse zu befriedigen muss unbedingt in der Planung der Unterrichtseinheit berücksichtigt werden. Mit dem Üben von spezifischen technischen und taktischen Fähigkeiten, dem Erlernen und Einhalten von Regeln und dem Spielen unterschiedlicher Spiel und Wettkampfformen, in denen sie erworbene Fähigkeiten anwenden können, können die Sinnrichtungen „üben und leisten, „herausfordern und wetteifern, „dabei sein und dazu gehören, und auch „erfahren und entdecken angesprochen werden. Zu Beginn soll jedoch „sich wohl und gesund fühlen im Vordergrund stehen, damit die Schüler ihre Spiellust befriedigen können und sie motiviert in den Unterricht starten. Wie die Unterrichtseinheit unter anderem hinsichtlich dieser Sinnperspektiven aufgebaut ist, wird im Kapitel 5 dieser Arbeit erläutert. Gobziele: Die Schüler haben Freude am Spiel. (affektiv) Die Schüler spielen fair. (affektiv) Die Schüler erwerben technische Fähigkeiten in den Bereichen Ballführen, Passen, Annehmen und Schiessen und wenden diese im Spiel an. (psychomotorisch) Die Schüler nutzen Überzahlsituationen aus (affektiv, psychomotorisch) Die Schüler wenden ihr taktisches Wissen in der Verteidigung und im Angriff an. (kognitiv, pschomotorisch) Die Schüler spielen die Endform (4:4 inkl. Torhüter) und wechseln selbständig die Mitspieler aus. (psychomotorisch, affektiv) Feinziele: Die Schüler zeigen Freude beim Spiel durch Lachen, Torjubel oder anderen freudigen Gesten. (affektiv) Die Schüler bringen einen Rhythmuswechsel ins Spiel. Im Ballbesitz variieren sie ihre Laufgeschwindigkeit. (psychomotorisch) Die Schüler probieren drei verschiedene Arten, den Ball zu führen aus (enger, weiter und mittlerer Griff des Stockes). (psychomotorisch) Die Schüler messen sich in der Zeit bei einem Technikparcours (psychomotorisch) Die Schüler vermeiden den Stockschlag im Spiel. (psychomotorisch, kognitiv) Die Schüler treffen ein halb verdecktes Tor im Spiel. (psychomotorisch) Die Schüler setzen ihren Körper im Spiel ohne Foul ein. (psychomotorisch) Die Schüler können einen präzisen hohen Pass in die Hände des Torwarts spielen (psychomotorisch) Die Schüler können sich zehnmal einen Ball hin und her passen, ohne dass der Ball den Boden verlässt. (psychomotorisch) Die Schüler wissen, was Inside stehen bedeutet und setzen es im Spiel um. (kognitiv, psychomotorisch) Die Schüler spielen im Angriff mit einem 12 System. (psychomotorisch) Die Schüler wechseln ihre Aufstellung bei gegnerischem Ballbesitz auf ein 21 System um. (psychomotorisch) Die Schüler können Unihockey mit Torhüter auf dem Kleinfeld ohne Schiedsrichter spielen. (psychomotorisch, affektiv) Persönliche Zielsetzungen als Lehrperson: Die persönlichen Zielsetzungen sind dieselben, wie bei der ersten Unterrichtseinheit und gehen von den Stärken und Schwächen aus dem Entwicklungsprofil des Einführungspraktikums hervor. Es hat sich im Einführungspraktikum gezeigt, dass ich mir grundsätzlich zu viel vornehme. Ich möchte in dieser Unterrichtseinheit darauf achten, alle wesentlichen Elemente der Unterrichtspräparation berücksichtigen, ganz nach dem Motto „weniger ist mehr. Ein weiteres Ziel ist es, den Unterricht klar zu strukturieren, indem ich einen Einstieg, eine Ver und Erarbeitungsphase und einen Schluss deutlich definiere. Des Weiteren möchte ich folgende Ziele erreichen: Ergebnissicherung klar definieren Die Eigenverantwortung der Lernenden fördern Medien zielgerichtet einsetzen In hektischen Situationen ruhig bleiben Bei Störungen intervenieren (verhältnismässig) Im aktuellen Fachpraktikum waren in den Besprechungen der Lektionen mit meiner Praxislehrperson Interventionen stets ein Thema. Es ist von grosser Wichtigkeit, seine Linie zu haben und diese durchzuziehen, damit die Schülerinnen und Schüler – vor allem längerfristig – die Inkonsequenz nicht ausnutzen und sie genau wissen, was sie sich erlauben dürfen und was nicht. Ich möchte in den verbleibenden Unterrichtssequenzen vermehrt den Fokus darauf legen, das was mir im Unterricht wichtig ist, auch wirklich durchzusetzen und konsequenter auf Störungen zu reagieren. Grundsätzlich möchte ich den Schülern einen spannenden und lehrreichen Unterricht bieten, und meine Begeisterung für den Sport vermitteln. Ich möchte meine ruhige Art und den guten Draht zu den Schülern dazu einsetzen, gute Voraussetzungen für einen reibungslosen Sportunterricht zu schaffen. 5 Begründete Methoden und Medienwahl Mit dem Ziel vor Augen, die Bedürfnisse der Schüler in der Planung der Unterrichtseinheit zu berücksichtigen, soll vor allem am Anfang die Sinnrichtung „sich wohl und gesund fühlen zum Tragen kommen. Das Üben und Leisten, sowie Wettkampfformen dürfen aber nicht fehlen, um den Kantonalen Lernzielen gerecht zu werden, und werden im Verlauf der Unterrichtseinheit ebenfalls berücksichtigt. Ein Modell, das sich für die Vermittlung eines Spiels sehr gut eignet und gleichzeitig oben genannten den Anforderungen an den Unterricht gerecht werden kann, ist das GAG Modell (Bucher Ernst, 2005). Dieses Modell unterscheidet drei Phasen der Unterrichtsstruktur. Das erste steht für ganzheitlich, das steht für analytisch und das zweite steht wieder für ganzheitlich. Die Schüler sollen zuerst eine ganzheitliche Spielsituation erleben, um die Motivation und die Einsicht zu erlangen, sich analytisch mit einzelnen Elementen des Spiels, zum Beispiel der Technik oder der Taktik auseinanderzusetzten. Ein Schüler, der den Ball im Spiel nie annehmen kann oder jedes Mal neben das Tor schiesst, merkt selbst, dass er sich wohl in diesen Bereichen noch verbessern sollte. Und genau dies kann er in der analytischen Phase des Unterrichts. Nach dem Erwerben und/oder Verbessern einzelner Fähigkeiten sollen diese wieder ganzheitlich in einem Spiel angewandt werden. Schlussendlich geht es darum, zu spielen. Es nützt nichts, wenn ein Schüler in den Übungen einen sauberen Pass spielen kann, diesen aber im Spiel unter Druck nicht richtig hinbringt. Daher ist es umso wichtiger, das Erworbene im ganzheitlichen Spiel anwenden und verarbeiten zu können. Es ist das Ziel, diese GAG Struktur möglichst in den einzelnen Unterrichtssequenzen einzuhalten. Über die ganze Unterrichtseinheit hinweg sollen die Phasen aber unterschiedlich gewichtet werden. Am Anfang der Unterrichtseinheit soll der Schwerpunkt auf dem Ganzheitlichen liegen, und sich im Verlauf der Einheit in Richtung des Analytischen verschieben, um sich am Ende wieder schwerpunktmässig dem Ganzheitlichen zu widmen. 6 Unterrichtsevaluation Die Unterrichtsevaluation soll einerseits formativ während dem Unterricht geschehen, andererseits soll gegen Ende der Unterrichtseinheit eine summative Evaluation in Form eines Techniktests und einer Spielnote stattfinden. Die formative Evaluation des Unterrichts geschieht in jeder Lektion, in dem durch Beobachtungen und klaren Vorgaben die gesetzten Lernziele überprüft werden. Die Lehrperson richtet ihre Beobachtungen nach den formulierten Feinzielen und kann zum Beispiel überprüfen, wie viele Flachpässe die Schüler innert einer Minute spielen können, in dem sie einen Wettkampf daraus macht und die Schüler ihre Pässe zählen. In Torschussübungen oder auch im Spiel zeigt sich, ob die Schüler fähig sind, Tore zu schiessen. Ob die Schüler die Regeln verstanden haben kann einerseits durch den Einsatz von Schüler als Schiedsrichter geprüft werden, andererseits ist ein Spiel ohne viel Fouls und Unterbrechungen ein Zeichen dafür, dass die Schüler die Regeln verstanden haben und umsetzen können. Am Ende der Unterrichtseinheit sollen die Schüler eine Note im Unihockey erhalten. Diese setzt sich zusammen aus der Spielnote und der Leistung im Technikparcours. Im Anhang sind die Bewertungskriterien für die beiden Teilnoten erläutert. Im Technikparcours geht es darum, technische Fähigkeiten wie Passen, Ballführen und Schuss zu testen. Mit der gestoppten Zeit und einem Bonus/MalusSystem wird schlussendlich die Note berechnet. Bei der Spielnote werden verschiedene Aspekte des Spiels berücksichtigt. Bewertet werden der Einsatz, das taktische Verhalten und das Fairplay. Die Kriterien sind im Anhang zu finden und richten sich nach einem Dokument des BASPO (2012). 7 Unterrichtsverlauf Lekt. Nr. 1 40 Begründungen Lernziele und Inhalte Organisation Einführung. Spielform als ganzheitlicher Einstieg ins Unihockey. Analytischer Teil: Technik. Abschluss: Ganzheitlich/ Spiel Inhalt: Spielformen ohne Torhüter, Die Schüler trainieren einzeln das Ballführen, welches in einer Stafette in der Gruppe zum Tragen kommt. Technikübungen zu Ballführen, und Stocktechnik, Regelkenntnis: Stockschlag und Stockvergehen Grundsätzliche Regeln beim Pully, usw. werden während dem Spiel erläutert! (gilt für sämtliche Unterrichtssequenzen) Ziele: 2 40 Spielform zum Aufwärmen. Analytischer Teil: Technik. Abschluss: Ganzheitlich/ Spiel Die Schüler zeigen Freude beim Spiel durch Lachen, Torjubel oder anderen freudigen Gesten Die Schüler probieren verschiedene Arten, den Ball zu führen aus. Inhalt: Passen als Technikelement üben, Spielformen ohne Torhüter, Regelkenntnis: Körpereinsatz Die Schüler machen die Passübungen zu zweit Ziele: Die Schüler setzen ihren Körper im Spiel ohne Foul ein Die Schüler können einen präzisen hohen Pass in die Hände des Mitspielers spielen Die Schüler können sich zehnmal einen Ball hin und her passen, ohne dass der Ball den Boden verlässt 3 40 Spielform zum Aufwärmen. Analytischer Teil: Technik. Abschluss: Ganzheitlich/ Spiel Inhalt: Technikparcours einführen und üben, Schusstechnik üben, Spiel ohne Torhüter (Kastenoberteil im Tor) Regelkenntnis: hoher Stock Ziele: Die Schüler messen sich in der Zeit bei einem Technikparcours Die Schüler treffen ein halb verdecktes Tor im Spiel. Den Parcours und die Schussübungen sind individuell durchführbar. z.T. zu Zweit 4 40 Spielform zum Aufwärmen. Analytischer Teil: Taktik. Abschluss: Ganzheitlich/ Spiel Inhalt: Spiel mit Torhüter, Spielformen mit Überzahlspiel, Mehrtorespiel, Verkehrte Tore. Ziele: Die Schüler erkennen Lücken und spielen den Pass. Die Schüler nutzen Torchancen aus. Die Schüler schiessen Tore gegen einen Torhüter 5 40 Spielform zum Aufwärmen. Analytischer Teil: Taktik. Abschluss: Ganzheitlich/ Spiel Inhalt: Spiel mit Torhüter, Testen von taktischen Vorgaben im Spiel, verschiedene Spielformen. Inside stehen Dreiecksaufstellung 12 bzw. 21 Vier Teams bilden für „verkehrte Tore (jeweils in der halben Halle) Für Überzahlspiel wird das Brazil Spiel gespielt. Die Angreifende Mannschaft hat 2 Spieler mehr. Aufstellungen Defensive und Offensive, sowie Inside an Whiteboard erklären. Ziele: 6 40 Testen der technischen und taktischen Kompetenzen Die Schüler wechseln ihre Aufstellung von der Offensive in die Defensive. Inhalt: Technik und Spielnote Ziele: Die Schüler zeigen ihr technisches und taktisches Können. 2 Techikparcours aufbauen, und Schüler 5 min. Einspielen lassen. Danach wird einzeln getestet. Spielnote: Selbständiges Spiel mit zwei Teams. 8 Anhang Literatur Bucher, W. Ernst, K. (2005). Sporttheoretische und sportdidaktische Grundlagen. Lehrmittel Sporterziehung – Grundlagen, Band 1, Broschüre 1. Bundesamt fur Sport [BASPO] (2012). Unihockey. Spielnote, Zugriff am 20.02.2015 unter 65a2a889a492/Spielnote.pdf Bundesamt für Sport [BASPO] (2013). Unihockey. Spielend entdecken, Zugriff am 16.02.2015 unter entdecken/ Swissunihockey (2014). Vom Ballführen zum Zweikampf. Zugriff am 20.02.2015 unter d89bb23c3348/Lehrplaene.pdf Unihockeytest Technikparcours (Quelle: Reto Ferrari, Gymnasium KönizLerbermatt) Anleitung Technikparcours (Quelle: Reto Ferrari, Gymnasium KönizLerbermatt) Dieser Test ist ausgelegt für Einzelturnhallen. Als Orientierung dient ein Badmintonfeld. 1. Doppelpass via Langbank. Vorhand oder Rückhand an die Bank. Abspiel zwischen den Pfosten hinter der VolleyballfeldGrundlinie. Annahme ebenfalls hinter der Grundlinie und zwischen den Pfosten. (Malus wenn Ball Zone verlässt oder zu kurz gespielt wird 1; geht der Ball über die Langbank läuft die Zeit weiter und das Zuspiel muss wiederholt werden). 2. Doppelpass via Langbank. Vorhand oder Rückhand (entsprechend Punkt 1 andere Ausführungsvariante wählen) an die Bank. Abspiel zwischen den Pfosten hinter der VolleyballfeldGrundlinie. Annahme ebenfalls hinter der Grundlinie und zwischen den Pfosten. (Malus wenn Ball Zone verlässt oder zu kurz gespielt wird 1; geht der Ball über die Langbank läuft die Zeit weiter und das Zuspiel muss wiederholt werden). 3. Lauf um Malpfosten. Ball wird kontrolliert geführt (Ball ausser Reichweite 1). Ball und Spieler laufen eine Acht um die Pfosten. Lauf zwischen zwei letzte Markierungskegel. 4. Torschuss. Ball vor letztem Markierungskegel Richtung Tor abgeben. (Malus: Ball nach dem Markierungskegel abgegeben 1, Ball nicht im Tor 2, Kastenoberteil getroffen 1; Bonus: jeder Ball im Tor 3). Punkte 1. 4. werden 3x durchgeführt, wobei der Spieler bei jedem weiteren Torschuss einen Markierungskegel weiter entfernt vom Tor den Ball abgeben muss. Technikparcours Notenberechnung BonusMalus (Quelle: Reto Ferrari, Gymnasium KönizLerbermatt) Kriterien Spielnote (aus: BASPO, 2012) Bewertung Ungenügend Genügend Kriterien Genügender Einsatz: Auf dem Feld guter Einsatz. Gut Taktik: Holt den Gegner fair ab ohne Sperren oder Stock schlag. Übernimmt in der eigenen Hälfte Deckungs aufgaben. Spielt bei Manndeckung nicht Ballorientiert, spielt den eroberten Ball weg vom Gegner, stellt sich frei als Anspielposition für die Offensive. Fairplay: Lässt sich nicht stets auswechseln. Keine Wechselfehler. Versucht sich zu verbessern. Guter Einsatz: Immer genügende Leistung. Taktik: Hilft gut in Verteidigung und Angriff. Läuft sich geschickt frei, Sehr gut ist immer anspielbar und nutzt freie Räume fürs Zuspiel.Deckt Gegner sehr gut ab und verhindert Tore. Schnelles Umschalten von Offensive und Defensive. Hat Übersicht für Mitspieler. Leaderverhalten: Gibt klare Anweisungen und teilt die Verantwortung im Team. Wechselt rechtzeitig, bei Ballbesitz aus.Faisplay selbstverständlich, kennt die Regeln. No foulplay! Top Einsatz: Immer guter Einsatz. Taktik: Leitet und führt Verteidigung und Angriff. Gewinnt Zweikämpfe und vermeidet unnötige Zweikämpfe. Kreiert eigene und verhindert gegnerische Chancen. Nützt Regeln aus. Sucht und nützt Standardsituationen. Beeinflusst den Spielrhythmus (Spieltempo langsam und schnell „machen). Kann das Spielverhalten seines Teams steuern. Kann Spiele beeinflussen und entscheiden. Leaderverhalten: Autorität im Team und gegenüber anderen Spielern. Unterstützt auch schwächere Spieler.