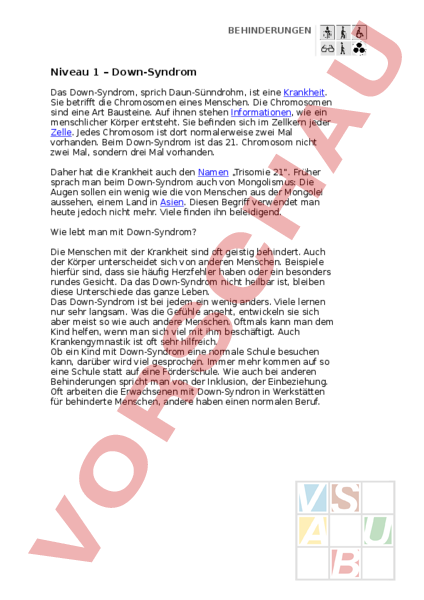Arbeitsblatt: Behinderung
Material-Details
Verlaufsplanung und teils niveaudifferenzierte Texte zu einer Vortragsreihe zum Thema Behinderung.
Lebenskunde
Persönlichkeitsentwicklung
5. Schuljahr
10 Seiten
Statistik
153116
668
11
01.11.2015
Autor/in
Kevin Jelley
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
BEHINDERUNGEN Niveau 1 – Down-Syndrom Das Down-Syndrom, sprich Daun-Sünndrohm, ist eine Krankheit. Sie betrifft die Chromosomen eines Menschen. Die Chromosomen sind eine Art Bausteine. Auf ihnen stehen Informationen, wie ein menschlicher Körper entsteht. Sie befinden sich im Zellkern jeder Zelle. Jedes Chromosom ist dort normalerweise zwei Mal vorhanden. Beim Down-Syndrom ist das 21. Chromosom nicht zwei Mal, sondern drei Mal vorhanden. Daher hat die Krankheit auch den Namen „Trisomie 21. Früher sprach man beim Down-Syndrom auch von Mongolismus: Die Augen sollen ein wenig wie die von Menschen aus der Mongolei aussehen, einem Land in Asien. Diesen Begriff verwendet man heute jedoch nicht mehr. Viele finden ihn beleidigend. Wie lebt man mit Down-Syndrom? Die Menschen mit der Krankheit sind oft geistig behindert. Auch der Körper unterscheidet sich von anderen Menschen. Beispiele hierfür sind, dass sie häufig Herzfehler haben oder ein besonders rundes Gesicht. Da das Down-Syndrom nicht heilbar ist, bleiben diese Unterschiede das ganze Leben. Das Down-Syndrom ist bei jedem ein wenig anders. Viele lernen nur sehr langsam. Was die Gefühle angeht, entwickeln sie sich aber meist so wie auch andere Menschen. Oftmals kann man dem Kind helfen, wenn man sich viel mit ihm beschäftigt. Auch Krankengymnastik ist oft sehr hilfreich. Ob ein Kind mit Down-Syndrom eine normale Schule besuchen kann, darüber wird viel gesprochen. Immer mehr kommen auf so eine Schule statt auf eine Förderschule. Wie auch bei anderen Behinderungen spricht man von der Inklusion, der Einbeziehung. Oft arbeiten die Erwachsenen mit Down-Syndron in Werkstätten für behinderte Menschen, andere haben einen normalen Beruf. BEHINDERUNGEN Niveau 1 – Autismus Was ist eigentlich Autismus? Der Begriff Autismus kommt von griechisch (autos) was soviel bedeutet wie selbst. Beim Autismus handelt es sich um eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Autisten haben Schwierigkeiten, Beziehungen zu ihren Mitmenschen einzugehen, sich in sie hineinzuversetzen und mit ihnen zu kommunizieren. Viele Autisten sind sehr stark auf bestimmte Gewohnheiten und Verhaltensweisen festgelegt. Sie geraten z. B. in Panik, wenn sie einen anderen Weg gehen sollen als sonst. Sie sammeln gern bestimmte Gegenstände oder befassen sich auf andere Art und Weise sehr intensiv mit ihrem Lieblingsthema, lernen z. B. Telefonbücher oder Landkarten auswendig. Diese Eigenheiten kommen daher, dass Autisten Informationen aus ihrer Umwelt auf eine andere Art und Weise verarbeiten als andere Menschen. Andererseits sind manche Autisten in bestimmten Gebieten wie z. B. Mathematik, Kunst oder Musik hochbegabt. Es gibt jedoch viele verschiedene Ausprägungen von Autismus. Das bedeutet, dass ein Autist mit einem anderen kaum Gemeinsamkeiten haben muss. Es gibt Autisten die nicht sprechen können, große Lernschwierigkeiten haben und kaum Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen, aber auch hochintelligente Autisten, die Professoren werden oder in anderen Gebieten Experten sind. Man spricht von einem autistischen Spektrum um deutlich zu machen, wie groß die Bandbreite ist. Welche Formen von Autismus gibt es? So unterscheidet man den frühkindlichen Autismus (KannerSyndrom), den ein Mensch von Geburt an hat und den Asperger Autismus oder auch Aspergersyndrom genannt, das auch später auftreten kann. Frühkindlicher Autismus (Kanner-Syndrom) Kanner-Autisten vermeiden Blick- und Körperkontakt, sie haben Schwierigkeiten damit, sprechen zu lernen, vielen gelingt das ihr ganzes Leben lang nicht. Wenn sie sprechen, dann hat ihre Sprache oftmals keinen kommunikativen Nutzen, d.h. sie sprechen auswendig gelernte Wörter oder Sätze immer wieder, unabhängig von der Situation in der sie sich befinden. Da sie oft auch nicht auf etwas zeigen können, führen sie ihre Bezugspersonen z. B. zu einem gewünschten Gegenstand, um sich verständlich zu machen. Die meisten Menschen mit frühkindlichem Autismus bleiben immer auf Hilfe angewiesen. BEHINDERUNGEN Asperger-Autismus Asperger-Autisten hingegen sind auf den ersten Blick weitaus unauffälliger. Sie können korrekt sprechen, sind normal bis überdurchschnittlich intelligent und besuchen häufig eine normale Schule. Abstrakte Sachverhalte wie z. B. mathematische Formeln oder Spielregeln lernen sie leicht. Auf ihren Spezialgebieten können sie sich zu wahren Experten entwickeln, so gibt es z. B. herausragende Computerfachleute mit Aspergersyndrom. Doch sobald Gefühle ins Spiel kommen, wird es für sie schwierig was nicht bedeutet, dass sie keine Gefühle hätten. Aber es gelingt ihnen oft nicht, den Gesichtsausdruck ihres Gegenübers richtig zu deuten, einfache Höflichkeitsfloskeln wie das Grüßen oder der Smalltalk sind für sie sehr kompliziert. Da sie sich nicht in andere hineinversetzen können, sprechen sie manchmal unangenehme Sachverhalte unverblümt an und wundern sich dann, wenn ihre Umgebung sie unhöflich findet. Wenn sie sich mit anderen Menschen unterhalten, blicken sie ihrem Gegenüber meist nicht in die Augen. Redewendungen mit übertragenen Bedeutungen (z. B. jemanden an der Nase herumführen) nehmen sie wörtlich, was zu ernsten Missverständnissen führen kann. Aufgrund dieser Schwierigkeiten können zwischenmenschliche Kontakte für sie sehr kompliziert und anstrengend sein. Autisten leben daher eher zurückgezogen und haben kaum Freunde. Die Grenze zwischen Asperger und KannerSyndrom ist fließend. Wie entsteht Autismus? Wodurch Autismus ausgelöst wird, ist bis heute nicht sicher geklärt. Vielmehr gibt es eine Reihe von Faktoren, die möglicherweise auch zusammenkommen müssen, damit Autismus entsteht. Bestimmte Veränderungen im Erbgut könnten Auslöser sein, ebenso ein Übermaß an dem männlichen Geschlechtshormon Testosteron im Mutterleib. Das würde auch erklären, warum viel mehr Jungen an Autismus erkranken als Mädchen. Auch Komplikationen bei der Geburt könnten eine Rolle spielen. Denken Autisten anders? Durch computertomografische Aufnahmen von Autisten weiß man, dass in ihren Gehirnen Verbindungen verschiedener Regionen fehlen, besonders das Gefühlszentrum im Hirn ist schlecht verdrahtet. Dafür wächst das Gehirn eines Autisten rascher als das anderer Menschen offenbar unterscheidet es nicht zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen, alle werden gespeichert. Dass es bei dieser Menge an Daten im Kopf zu einer Reizüberflutung kommen kann, verwundert nicht. Und tatsächlich BEHINDERUNGEN sind viele Autisten sehr empfindlich, können z. B. laute Geräusche oder starke Gerüche kaum ertragen und fühlen sich in einer reizarmen Umgebung wesentlich wohler. Nicht-Autisten besitzen eine eigene Gehirnregion, die nur für das Erkennen von Gesichtern zuständig ist. Bei Autisten scheint diese Region nicht aktiv zu sein, daher können sie Gesichtsausdrücke viel schlechter wahrnehmen. Auch bestimmte Verbindungen im Gehirn, die für das Nachahmen zuständig sind, funktionieren nicht so gut und tatsächlich: autistische Kinder imitieren beim Spielen ihre Bezugspersonen nicht. BEHINDERUNGEN Niveau 1 – Blindheit Blindheit Wie lebt man da? Wenn im Treppenhaus plötzlich das Licht ausgeht, erschrecken die meisten und suchen schnell den Lichtschalter. Im Dunkeln weitergehen, ohne etwas zu sehen? Lieber nicht. Blinde Sehende In Deutschland leben 155.000 Menschen, die nie etwas sehen können. Sie sind blind. Manche von Geburt an, manche haben als Kinder, manche als Erwachsene eine Krankheit bekommen, durch die sie nichts mehr sehen können. Trotzdem machen Blinde fast alles, was Sehende auch machen. Sie gehen zur Schule, sind selber Lehrer, sind Vater oder Mutter von Kindern, sind Sportler nur selber Auto fahren, das geht nicht. Gut gespitzte Ohren Ein blinder Mensch hat ein viel besser trainiertes Gehör als einer, der sehen kann. Klar, er kann sich ja viel besser auf Geräusche konzentrieren. Ein Blinder hört ganz genau, wie weit jemand weg ist, der mit ihm spricht. Sogar ob du ihn anschaust, während du sprichst, oder ob du beim Sprechen an ihm vorbeischaust, kann er hören. Fühlen und Riechen Auch auf Gerüche achten Blinde viel mehr, denn sie helfen, Dinge und Wege zu finden. Eine Bäckerei duftet ganz anders als ein Schuhladen. Und die Finger helfen auch, zu sehen: Beim Saft einschenken einfach oben am Rand einen Finger leicht ins Glas ragen lassen, schon ist klar, wann das Glas voll ist. Mal ausprobieren! Sogar lesen können Blinde mit den Händen: Mit der sogenannten Braille-Schrift, bei der von hinten kleine Punktmuster in das Papier gepresst werden. Man muss nur lernen, welches Muster für welchen Buchstaben steht und schon kann losgehen. BEHINDERUNGEN Niveau 2 – Blindheit Von Blindheit spricht man, wenn jemand nichts oder nur sehr wenig sehen kann. Zum Beispiel sieht man alles so verschwommen, dass Lesen oder Fernsehen nicht möglich ist. Man kann sich auch nicht orientieren und stößt oft irgendwo an. Viele blinde Menschen benutzen deshalb verschiedene Hilfsmittel. Die einen nehmen eine starke Lupe zum Lesen, andere einen weißen Stock, mit dem sie sich ihren Weg ertasten. Auch speziell ausgebildete Blindenhunde können blinden Menschen im Alltag helfen. Blindheit ist eine schwere Körperbehinderung und kann viele Ursachen haben. Oft ist sie schon von Geburt an da. Sie kann aber auch erst später im Leben entstehen. Häufig haben blinde Menschen schwere Krankheiten an den Augen, oder sie hatten einen Unfall, bei dem die Augen verletzt wurden. Manchmal fehlen auch Teile der Augen, die zum Sehen wichtig sind. Blindheit ist nicht heilbar, man muss ein Leben lang mit ihr zurechtkommen. Was sind die Folgen von Blindheit? Für Menschen, die nichts sehen können, ist vieles ganz anders im Leben. Die meisten Berufe beispielsweise kommen nicht für sie in Frage, weil das Sehen eine wichtige Voraussetzung ist. Also ist es schwierig, einen Beruf zu finden, mit dem man gerne sein Geld verdienen würde. Oft ist man auch auf die Hilfe von anderen angewiesen. Geschäfte, Restaurants, Busse oder Hotels sind häufig nur für Menschen gebaut, die gut sehen können. Blinde finden sich da nur schwer zurecht. Trotzdem können viele Blinde gut mit ihrer Behinderung umgehen. Sie können hören und Dinge ertasten. Ihr Gehör und ihr Tastsinn sind meist besonders gut trainiert, so dass sie damit mehr wahrnehmen als sehende Menschen. In ihrem täglichen Leben empfinden sie oft weniger Grenzen, als sich das sehende Menschen vorstellen können. BEHINDERUNGEN Niveau 1 – Gehörlos Terzian ist zwölf Jahre alt und geht in die sechste Klasse. Er spielt Fußball, chattet am Computer mit seinen Freunden und schaut gerne Filme. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Terzian und den meisten anderen Kindern in seinem Alter: Terzian ist gehörlos Terzian ist taub geboren worden, woran das liegt, das weiß man nicht. Auch seine beiden Geschwister und seine Eltern können nichts hören. Und weil Terzian nicht hören kann, kann er auch nichts sprechen, obwohl mit seiner Stimme eigentlich alles in Ordnung ist. Weil er aber nicht weiß, wie es klingt, wenn jemand spricht, kann er die Laute nicht nachmachen. Sprechen mit den Händen Stattdessen verständigt sich Terzian mit Gebärdensprache. Dabei formt man die Worte und Sätze mit den Händen. Auch die Mundbewegungen und der Gesichtsausdruck spielen dabei eine wichtige Rolle. Terzian besucht die einzige Realschule für Gehörlose, die es in Bayern gibt. Die Fächer sind dieselben wie auf anderen Schulen auch, außer Musik natürlich. Obwohl Terzian Musik schon wahrnehmen kann, nur hören kann er sie nicht. Wenn er eine CD einlegt und die Lautstärke ganz hoch dreht, dann kann er die Schwingungen spüren. Auf diese Art können Gehörlose sogar tanzen. Sport mit Hilfsmitteln In seiner Freizeit macht Terzian viel Sport: Er geht im Winter Snowboarden, macht Leichtathletik und spielt Fußball als Stürmer. In seinem Fußballverein sind auch Kinder, die hören können. Die können keine Gebärdensprache, genauso wenig wie der Trainer. Aber das macht nichts: Wichtige Spielzüge schreibt der Trainer für Terzian auf, die liest er dann durch und merkt sie sich. Während des Spiels kann er sich mit seinen Mitspielern durch Zeichensprache verständigen. Wenn er zum Beispiel zeigen will, dass er gerne den Ball zugespielt hätte, dann winkt er einfach. Die anderen Kinder haben auch schon ein paar Gebärden von Terzian gelernt. Spaß mit gehörlosen Freunden Außerhalb des Sportplatzes sind die meisten von Terzians Freunden gehörlos, weil es einfach viel leichter ist, sich untereinander zu verständigen, wenn alle die Gebärdensprache BEHINDERUNGEN können. Terzian hat viele Freunde aus ganz Deutschland. Es gibt viele Freizeitangebote für Gehörlose, bei denen sie sich kennenlernen können. Auch diesen Sommer wird Terzian wieder für ein paar Wochen mit anderen gehörlosen Kindern aus ganz Deutschland in ein Ferienlager fahren. Und dank Internet ist es ganz leicht, mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Terzian ist oft am Computer, schreibt Mails und chattet. Er könnte auch telefonieren: Die meisten Gehörlosen haben ein Bildtelefon, bei dem sie sich während der Unterhaltung sehen können. Terzian ist nicht traurig, weil er nichts hören kann. Weil er schon taub auf die Welt gekommen ist, hat er nicht das Gefühl, dass ihm etwas fehlt. Eigentlich wächst er genauso auf, wie andere Kinder auch, findet er. Nur dass es in seiner Welt eben ganz still ist. BEHINDERUNGEN Niveau 2 – Gehörlos Wie verständigen sich Gehörlose? 22,5 Millionen Menschen in Europa leiden an einer Hörbehinderung, etwa 2 Millionen sind gehörlos. Das sind etwa sechs Prozent der Bevölkerung. Statt mit den Ohren hören sie mit den Augen. Wenn Hände sprechen Gehörlose Menschen benutzen ihre Hände, den Oberkörper und ihren Gesichtsausdruck, um sich verständlich zu machen. Kein Geräusch dringt zu ihnen vor. Trotzdem können sie sprechen. Mit den Händen formen sie Worte und Sätze. Gebärdensprache heißt ihre Verständigungsart, und sie kann alles vermitteln, was man sonst laut sagt. Was ist Gebärdensprache? Gebärdensprache ist eine eigenständige, vollwertige Sprache. Dabei wird mit vollem Körpereinsatz gearbeitet. Hände, Arme, Oberkörper, Kopf und Gesicht werden eingesetzt. Am auffälligsten sind die Hände, aber mit dem Gesichtsausdruck, der Mimik, werden zusätzlich Gefühle vermittelt. So kann der Erzähler zum Beispiel deutlich machen, ob er etwas gerne oder mit Widerwillen gegessen hat. Die Handbewegung bleibt gleich, Augen, Mund und Stirn samt Augenbrauen zeigen den Unterschied. Gebärden, Sprache und Mimik bilden die Gebärdensprache. Das Fingeralphabet Manchmal fehlen Gehörlosen die passenden Worte beziehungsweise Gebärden. Hin und wieder kommt es vor, dass ein Erzähler die Gebärde für ein Fremdwort oder einen Fachbegriff nicht kennt. In solchen Fällen buchstabiert er es mit dem Fingeralphabet. Ein Symbol solltet ihr euch unbedingt merken: Gehörlose auf der ganzen Welt kombinieren die Buchstaben I, und zu ihrem Solidaritätsgruß. Warum ausgerechnet diese Buchstaben? Nun, damit fangen die Wörter in dem Satz Love You an. Gehörlos, aber nicht taubstumm Manche Hörende sagen, wenn sie von einem Gehörlosen sprechen: Der ist taubstumm. Diesen Begriff empfinden Nichthörende als Beleidigung, ihr solltet ihn also nicht gebrauchen, auch wenn er hin und wieder sogar von Ärzten BEHINDERUNGEN benutzt wird oder in der Zeitung steht. Besser ist, ihr sagt gehörlos, auch taub ist in Ordnung. Und im Übrigen sind viele Gehörlose gar nicht stumm, auch wenn ihre Laute für uns undeutlich sein mögen. Nicht hören, was man sagt Kleine Kinder brabbeln alles, was sie hören nach und entwickeln so allmählich die Fähigkeit, Silben und Wörter und schließlich Sätze zu sprechen. Bei gehörlosen Menschen geht das nicht. Sie hören nicht den Unterschied zwischen einem A und einem K und können ihre Aussprache deshalb auch nicht korrigieren. Um Laute richtig auszusprechen, mussten sie bisher lange mit einem Sprachlehrer üben. Der Umgang mit Gehörlosen Gehörlosigkeit ist keine Krankheit, sondern eine Behinderung, die das Leben und den Kontakt mit Hörenden erschwert. Für euch ist es viel leichter, auf Gehörlose zuzugehen, als umgekehrt. Aus dem Urlaub im Ausland wisst ihr ja, dass es relativ einfach ist, das Wichtigste mit Händen und Füßen zu erklären. Also traut euch einfach, auch wenn es am Anfang etwas schwer fällt BEHINDERUNGEN Gruppenaufteilung Keelyn Lorin Autismus Nora Gino Autismus Aurora Yannic Gehörlosigkeit Gabrielle Erigon Blindheit Fiona Neal Down Syndrom Emma Ruben Gehörlosigkeit Dhurate Linus Down Syndrom Leonie Elvin Blindheit Elina Edon Gehörlosigkeit Alessia Xeno Eva Sean Gila Down Syndrom Autismus BEHINDERUNGEN Niveau 2 BEHINDERUNGEN Ablauf 1. Lektion 10 Erklären der Voraussetzungen Gruppen bilden Texte verteilen 20 Texte für sich lesen und unklare Wörter auf der Seite aufschreiben Niveau 1 etwas leichter Niveau 2 etwas schwerer Unklare Wörter mit Hilfe des Ipads nachschlagen oder Fragen 10 In den vier Themengruppen besprechen 2. und 3. Lektion Vortrag und Plakat vorbereiten 4. Lektion Vorträge halten