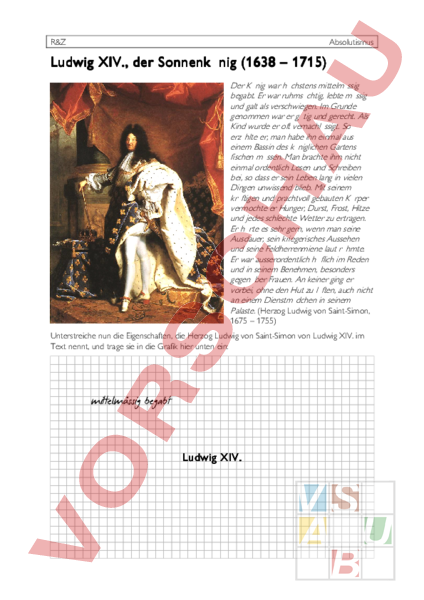Arbeitsblatt: Absolutismus Frankreich
Material-Details
Dossier
Geschichte
Neuzeit
7. Schuljahr
17 Seiten
Statistik
153528
1836
54
10.11.2015
Autor/in
Marisa Loher
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
R&Z Absolutismus Ludwig XIV., der Sonnenkönig (1638 – 1715) Der König war höchstens mittelmässig begabt. Er war ruhmsüchtig, lebte mässig und galt als verschwiegen. Im Grunde genommen war er gütig und gerecht. Als Kind wurde er oft vernachlässigt. So erzählte er, man habe ihn einmal aus einem Bassin des königlichen Gartens fischen müssen. Man brachte ihm nicht einmal ordentlich Lesen und Schreiben bei, so dass er sein Leben lang in vielen Dingen unwissend blieb. Mit seinem kräftigen und prachtvoll gebauten Körper vermochte er Hunger, Durst, Frost, Hitze und jedes schlechte Wetter zu ertragen. Er hörte es sehr gern, wenn man seine Ausdauer, sein kriegerisches Aussehen und seine Feldherrenmiene laut rühmte. Er war ausserordentlich höflich im Reden und in seinem Benehmen, besonders gegenüber Frauen. An keiner ging er vorbei, ohne den Hut zu lüften, auch nicht an einem Dienstmädchen in seinem Palaste. (Herzog Ludwig von Saint-Simon, 1675 – 1755) Unterstreiche nun die Eigenschaften, die Herzog Ludwig von Saint-Simon von Ludwig XIV. im Text nennt, und trage sie in die Grafik hier unten ein: mittelmässig begabt Ludwig XIV. R&Z Absolutismus Der König wird Alleinherrscher Schon im Mittelalter hatte Frankreich einen König. Seine Macht war aber gering. gering Wenn er in den Krieg zog, war er auf die Hilfe der Adeligen angewiesen. angewiesen Einnahmen bezog er nur von den Bauern, die auf seinem Privatland lebten. Seit dem 13. Jahrhundert aber versuchten die Könige von Frankreich, ihre Macht zu verstärken und die kriegslustigen adeligen Herren zu zähmen. zähmen Dazu waren sie auf Soldaten angewiesen. Sie begannen daher, ein stehendes Heer aufzubauen: ein Heer aus Söldnern, Söldnern das ihnen ständig zur Verfügung stand. Die Stärke des französischen Heeres: 1445 1461 1525 1664 1688 1703 9000 Mann 12000 Mann 20000 Mann 45000 Mann 290000 Mann 400000 Mann Um die Soldaten bezahlen zu können, reichten die Abgaben der Bauern, Bauern die auf dem Privatland des Königs lebten, nicht aus. Daher begann der König, von allen Bewohnern Frankreichs Steuern zu erheben. erheben Auch liehen ihm die reichen Kaufleute in den Städten Geld aus. Die Situation in Frankreich sah nun also so aus: König R&Z Absolutismus Frankreich wird zum absolutistischen Staat Unterstützung. .und Widerstand Wid erstand Die Städte unterstützten den König, König weil sie sich von einer starken Königsmacht Frieden und Ordnung erhofften. Auch für die Bauern war es wichtig, dass die ständigen Kriege im Land endlich aufhörten. aufhörten Seit der Reformation war auch die Katholische Kirche auf den König angewiesen. Auch in Frankreich hatten sich nämlich protestantische Gemeinden gebildet. Die katholische Kirche hoffte, der König würde die Ausbreitung des Protestantismus verhindern oder sogar die Protestanten (in Frankreich Hugenotten genannt) mit Gewalt zur katholischen Kirche zurückführen. Dagegen wehrten sich die Adeligen für ihre Rechte. Rechte Aus diesem Grund dauerte es etwa 400 Jahre, bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts, bis die Könige ihr Ziel erreicht hatten. Um den Zorn der Adeligen über ihre verlorenen Rechte zu besänftigen, liess ihnen der König viele Vorrechte. Vorrechte Sie behielten ihren Grundbesitz und bezogen weiterhin die Abgaben der Bauern, die darauf lebten. Sie mussten keine Steuern bezahlen. bezahlen Sie allein durften in der Armee Offiziere werden. Viele Adelige zogen an den Hof des Königs Königs, nigs liessen es sich dort wohl sein und hofften auf ein königliches Geschenk oder ein königliches Amt. Das Recht, über die Franzosen zu regieren, war nun nicht mehr auf viele Herren verteilt, sondern vereinigt im Staat. Staat So war also der französische Staat entstanden. Alle staatliche Gewalt lag aber beim König. Daher soll er gesagt haben: LEtat, LEtat, cest moi. moi. Der König selbst aber liess sich von niemandem etwas vorschreiben. Seine Macht war unbeschränkt, absolut. Deshalb nennen wir diese Staatsordnung absolute Königsherrschaft. Oder absolute Monarchie. Der Theologe Jacques Bossuet (1627 – 1704) über die beste Staatsform und die Macht des Königs: Staaten bilden heisst: sich vereinigen. Man ist aber nirgends besser geeinigt aus unter einem einzigen Oberhaupt . Die königliche Gewalt ist erstens heilig, zweitens väterlich, drittens unumschränkt. Die Fürsten handeln als Diener Gottes und als dessen Stellvertreter auf Erden. Durch sie übt er seine Herrschaft aus . Die königliche Gewalt ist unumschränkt. Der Fürst braucht niemandem Rechenschaft abzulegen über das, was er verfügt. Ohne diese unumschränkte Gewalt kann er das Gute nicht fördern und das Böse nicht unterdrücken . Nur Gott kann über die Entscheidungen der Herrscher und ihre Person richten. Die Untertanen sind dem Fürsten unbedingten Gehorsam schuldig. Es gibt nur eine Ausnahme: Wenn der Fürst etwas gebietet, was gegen Gott ist . Es ist durchaus notwendig, mit der wahren (das heisst der katholischen) Kirche verbunden zu bleiben. Der Fürst muss seine Gewalt dazu anwenden, die falschen Religionen in seinem Staate zu vernichten. Das Vorbild des Königs von Frankreich machte auch auf die Herrscher der andern Länder Europas Eindruck. Sie eiferten ihm nach und strebten in ihrem Gebiet auch nach der absoluten absoluten Königsherrschaft. Königsherrschaft In Deutschland ging man soweit, dass an den meisten Höfen nur noch Französisch gesprochen wurde. Daher kann man das 17. und 18. Jahrhundert als Zeitalter des Ab Ab solutismus bezeichnen. Vom 13. bis zum 17. Jahrhundert konnten die Könige Könige von Frankreich ihre Macht über das Land verstärken. Schliesslich hatte der französische König die alleinige Herrschaft in seinen Händen. Frankreich war nun ein geordneter Staat unter Leitung des Königs. 3 R&Z Absolutismus Fragen: 1. Was versteht man unter einem stehenden stehen den Heer? Wie sollte dieses bezahlt werden? 2. Welche Aufgaben hatten die Beamten? 3. Welche der folgenden Bevölkerungsgruppen begrüssten eine Stärkung der Macht des Königs: katholische Kir Adelige Bauern Ki rche Bewohner der Städ Städ te Begründe! Be gründe! 4. Womit tröstete der König die Adeligen wegen ihrer verlorenen Rechte? Wohin zogen viele dieser Adeligen? 5. Was bedeutet der Ausspruch des französischen Königs LEtat, cest moi!? Was wollte er damit ausdrücken? 6. Was versteht man unter dem Begriff Zeit des Absolutismus? Welche Bedeutung hatte dabei der französische Königshof? 4 R&Z Absolutismus Schloss Sargans Sargans, ein kleines sanktgallisches Städtchen, liegt dort, wo sich heute die beiden Schnellzugslinien Zürich-Chur und Zürich-Buchs-Österreich trennen. Im Mittelalter lag es am wichtigen Handelsweg, der von Italien über die Bündnerpässe nach Zürich geführt hat. Das Städtchen liegt etwas erhöht am Fuss des Gonzen und hat sich damit vor Rheinüberschwemmungen gesichert. Noch kecker steht das Schloss Sargans auf einem Felssporn. Stolz blickt es herab auf die nahe Kleinstadt und auf die Weite des nahen Rheintals. Schon 1282 liest man vom Sarganserschloss erstmals in einer Urkunde. Im Jahre 1386 kämpfte sein Besitzer, Graf Johann I. (kurz «Graf Hans» genannt) auf der Seite Österreichs bei Sempach gegen die Eidgenossen. Er plante auch zwei Jahre darauf, sich bei Näfels am Kampfe gegen die Glarner zu beteiligen, erschien aber glücklicherweise mit seinen Leuten auf dem Kerenzerberge erst dann, als das Treffen bereits entschieden war. Nach dem Alten Zürichkrieg wurde Sargans Untertanenland der Eidgenossen. Fortan (von 1459 bis 1798) verwalteten sie diesen Besitz als gemeinsame Herrschaft. 181 Vögte haben sich nacheinander im Sarganserschloss (jeweils nach zweijähriger Amtszeit) abgelöst. Die Reihenfolge ihres Auftretens ist heute noch am Wappenband abzulesen, das die Stadtseite des Herrenhauses schmückt: Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug und Glarus. 5 R&Z Absolutismus Schloss von Versailles Im Jahre 1648 erhob sich die Bevölkerung von Paris gegen den König. Der kaum zehnjährige Ludwig musste mit seiner Mutter bei Nacht und Nebel aus der Stadt fliehen. Erst nach langen Kämpfen konnte die königliche Familie wieder nach Paris zurückkehren. Ludwig vergass dieses Ereignis nie. Als er die Regierung übernahm, war die alleinige Herrschaft des Königs über das Land bereits unbestritten. Ludwig wollte aber, dass seine Macht auch nach aussen sichtbar werde. Dazu diente ihm der Bau des Schlosses und des Parks von Versailles, etwa 20 Kilometer von Paris entfernt. Hier befand sich bereits ein bescheidenes Schloss. Zuerst liess Ludwig dieses umbauen. Zwischen 1668 und 1710 erweiterte er es zu einer gewaltigen Schloss- und Parkanlage. Der Bau war schwierig und aufwendig. Während der über vierzigjährigen Bauzeit wurden ständig 20�00 bis 30�00 Arbeiter beschäftigt. Allein zwischen 1668 und 1690 wurden 70 Millionen Pfund für den Bau ausgegeben, in einzelnen Jahren über 10 Millionen Pfund (Zum Vergleich: Ein Tagelöhner verdiente pro Tag etwa 0,5 Pfund; etwa gleich viel kostete 1 kg Butter. Eine Kuh kostete etwa 50 Pfund). Beim Bau arbeiteten bis zu 36�00 Menschen mit 6�00 Pferden gleichzeitig. Sie leiteten Flüsse um und legten den Sumpf trocken. Sie pflanzten Sträucher und schnitten sie zu Pyramiden, Kegeln, Säulen und Kugeln. Sie bauten Wege und bedeckten sie mit farbigem Kies, stellten Statuen aus Marmor auf und gruben Teiche. Das Wasser für die Springbrunnen des Parks musste aus der Seine herbeigeführt werden, denn pro Stunde wurden 5�00 Kubikmeter Wasser verspritzt. Das dazu notwendige Pumpwerk umfasste 14 Wasserräder und 225 Pumpen. Murmelnd rauschte das Wasser über künstliche Stufen von Becken zu Becken oder perlte aus 1400 Springbrunnen in die Luft. Tausende von Blüten verströmten ihren Duft. Ludwig war von der Sucht beherrscht, sich die Natur zu unterwerfen! sagte ein Höfling. 6 R&Z Absolutismus Inmitten dieser Pracht erhob sich auf dem höchsten Punkte das prunkvolle, 580 Meter lange Schloss mit seinen 2000 Zimmern. Die besten Handwerker und Künstler schmückten es mit marmornen Treppen, vergoldeten Ranken, kostbaren Teppichen und Seidentapeten. Im 73 Meter langen Festsaal verdoppelten grosse Spiegel den Glanz von Hunderten von Kerzen. Ein festes Gitter grenzte das künstliche Paradies gegen aussen ab. Der italienische Reisende Sebastian Locatelli meinte zu diesem Schloss: Bauten sind das treue Abbild eines Fürsten. Darum muss er gross und prächtig bauen. Aber Versailles kostete auch Opfer. Madame de Sévigné, eine vornehme Französin schrieb: Jede Nach führt man Karrenladungen voll toter Arbeiter fort. Man hält diesen traurigen Zug geheim, um die andern nicht zu erschrecken. Schloss Sargans – Schloss von von Versailles Versuche, hier die Unterschiede zwischen den beiden Schlössern zusammenzutragen: Sargans Versailles 7 R&Z Absolutismus Das Leben am Hof von Versailles Die Unterhaltskosten für den Hof betrugen pro Jahr zwischen 6 und 10 Millionen Pfund, darin inbegriffen die zahlreichen Theateraufführungen, Feuerwerke, Festessen und Bälle. Von 1682 an wohnte der König ausschliesslich in Versailles, nachdem er früher abwechslungsweise in Paris und in den kleineren Schlössern gelebt hatte. Ständig herrschte ein Kommen und Gehen. Trotz seiner Grösse war das Schloss für eine solche Zahl von Menschen zu klein; viele mussten trotz ihrer Vornehmheit in einer kleinen, kaum heizbaren Dachkammer wohnen. Dennoch drängte alles nach Versailles in der Hoffnung, beim König sein Glück zu machen. Der Tagesablauf von Ludwig XVI. Nacht 7.00 7.15 7.30 8.15 8.30 9.00 10.00 10.30 13.00 15.00 17.00 19.00 22.00 23.00 Der König schläft in seinem Zimmer allein, abgesehen von einem Kammerdiener, der auf einem Feldbett ruht. Nebenan wacht die königliche Garde. Der Kammerdiener steht auf. Die Lichter werden angezündet, die Vorhänge aufgezogen. Der Kammerdiener steht vor den Bettvorhang: Sire, voilà lheure! – Der 1. Arzt und der 1. Chirurg kommen, schlüpfen durch den Bettvorhang und untersuchen den König. Der 1. Edelmann der Königskammer öffnet die Vorhänge des Bettes. Nun treten Familienmitglieder, der Grosskammerherr, der Grossmeister, der Kleidungsmeister, der 2., 3. und 4. Edelmann der Königskammer sowie der 2., 3. und 4. Kammerdiener ein. Der 1. Kammerdiener gibt dem König etwas Weingeist auf die Hände. Der Grosskammerherr bringt den Weihwasserkessel; der König bekreuzigt sich. Während nun alle im Nebenzimmer verschwinden, betet der König für sich. Nach dem Gebet kommen alle zurück. Der Barbier und der Perückendiener erscheinen; der König wählt eine Perücke aus. Der König steht auf, lässt sich Pantoffeln und Zimmermantel anziehen und setzt sich in einen Lehnstuhl am Kamin. Nun erscheinen die vier Sekretäre, der Schmuckverwalter, die Kleiderdiener und weitere Hofleute. Der König setzt sich nun auf den in einen Stuhl eingebauten Nachttopf und schreibt, während er sein Geschäft verrichtet, auf einem davor stehenden Tischchen die ersten Anweisungen. Anschliessend setzt er sich wieder in den Lehnstuhl. Der Barbier kämmt ihn und setzt ihm die Perücke auf. Nun folgt eine grosse Zahl weiterer Höflinge. Jeder Name eines Eintretenden wird aufgerufen und dem König mitgeteilt. Der König erhält als Frühstück zwei Tassen Suppe. Er lässt sich Strümpfe und Hosen anziehen. An jedem zweiten Tag wird er rasiert. Er zieht selbst seinen Zimmermantel und sein Nachthemd aus und streift die Reliquien ab (kleine Überreste von Heiligen, wurden meist an Halskettchen getragen), die er während der Nacht getragen hatte. Der Königsbruder, sein Sonn oder der Grossmeister reicht ihm das Taghemd. Er wählt nun Halsbinde und Taschentücher aus. Darauf zieht er die Hosen hoch, lässt sich eine Weste anziehen, gürtet seinen Degen und schlüpft in einen Rock. Der Uhrmacher hängt ihm die Uhr an. Anschliessend betet der König vor den Anwesenden auf einem Gebetsteppich. Er tritt in sein Arbeitszimmer und erteilt erste Anweisungen. Der König und zahlreiche Höflinge gehen in die Schlosskapelle zur Messe. Der König arbeitet mit seinen Ministern im Arbeitszimmer. Er empfängt dabei wichtige Persönlichkeiten. Der König begibt sich wieder auf sein Zimmer und nimmt dort allein das Mittagessen ein. Dieses umfasst mehrere Gänge: Suppe, Wild, Salat, Schinken, Lammfleisch, Gebäck, Früchte, Eier. Jeder Gang erfordert ein genau festgelegtes Zeremoniell. Zum Präsentieren des Fleisches sind beispielsweise 15 Personen erforderlich, darunter 4 Gardisten und 5 Hofbeamte. Zum Trinken werden dem König zwei Karaffen mit Wein und Wasser serviert, die er selber in einer Silbertasse mischt. Er benützt zum Essen ein Messer, einen Löffel und seine Finger. Der König wechselt nun seine Kleider und begibt sich zum Spaziergang oder – mindestens einmal pro Woche – zur Jagd. Beim Spaziergang lässt er sich meistens, umgeben von Hofleuten, auf einem Wagen durch den Park fahren. Der König kehrt ins Schloss zurück und zieht sich um. Er arbeitet im Arbeitszimmer. Dreimal in der Woche finden Veranstaltungen statt: Theater, Konzert, Tanz, Spiele (etwa Billard), wozu auch gegessen wird. An den andern Tagen isst der König zusammen mit der Familie und einigen Hofleuten. Das Zubettgehen des Königs vollzieht sich ähnlich wie das Aufstehen, nur in umgekehrter Reihenfolge. Der König liegt im Bett. 8 R&Z Absolutismus Verschwendungssucht in Versailles Wenn der König hin und wieder zu einer Bootsfahrt auf seinem 1600 Meter langen Teich einlud, glitten die Boote langsam dahin, und Tausende von Lichtern spiegelten sich im dunklen Wasser. Es schien, als sei der Himmel rund um Ludwig auf die Erde herabgestiegen. Der König wünschte, dass alle hohen Adeligen sich in seinem Schloss einfänden, so dass mehrere tausend Menschen in Versailles lebten. Ein Höfling schrieb: Ludwig hielt alle dazu an, ihm zu gefallen. Er beobachtete jeden einzelnen. Er merkte sehr genau, wenn jemand vorübergehend abwesend war. Wer aber nie oder nur selten kam, fiel in Ungnade. Wenn man für einen solchen Menschen um etwas bat, lautete die hochmütige Antwort: „Ich kenne ihn nicht! Der Spiegelsaal in Versailles Dieses Leben aber hatte für die Adeligen schwerwiegende Folgen: In allem liebte Ludwig Glanz und Verschwendung. Er schätzte es, wenn jeder am Hofe ihm darin nacheiferte. Wer alles draufgehen liess für Küche, Kleidung, Wagen, Haushalt und Spiel, dem war er wohl gesinnt. Luxus war Ehrensache. Damit richtete der König nacheinander alle Adeligen zugrunde. Aber Ludwig liess sie nicht im Stich. Er gab ihnen reiche Geldgeschenke und gut besoldete Ehrenämter. So durfte der Herzog von Condé, ein gefürchteter Feldherr aus dem Dreissigjährigen Krieg, dem König beim Essen Messer und Gabel reichen. Eines darf allerdings nicht vergessen werden: König Ludwig hat zwar rauschende Feste gefeiert, aber er hat auch fleissiger als andere Herrscher seiner Zeit an der Regierung seines Landes gearbeitet. Jeden Tag liess er sich mehrere Stunden von seinen Ministern beraten, aber er fällte alle Entscheide selbst. Ein Heer von Beamten führte seine Befehle aus. So wurde Frankreich von einem Punkte, vom Arbeitszimmer des Königs aus regiert. Niemals gab es so schöne Wasserspiele und so schönes Feuerwerk. Es kostet dies den König mehr als 500�00 Pfund. Die Damen und Herren von Stande haben von sich aus übermässige Ausgaben gemacht; es gab einzelne, die für 15�00 Pfund französische Spitzen trugen; ein einziger Händler hat solche für 80�00 Pfund verkauft. Für mich, meine Frau und meine Tochter hat es beinahe 4�00 Pfund gekostet, und nach meiner Ansicht 9 R&Z Absolutismus habe ich nie eine Ausgabe gemacht, die unangebrachter gewesen wäre; ich tröste mich, weil man mit den Narren närrisch sein muss. Marquis de Saint-Maurice, Lettres sur la Cour de Louis XIV, 1668 Für den Hof in Versailles konnte es nie genug Unterhaltung geben. Der König liebte das gesprochene Theater, die Oper und das Ballett. Ständig waren Schauspielertruppen in Versailles zu Gast. Unter ihnen war jene von Jean-Baptiste Molière die bedeutendste. Molière war zugleich Autor, Regisseur und Schauspieler. In seinen Komödien konnte er sowohl glänzend unterhalten wie auch auf menschliche Schwächen hinweisen. Der König konnte, auch wenn er selbst davon betroffen war, darüber lachen, nur durfte der Verfasser nicht zu weit gehen. Die Bürger von Paris ahmten den Hof nach und förderten das Theater ebenfalls. So wurde die Zeit Ludwigs XIV. zur Blütezeit der französischen Kultur. Jedoch hatte nur ein kleiner Teil der französischen Bevölkerung an diesem kulturellen Leben Anteil. Dennoch spielte gerade die unterste Bevölkerungsschicht eine tragende Rolle: Die Pracht und die Verschwendung am Hofe wurde aus den Steuern und Abgaben der Bauern und Handwerker bezahlt: Le roi du soleil 1 3 2 Die 3 Säulen Säule der Macht: 1_ 2_ 3_ B D 10 R&Z Absolutismus Heiratspolitik in Versailles Maria von Heinrich IV Mit zweiundzwanzig Jahren hatte Ludwig die Medici 1553 1610 1573 1642 Tochter des spanischen Königs, Maria Theresia, geheiratet. Er hatte sie zuvor nie gesehen. Die Heirat war von ihren und seinen Eltern und Ministern veranlasst worden, und zwar aus rein politischen Gründen: Frankreich Anna von Ludwig XIII. erhoffte, die spanische Königsfamilie würde Österreich 1601 1643 1602 1666 bald einmal aussterben, sodass Ludwig als Gatte einer spanischen Prinzessin Spanien erben könnte. Der spanische König versprach sich von dieser Ehe Philipp von von der Ludwig XIV. gute Beziehungen zu Liselotte Orléans Pfalz 1638 1715 1640 1701 1652 1722 Frankreich, mit dem er bis dahin meistens Krieg geführt hatte. Weil Staaten damals wie Privatgüter unter den Königs- und Fürstenfamilien vererbt wurden, war die von Orléans Heirat eines Königs oder Prinzen von so PhilippRegent Ludwig Dauphin 1661 1711 1674 1723 grosser politischer Bedeutung, dass die Frage nach der gegenseitigen Liebe des Königspaares gar nicht gestellt wurde. Ein harmonisches Familienleben gab es daher nicht, auch wenn nach aussen der Anschein erweckt wurde. Nachdem Maria Theresia einem Prinzen das Leben geschenkt Ludwig von und damit ihre Pflicht erfüllt hatte, vernachlässigte der König sie Burgund 1682 1712 völlig und hielt sich eine Anzahl von Freundinnen, so genannten Mätressen, von denen er zahlreiche Kinder bekam. Diese waren zwar nicht erbberechtigt, erhielten aber von ihrem Vater riesige Güter zum Geschenk. Hier ein Zitat von Ludwig XIV. zum Thema Liebe Mätressen und die Arbeit: Marie -Therese von Spanien 1638 1683 Marie-Christine von Bayern 1660 1690 Marie-Adelaïde von Savoyen 1685 1712 Ludwig XV 1710-1774 Die Zeit, die wir unseren Liebesaffären widmen, darf nicht zum Nachteil unserer Arbeit vergeudet werden, denn wir müssen stets unsern Ruhm und unsere Macht als erstes im Auge behalten, die sich nur durch angestrengteste Arbeit aufrechterhalten lassen. So gross auch unsere Leidenschaft sein mag, so dürfen wir doch niemals im Interesse unserer eigenen Liebe ausser Acht lassen, dass wir durch die Verminderung des öffentlichen Ansehens auch die Achtung derjenigen verlieren, für die wir unsere Geschäfte vernachlässigt haben. Die andere Vorsichtsmassregel ist weit schwieriger. Wenn wir auch unser Herz verschenken, so müssen wir doch immer Herr unseres Verstandes bleiben und die Herzensangelegenheiten des Liebhabers von den Entschlüssen des Souveräns zu trennen wissen! Die schöne Frau, die unser Herz erfreut, darf niemals mit uns über Staatsgeschäfte reden, ebenso wenig wie die uns Dienenden. Liebe und Staatsgeschäfte müssen zwei völlig getrennte Dinge sein. Ludwig XIV. 11 R&Z Absolutismus Fragen zu: Verschwendungssucht und Heiratspolitik in Versailles 1. Ludwig XIV. wusste sich in Szene zu setzen. Nenne ein Beispiel dafür: 2. Ludwig wollte alle Adeligen am Hof haben. Dies hatte aber auch negative Folgen für die Adeligen. Welche? 3. Wie half der König solchen Adligen? Was denkst du über seine Art von Hilfe? 4. Was für Unterhaltungen gab es am Hof von Versailles? Nenne 3 Beispiele: 5. Womit wurden die schillernden Feste und das luxuriöse Leben in Versailles bezahlt? 6. Nach welchem Muster heirateten die königlichen Familien wie die von Ludwigs XIV.? 7. Was dachte Ludwig XIV. über die Liebe und die Arbeit? 12 R&Z Absolutismus Wirtschaftsform unter Ludwig XIV. Im Gegensatz zu früheren Königen verbrauchte Ludwig XIV. Unsummen für sein Hofleben. Die Bevölkerung konnte jedoch nur höhere Steuern zahlen, wenn sie auch mehr verdiente. Wie liess sich das bewerkstelligen? Hier wusste der sparsame und fleissige Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) Rat. Er war der Sohn eines Tuchhändlers, trat als kleiner Schreiber in den Dienst des Königs und brachte es bis zum Minister. Er schlug Ludwig folgenden Weg vor: Die Holländer führen bei uns Produkte ihrer Handwerker ein und tauschen dafür Dinge, die sie benötigen. Wenn man bei uns Werkstätten einrichten würde, könnten wir selbst herstellen, was wir brauchen, und die Überschüsse ins Ausland verkaufen. Dadurch kommt Geld in unser Land. Wir sollten möglichst alles selbst erzeugen und auf Waren aus dem Ausland verzichten. Je mehr Geld unser Land besitzt, umso grösser und mächtiger ist es. Um dieses Ziel zu erreichen, erliess Ludwig eine Anzahl Gesetze. Diese wirkten sich folgendermassen auf die Tätigkeit eines Kaufmanns aus: Wenn er mit einem Wagen voller ausländischer Fertigwaren an der französischen Grenze erschien, war der Schlagbaum geschlossen. Der Händler durfte erst weiterfahren, nachdem er hohe Zölle bezahlt hatte. Verliess er jedoch mit einem Wagen voll französischer Fertigwaren das Land, fand er die Grenze offen, und niemand verlangte was von ihm. Hatte er jedoch Rohstoffe wie Eisen, unverarbeitete Wolle, Hanf oder Leinen geladen, so schloss der Zöllner den Schlagbaum. Es war verboten, solche Produkte auszuführen. Dasselbe geschah, wenn der Kaufmann Getreide ins Ausland verfrachten wollte. Colbert verlangte nämlich, dass alle Bauern ihre Ernteüberschüsse in Frankreich verkauften. Weil mehr als genug Nahrungsmittel vorhanden waren, sanken die Preise. Die Arbeiter kamen deshalb billig zu Brot. Wollte der Kaufmann ein Handelsschiff bauen lassen, so trug der Staat einen Teil der Kosten. Solche Zahlungen werden Subventionen genannt (von subvenire (lat.) zu Hilfe kommen). Nach Colberts Tod fuhren bereits 400 französische Handelsschiffe auf den Meeren. In Amerika, Afrika und Indien nahm Frankreich ausgedehnte Kolonien in Besitz. Mit seinem neuen Schiff voll französischer Fertigwaren segelte der Kaufmann dorthin und tauschte sie gegen Zucker, Tabak, Kaffee, Tee, Gewürze, Kakao, Pelze, Tierhäute, Gummi und Edelhölzer. Diese Produkte waren in Europa sehr gesucht und trugen hohe Gewinne ein. Der Händler musste die Waren in einem französischen Hafen ausladen, zahlte jedoch keinen Einfuhrzoll. Diese neue, unter Ludwig XIV. 5 entstandene Wirtschaftsform nennt man Mer Me rkantilismus (mercari (lat.) Handel treiben). 1 2 3 4 5 6 13 R&Z Absolutismus Die drei Stände Der erste Stand: Der Klerus ( die katholische Geistlichkeit) Geistlichkeit) Den ersten Stand bildeten die Geistlichen. Der katholische Glaube galt in Frankreich als Staatsreligion. Die Geistlichen mussten keine Steuern bezahlen. Die Kirche besass einen grossen Teil des französischen Bodens und konnte von den Bauern dafür den Zehnten, d.h. den zehnten Teil der Ernte, einfordern. Nicht alle Geistlichen profitierten von diesen Vorteilen. Man unterscheidet zwischen dem hohen und dem niederen Klerus. Der hohe Klerus, Kardinäle, Bischöfe und Äbte stammten aus Adelsgeschlechtern. Viele von ihnen führten ein luxuriöses Leben auf ihren Schlössern oder am königlichen Hof, ohne ihren geistlichen Aufgaben nachzugehen. Dem niederen Klerus gehörten die Pfarrer und die Mönche an. Landpfarrer lebten meist bescheiden auf ihrem Pfarrhof. Während ein Pfarrer im Jahr etwa 700 Pfund Einkommen bezog, waren es bei einem Bischof bis zu 400�00 Pfund. Viele Landpfarrer standen in der Revolution auf der Seite des dritten Standes und klagten Geistlichkeit und Adel wegen ihres verschwenderischen Lebens an. Der zweite Stand: Der Adel Der Adel bildete den zweiten Stand. Er besass die gleichen Vorrechte wie die Geistlichen und besetzte die obersten Stellen in der Verwaltung, im Heer und in den Gerichten. Doch nur ein kleiner Teil war wirklich tätig: Im Heer fanden nur wenige einen Posten. Die hohen Adligen besassen zwar viel Land, aber sie lebten am Hof zu Versailles. Hier verschwendeten sie die Gelder ihrer Untertanen. Die niedrigen Adligen hingegen lebten auf ihren Gütern, wo sie von den Bauern Abgaben und Arbeitsleistungen erhielten. Der dritte Stand Der dritte Stand setzte sich aus unterschiedlichen Gruppen zusammen: Unternehmern, Gelehrten, Handwerksmeistern, Beamten und Militärpersonen vor allem in den Städten, Bauern, Fischern, Seeleuten, Landarbeitern, Tagelöhnern, Knechten und Mägden vor allem auf dem Land. Etwa 85% der Gesamtbevölkerung oder 20 Millionen Einwohner waren Leibeigene, Landarbeiter, Knechte oder Bauern. Die Bauern waren meist Pächter, Den Grundherren mussten die Bauern hohe Zinsen bezahlen und Frondienste leisten. In massloser Weise beutete der Staat das Landvolk aus: Neben der Grund- und Kopfsteuer, die durchschnittlich die Hälfte der bäuerlichen Erträgnisse ausmachten, verlangte er Fronarbeiten zum Bau von Strassen und Kanälen. Durch indirekte Steuern verschaffte sich der Staat noch weitere Einnahmen. So wurden Gebrauchsgüter wie Salz und Wein hoch besteuert. Den meisten Bauern blieb nur ein geringer Teil ihrer Einkünfte. Sie waren kaum imstande, das nötige Saatgut oder handliche Werkzeuge zu kaufen. Die Jagd war nur den beiden ersten Ständen erlaubt. Durch sie mussten die Bauern Verwüstungen an ihren Feldern in Kauf nehmen, da diese reich an Rebhühnern, Rehen und wilden Kaninchen waren. Wenn eine Ernte schlecht ausfiel, kam zur Armut auch noch Hungersnot. Der Marquis von Mirabeau berichtet: Ich habe einen steuereintreibenden Gerichtsdiener einer armen Frau die Hand abhacken sehen, weil sie ihren Kochtopf festhielt, das letzte Haushaltsgerät, das sie vor der Beschlagnahme bewahren wollte. 14 R&Z Absolutismus Wie setzte sich das französische Volk zusammen? In Frankreich unterscheidet man schon seit dem Mittelalter drei Stände: die Geistlichkeit (die Betenden), den Adel (die Kämpfenden) und den dritten Stand (die Arbeitenden). Zum dritten Stand gehörten damals gut 15 Millionen Landleute, dazu eine knappe Million Arbeiter, die in den Städten wohnten und ausschliesslich von ihrem Lohn lebten, sodann etwa 3 Millionen Angehörige der Mittelklasse: kleine Ladenbesitzer, Handwerksmeister, Leiter kleiner Betriebe. Adel und Geistlichkeit zählten zusammen rund eine Million Menschen. Die Oberschicht umfasste rund 100�00 Familien, denen ein Drittel des gesamten Grundbesitzes gehörte, ein weiteres Drittel gehörte der Kirche und dem König, der Rest war Eigentum von freien Bauern. 1. Trage die Bevölkerungsverteilung in Frankreich im Kreisdiagramm 1 ein: 1. Stand: Die Geistlichkeit Mio. 2. Stand: Der Adel 3. Stand: Die Landleute Mio. % Die Arbeiter Mio. % Die Mittelklasse Mio. % Gesamtbevölkerung: Mio. % 1 blau rot orange braun 2 Adel und Geistlichkeit Mittelklasse Arbeiter Landleute blau gelb rot Adel König und Geistlichkeit 3. Stand 2. Trage nun die Landverteilung in Frankreich im Kreisdiagramm 2 ein: Adel König und Geistlichkeit 3. Stand 15 R&Z Absolutismus Die Lage des Volkes Wie bereits erwähnt, lebten viele der Adeligen in Versailles am Hof von Ludwig XIV. und genossen das fürstliche Leben. Ausserdem mussten sie und auch die Geistlichen keine Steuern bezahlen. bezahlen Aber wie erging es den Bauern und den anderen einfachen Leuten, die anfangs für den König eingestanden waren? Diese Leute hatten sich viel von einem geeinigten Reich erhofft. Die Bauern machten damals über 80% der Gesamtbevölkerung der 20 Millionen Franzosen aus. Hier sind die Schilderungen der Schicksale von zwei Zeitgenossen: Man kann da und dort auf dem Lande scheue Lebewesen erblicken, dunkel, traurig und sonnenverbrannt. Sie gleichen der Erde, die sie unermüdlich durchwühlen und umgraben. Wenn sie sich auf ihren Beinen aufrichten, so zeigen sie uns ein menschliches Gesicht, und tatsächlich, es sind Menschen. Nachts ziehen sie sich in ihre Schlupfwinkel zurück, wo sie von schwarzem Brot, Wasser und Wurzeln leben. Fast ein Zehntel der Bevölkerung Frankreichs ist genötigt zu betteln. Weitere fünf Zehntel können sich mit knapper Not vor diesem Elend bewahren. Drei Zehntel sind schwer von Schulden bedrängt. Das Volk trägt alle Lasten. Gerade die einfachen Leute erhalten mit ihrer Arbeit und ihren Abgaben den König und sein ganzes Reich. Sie stellen Soldaten, Arbeiter, Weingärtner und Taglöhner. Die Einkommenssteuer ist eine Ursache des Übels. Sie wird mit äusserster Härte eingezogen. Kann einer nicht zahlen, so verkauft man nicht nur seine Hauseinrichtung, sondern hängt ihm die Türen aus und montiert die Dachbalken ab. Deshalb lebt mancher mit seiner Familie in grösster Armut und geht fast nackt umher. Er lässt aber auch sein bisschen Land verwahrlosen. Denn er hat Angst, dass seine Steuern verdoppelt würden, wenn er es gut düngte und eine reiche Ernte einbrächte. Noch mehr Geld als für das Hofleben verschleuderte der König in dauernden Kriegen gegen die Nachbarländer, um ihnen Gebiete zu rauben. Trotz der Opfer der französischen Männer und Frauen sank das Land immer tiefer in Schulden. Um sie zu bezahlen, erhob der König immer höhere Steuern. Damit stieg aber auch die Verbitterung der geplagten Bauern. Sie gaben ihr in folgenden Worten Ausdruck: Unser Vater, der du in Versailles bist, dein Name wird nicht mehr verherrlicht, dein Wille geschieht nicht mehr auf der Erde. Gib uns das fehlende Brot und erlöse und von den Steuereinnehmern. Bauernmahlzeit. Gemälde von Louis Le Nain, 1642 (Louvre, Paris; Foto Giraudon, Paris) Mein Leben habe ich keine so traurige Zeit gesehen als jetzt. Die Leute aus dem Volke sterben wie Mücken vor Kälte und Armut Die Mühlen sind stillgelegt, und viele Leute sind Hungers gestorben deswegen. Gestern erzählte man mir eine erbärmliche Geschichte von einer armen Frau, die ein Brot in einem Bäckerladen stahl. Der Bäcker lief dem Weib nach; es fing an zu weinen und sagte: „Wenn man mein Elend wüsste, man nähme mir das Brot nicht. Ich habe drei kleine Kinder, ganz nackt, ohne Feuer noch Brot. 16 R&Z Absolutismus Der Kommissar, vor den man sie geführt hatte, sagte: „Seht zu, was Ihr sagt, denn ich gehe mit Euch in Euer Haus, und ging auch mit. Wie er in die Kammer trat, sah er drei kleine nachte Kinder, in Lumpen gewickelt, in einer Ecke sitzen; die zitterten vor Kälte, als ob sie Fieber hätten. Er fragte das älteste: „Wo ist euer Vater? – „Hinter der Tür, sagte das Kind. Der Kommissar wollte sehen, was der Vater hinter der Türe mache; er hatte sich aus Verzweiflung hinter der Türe erhängt. Der Kommissar erschrak, dass er schier erstarrte. Dergleichen Sachen hört man täglich. Liselotte von der Pfalz, am 2. März des Hungerjahres 1709 Ludwig selbst muss kurz vor dem Tode seine Fehler erkannt haben. Er riet auf dem Sterbebett seinem fünfjährigen Nachfolger: Mein Kind, du kannst ein grosser König werden. Aber ahme meine Vorliebe für die Baukunst und den Krieg nicht nach. Ludwig XIV starb am 1. September 1715. Als seine Leiche in einem vergoldeten Prunkwagen durch die Stadt Paris geführt wurde, jubelte, sang und tanzte das Volk in den Strassen – keine Tränen flossen über den Tod des vormals als Vertreter Gottes auf Erden angesehenen König. Das für einen König einfache Begräbnis glich mehr einer Freuden- als einer Trauerfeier, als die Leute dem Zug hinterhergingen. Die Herrschaft wandelte sich aber nicht sehr viel, auch unter dem neuen König litt der 3. Stand immer noch, wie uns die Erzählung von Jean-Jaques Rousseau vor Augen führt: Nach mehrstündigem vergeblichem Umherwandern trat ich müde und sterbend vor Hunger und Durst bei einem Bauern ein, dessen Haus kein schönes Äusseres hatte; es war jedoch das einzige, das ich in der Nähe gewahrte. Ich wähnte, es müsste hier wie in Genf oder in der Schweiz sein, wo alle wohlhabenden Bewohner imstande sind, Gastlichkeit zu üben. Ich bat den Besitzer des Hauses, mir für Geld zu essen zu geben. Er setzte mir abgerahmte Milch und grobes Gerstenbrot vor, wobei er versicherte, das sei alles, was er habe. Ich trank diese Milch mit Gier und ass dieses Brot aus Kleie und was sonst noch darin war. Aber für einen von Müdigkeit erschöpften Menschen war dies nicht allzu stärkend. Der Bauer, welcher mich prüfend ansah, schloss aus meinem Appetit auf die Wahrheit meiner Angaben. Mit der Bemerkung, er sehe wohl, dass ich ein guter, ehrlicher junger Mann sei, der nicht die Absicht habe, ihn zu verraten, öffnete er mit einem Male eine Falltür neben der Küche, stieg hinab und kam einen Augenblick später mit einem guten Schwarzbrot von reinem Roggen, einem sehr appetitlichen, wenn auch schon angeschnittenen Schinken und einer Flasche Wein zurück, deren Anblick mein Herz mehr erfreute als alles übrige. Dazu fügte er einen ziemlich dicken Eierkuchen, und ich speiste zu Mittag, wie nur ein Fussgänger speisen kann. Als es ans Bezahlen ging, kam seine Unruhe und Angst wieder zum Vorschein; er wollte mein Geld nicht, er weis es mit eigentümlicher Verlegenheit zurück, und das Sonderbarste dabei war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, weswegen er sich fürchtete. Endlich sprach er schaudernd die schrecklichen Worte Schreiber und Kellerratten aus. Er liess durchblicken, dass er seinen Wein wegen der Beamten, sein Brot wegen der Besteuerung verstecke und ein verlorener Mann wäre, wenn man Verdacht hegte, dass er dem Hungertode noch nicht nahe sei. Alles was er mir hierüber sagte und wovon ich nicht die leiseste Ahnung hatte, machte einen unauslöschlichen Eindruck auf mich. Die Bauern begannen also, sich im Geheimen den Gesetzen des Königs zu wiedersetzen. Dieser Widerstand wuchs und breitete sich immer weiter aus, bis er dann schliesslich zur Revolution wurde. 17