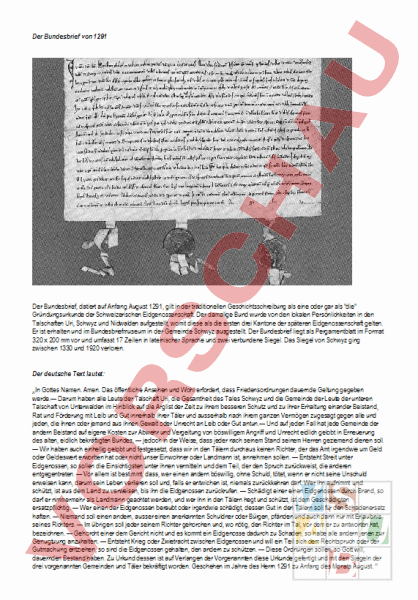Arbeitsblatt: Bundesbrief 1291
Material-Details
Lesetext zum Bundesbrief von 1291. Aus Wikipedia übernommen und vereinfacht.
Geschichte
Schweizer Geschichte
6. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
15415
3260
76
06.02.2008
Autor/in
md (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Der Bundesbrief von 1291 Der Bundesbrief, datiert auf Anfang August 1291, gilt in der traditionellen Geschichtsschreibung als eine oder gar als die Gründungsurkunde der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Der damalige Bund wurde von den lokalen Persönlichkeiten in den Talschaften Uri, Schwyz und Nidwalden aufgestellt, womit diese als die ersten drei Kantone der späteren Eidgenossenschaft gelten. Er ist erhalten und im Bundesbriefmuseum in der Gemeinde Schwyz ausgestellt. Der Bundesbrief liegt als Pergamentblatt im Format 320 200 mm vor und umfasst 17 Zeilen in lateinischer Sprache und zwei verbundene Siegel. Das Siegel von Schwyz ging zwischen 1330 und 1920 verloren. Der deutsche Text lautet: „In Gottes Namen. Amen. Das öffentliche Ansehen und Wohl erfordert, dass Friedensordnungen dauernde Geltung gegeben werde.— Darum haben alle Leute der Talschaft Uri, die Gesamtheit des Tales Schwyz und die Gemeinde der Leute der unteren Talschaft von Unterwalden im Hinblick auf die Arglist der Zeit zu ihrem besseren Schutz und zu ihrer Erhaltung einander Beistand, Rat und Förderung mit Leib und Gut innerhalb ihrer Täler und ausserhalb nach ihrem ganzen Vermögen zugesagt gegen alle und jeden, die ihnen oder jemand aus ihnen Gewalt oder Unrecht an Leib oder Gut antun.— Und auf jeden Fall hat jede Gemeinde der andern Beistand auf eigene Kosten zur Abwehr und Vergeltung von böswilligem Angriff und Unrecht eidlich gelobt in Erneuerung des alten, eidlich bekräftigten Bundes, — jedoch in der Weise, dass jeder nach seinem Stand seinem Herren geziemend dienen soll. — Wir haben auch einhellig gelobt und festgesetzt, dass wir in den Tälern durchaus keinen Richter, der das Amt irgendwie um Geld oder Geldeswert erworben hat oder nicht unser Einwohner oder Landmann ist, annehmen sollen. — Entsteht Streit unter Eidgenossen, so sollen die Einsichtigsten unter ihnen vermitteln und dem Teil, der den Spruch zurückweist, die anderen entgegentreten. — Vor allem ist bestimmt, dass, wer einen andern böswillig, ohne Schuld, tötet, wenn er nicht seine Unschuld erweisen kann, darum sein Leben verlieren soll und, falls er entwichen ist, niemals zurückkehren darf. Wer ihn aufnimmt und schützt, ist aus dem Land zu verweisen, bis ihn die Eidgenossen zurückrufen. — Schädigt einer einen Eidgenossen durch Brand, so darf er nimmermehr als Landmann geachtet werden, und wer ihn in den Tälern hegt und schützt, ist dem Geschädigten ersatzpflichtig. — Wer einen der Eidgenossen beraubt oder irgendwie schädigt, dessen Gut in den Tälern soll für den Schadenersatz haften. — Niemand soll einen andern, ausser einen anerkannten Schuldner oder Bürgen, pfänden und auch dann nur mit Erlaubnis seines Richters. — Im übrigen soll jeder seinem Richter gehorchen und, wo nötig, den Richter im Tal, vor dem er zu antworten hat, bezeichnen. — Gehorcht einer dem Gericht nicht und es kommt ein Eidgenosse dadurch zu Schaden, so habe alle andern jenen zur Genugtuung anzuhalten. — Entsteht Krieg oder Zwietracht zwischen Eidgenossen und will ein Teil sich dem Rechtspruch oder der Gutmachung entziehen, so sind die Eidgenossen gehalten, den andern zu schützen. — Diese Ordnungen sollen, so Gott will, dauernden Bestand haben. Zu Urkund dessen ist auf Verlangen der Vorgenannten diese Urkunde gefertigt und mit den Siegeln der drei vorgenannten Gemeinden und Täler bekräftigt worden. Geschehen im Jahre des Herrn 1291 zu Anfang des Monats August. Beteiligung, historischer Beitrag zur Rechtssicherheit Es wird oft übersehen, dass nur Nidwalden, nicht aber Obwalden im Text erwähnt wird. Die Urkunde ist aber mit dem Siegel von Unterwalden versehen, welches sowohl für Nidwalden als auch für Obwalden galt. Es könnte sein, dass Obwalden zu einem späteren Datum diesem Bund beitrat. Ebenfalls weniger bekannt ist, dass die Urkunde kein genaues Datum trägt: sie sei „Anfangs August 1291 verfasst worden, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass dies gerade am 1. August gewesen sein muss. Vielmehr wurde dieses Datum erst im Zuge des neu erwachten Interesses am Bundesbrief im 19. Jahrhundert auf diesen Tag gelegt, welcher seitdem als Schweizerischer Nationalfeiertag begangen wird. Auch ist hervorzuheben, dass der Bundesbrief nicht die Gründung eines Verteidigungsbündnisses darstellt, sondern sie ist eher ein Rechtsdokument, das die Rechtssicherheit allgemein in den Vordergrund stellte und Landfrieden sichern sollte. Nur zwei von sieben Absätzen sind für den Beistand im Kriegsfall relevant; andere beschäftigen sich mit Themen wie Streitbeilegung sowie Straf- und Zivilrecht. Dafür spricht auch, dass sich die habsburgischen Herrscher nicht um die Orte der alten Eidgenossen kümmerten; Habsburgische Befestigungsanlagen sind in der Innerschweiz nicht bekannt. Entgegen weitverbreiteten Ansichten steht der Bundesbrief für die Sicherung der bestehenden Verhältnisse und ist nicht als Auflehnung gegen Habsburg zu verstehen. Spätere Zuschreibungen Erst im 19. Jahrhundert, insbesondere beim 600-jährigen Jubiläum 1891, schenkte man diesem Bundesbrief die Beachtung, die er heute geniesst. Zuvor wurde als Gründung der Schweiz meist der Bund von Brunnen angesehen, welcher am 9. Dezember 1315 nach der Schlacht bei Morgarten geschlossen wurde. Für den Rütlischwur existiert auch das überlieferte Datum 8. November 1307. Zudem wird im Bundesbrief von 1291 auf ein früheres Abkommen Bezug genommen, dessen Text jedoch nicht erhalten geblieben ist. Somit kann man die Gründung nicht auf ein einzelnes Ereignis (die Unterzeichnung des Bundesbriefes) reduzieren, sondern muss sie als lange andauernden geschichtlichen Prozess verstehen. Die schweizerische Eidgenossenschaft formte sich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts aus einem engen, aber nie alle Orte zusammen umfassenden Bündnisgeflecht. Bis 1966 erachtete man den Bundesbrief als echt und Erneuerung eines früheren Schreibens. Viele weisen nach 1966 dann darauf hin, dass der Bundesbrief mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Fälschung aus dem 14. Jahrhundert darstellt, wie sie im Mittelalter üblich waren.