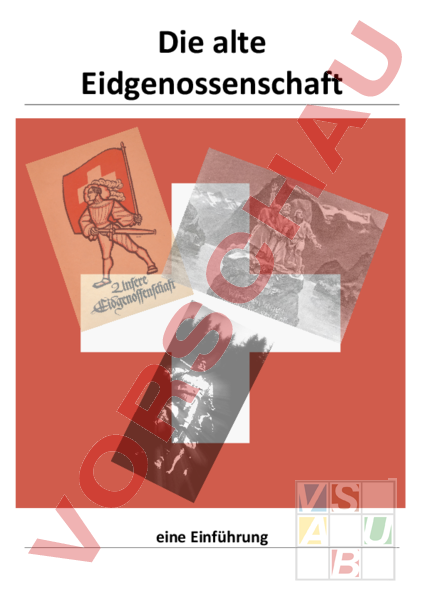Arbeitsblatt: Entstehung der alten Eidgenossenschaft
Material-Details
Texte und Bilder zur Entstehung der alten Eidgenossenschaft, Schwerpunkt 1200 bis 1400
(Bezug zum Lehrmittel "Spuren-Horizonte")
Geschichte
Mittelalter
6. Schuljahr
12 Seiten
Statistik
159056
1200
44
28.03.2016
Autor/in
Pascal Wirth
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Die alte Eidgenossenschaft eine Einführung F Lies die Texte aufmerksam durch und betrachte die Bilder genau. Markiere wichtige Stellen und mache auf der letzten Seite Notizen, um dir Wesentliches zu merken. Benütze als Hilfe das Glossar (KM 50.2). Die Aufträge dazwischen gehören zum Lehrmittel „Spuren – Horizonte, Kapitel „Sagenhafte Schweiz (S. 96 f). Als Staat mit Gebiet und Grenze, mit Verfassung und Regierung ist die Schweiz knapp 160 Jahre alt. Unsere heutige Staatsordnung mit dem Bundesrat, dem National-‐ und Ständerat wurde nach heftigen Kämpfen nämlich erst 1848 geschaffen. Die Schweiz lässt sich aber bis auf den berühmten Bund von 1291 zurückverfolgen, ja noch viel weiter. Wir wollen untersuchen, wie unsere Eidgenossenschaft gegründet und erweitert wurde. Wenn wir uns mit der Geschichte eines Tales oder einer Ortschaft befassen, sollten wir stets über die eng gesteckten Grenzen hinausblicken auf die Geschichte anderer Dörfer und Täler, Städte und Länder. Ist es unseren Vorfahren gleich ergangen wir ihren Nachbarn rundherum? Haben sie sich anders entwickelt als die Menschen in andern Ländern? Diese Fragen sind wichtig, wenn wir unsere eigene Geschichte recht verstehen wollen. Aufschwung und Bevölkerungswachstum in ganz Europa Wie lebten die Menschen im sogenannten Hochmittelalter? Zwischen etwa 1000 und 1350 wurden in Europa weniger Kriege ausgetragen als sonst. Zudem setzten die Bauern verbesserte Pflüge ein. Die mühsamen Arbeiten mit Sichel wurden immer mehr mit der Sense verrichtet. Um ein bestimmtes Stück Land zu bebauen, brauchte der Bauer weniger Zeit – und erzielte erst noch einen höheren Ertrag. Damit konnten mehr Mäuler gestopft werden. Gut ernährte Menschen widerstehen Krankheiten viel besser. Verheerende Seuchen konnten sich in dieser Zeit nicht ausbreiten. Weniger Kriege, mehr zu essen, weniger Krankheiten: Unter diesen günstigen Umständen wuchs die Bevölkerung kräftig an. Dies geschah in ganz Europa, auch im Gebiet der heutigen Schweiz. Wo sollte die anwachsende Bevölkerung leben? Entweder wurden die bestehenden Städte vergrössert, oder adelige Herren nutzten den Bevölkerungszuwachs, um neue Städte zu gründen. Vor allem zwischen 1200 und 1300 schossen im Schweizer Mittelland neugegründete Städte wie Pilze aus dem Boden. Oder aber der Bevölkerungs-‐ Bevölkerungsdruck entlud sich in Richtung Jura entwicklung in und Alpen. Auch einsame Höhen und abgelegene Europa (ohne Russland) Täler wurden nun besiedelt. Das bekannteste im Menschen Beispiel dafür ist das Urner Reusstal. Jahre 1000 1050 1100 1150 1200 1300 1350 1400 1500 1600 (Schätzungen) 42 Mio 46 Mio 48 Mio 50 Mio 61 Mio 73 Mio 51 Mio 45 Mio 69 Mio 89 Mio Diese langandauernde Blütezeit fand um 1350 innert weniger Jahre ein Ende. Das Klima verschlechterte sich unaufhörlich. Eine Missernte folgte auf die andere. Überall breiteten sich schliesslich bittere Hungersnöte aus. Und nun schlug unter den geschwächten oder gar kranken Menschen der Schwarze Tod zu, die Pest. Sie riss um die Mitte des 14. Jahrhunderts klaffende Lücken in die Bevölkerung von Stadt und Land. In manchen Ortschaften soll die Hälfte aller Menschen dieser unbarmherzigen Krankheit zum Opfer gefallen sein. Wie so oft in der Geschichte, hatten sich die Menschen auch damals auf eine völlig neue Lage einzustellen. Städtegründungen um 1200 Eine Stadt gründen, ein abgelegenes Tal urbar (städtisch) machen und besiedeln – das braucht etwas! Die adeligen Herren, die den Anstoss dazu gaben, verfolgten auch handfeste Ziele: Wenn sie reichen Kaufleuten innerhalb der schützenden Mauern ein Grundstück für einen Hausbau überliessen, so taten sie das gegen guten Zins. Eine Stadt brachte ihrem Herrn Einkünfte. Vor allem die Herzöge von Zähringen haben sich bei der Gründung von Städten und der Besiedlung von Alpentälern einen Namen gemacht. Die Zähringer waren im 12. Jahrhundert die mächtigsten 1 Fürsten weit und breit. Sie besassen Güter im Breisgau, Schwarzwald und Burgund, aber auch im Aargau und im Emmental. Um 1120 gründeten die Zähringer im deutschen Breisgau die Stadt Freiburg. Diese Stadt diente als Vorbild für weitere Städte. Bis zum Aussterben des Geschlechts 1218 folgten Rheinfelden, Freiburg (CH), Murten, Burgdorf, Bern, Thun u.a. Die Herzöge von Zähringen nützten die stete Bevölkerungs-‐ vermehrung nicht nur für Städtegründungen aus, sondern auch, um das Urner Reusstal noch dichter zu besiedeln. Die praktische Ausführung übertrugen sie Adeligen, die ihn ihren Diensten standen. Die Zähringer verpflanzten sie aus den Ländereien zwischen Aare und Emme ins Urnerland. Die Habsburger Noch wichtiger als die Zähringer wurden für unser Land die Habsburger. Sie stammten aus dem Elsass (Region im Nordosten von Frankreich). Um 1020 bauten sie im Aargau die Habichtsburg und erwarben so viele Ländereien und Rechte, dass sie schliesslich zu den mächtigsten Herren im Gebiet der heutigen Schweiz gehörten. Das ursprünglich kleine Grafengeschlecht im Aargau erwarb später in Österreich riesige Ländereien. Diese wurden bald viel wichtiger als die Gebiete in der Schweiz. Die Habsburger verlegten ihren Hauptsitz deshalb nach Österreich. Aus diesem Grund wurden sie auch Österreicher genannt 2 Geschichte oder Geschichten? König Rudolf von Habsburg lebt in vielen Sagen, Legenden, Anekdoten und Liedern weiter. Beim Weitergeben wurden sie im Lauf der Jahrhunderte immer wieder abgeändert. Rudolf von Habsburg – Freund oder Feind der Eidgenossen? Die Habsburger gelten als die Erzfeinde der Eidgenossen. In den Schlachten am Morgarten (die erste Schlacht zwischen den Eidgenossen und den Habsburgern im Jahre 1315) oder bei Sempach (1386) – immer ging es gegen Habsburg-‐Österreich. Noch heute zählen viele Geschichtsbücher den 1291 verstorbenen Rudolf von Habsburg zu den Erzfeinden der alten Schweizer. Der Bund der Urner, Schwyzer und Nidwaldner aus dem gleichen Jahr wird als Auflehnung gegen die verhassten Habsburger angesehen. Eine Revolution soll den Innerschweizern die Freiheit gebracht haben. Was ist wahr daran? Menschen in der Innerschweiz vor 700 Jahren Was beschäftigte die Menschen in der Innerschweiz vor 700 Jahren? Ein heute lebender Geschichtsforscher hat sich in die Lage von drei Männern im Jahre 1291 versetzt und die folgenden Texte verfasst. So könnte es in der Innerschweiz tatsächlich getönt haben. Konrad Plüemo, Bauer in Schwyz: „Es ist verrückt in der heutigen Zeit. Als Bauer hast du es nicht leicht. Wie soll man von diesem kleinen Stück Land leben? Wenn ich nur mehr Vieh hätte, dann könnte ich es in die Stadt verkaufen. Aber dort, wo es noch Weideland hat, ausgerechnet dort hocken die Klöster drauf. Ich sehe es jetzt schon: meine Söhne werden neues Land roden. Und das gibt natürlich wieder Streit – mit den Klosterleuten in Einsiedeln. Mich nimmt schon wunder, warum die reichen Klöster so viel Land brauchen! Sollen es nur roden, die Schwyzer Bauern – ist jedenfalls besser, als Händler und Pilger zu überfallen. Und wenn das stimmt, was man hört, dass König Rudolf von Habsburg gestorben sein soll, um Gottes Willen! Dann sehe ich schlecht für uns. Das haben wir ja schon alles einmal erlebt, so eine Zeit ohne König. Dann kann man nur hoffen, dass Stauffacher und die anderen Herren in Schwyz unten zum Rechten sehen und das Gröbste abwenden können. 3 Heinrich von Güttingen, Abt des Klosters Einsiedeln: „Als Abt ist es mir mehr als recht, wenn das Volk gläubig ist und nach Einsiedeln Wallfahrten macht. Aber den Bauern von Schwyz, die hierher kommen, denen ist das Festen wieder einmal wichtiger als das Beten. Und dann die ewigen wüsten Saufereien, die blutigen Schlägereien, äh, pfui Teufel! Gott sei dank sind die Habsburger unsere Schutzvögte. Die Schwyzer würden uns recht drannehmen, wenn unser Kloster nicht auf habsburgischen Schutz zählen könnte. Seither roden die Bauern ja auch nicht mehr auf unserem Gebiet. Und Grenzsteine haben sich auch schon lange keine mehr versetzt – wie früher. Abgesehen vom Ärger mit den Bauern geht es uns nicht schlecht. Von frommen Leuten, die für ihr Seelenheil Gutes tun wollen, erhalten wir immer wieder reiche Schenkungen. Der Rosshandel blüht. Und auch auf geistigem Gebiet sind wir gefragt: unsere Schule kennt man bis weit über den Bodensee hinaus. Und darum müssen wir auch unser Kloster in der heutigen Zeit ausbauen. Werner von Attinghausen, ein Adeliger aus Uri: „Ob es den andern nun passt oder nicht: Wir Attinghausen sind es, die sagen, was gilt. Wir sind das mächtigste Geschlecht im Tal Uri. Jetzt muss nur noch der Verkehr über den Gotthard zunehmen in den nächsten Jahren. Das bringt Einnahmen, Einnahmen, die man weiss Gott dringend brauchen könnte. Nicht zuletzt wegen meinen noch ledigen Töchtern. Wer weiss, vielleicht gibt es das nächste Mal beim Ritterturnier in Zürich oder Konstanz eine gute Heiratspartie. – Warum hat eigentlich König Rudolf von Habsburg gerade jetzt von dieser Welt gehen müssen! Er hätte bestimmt noch warten können. Wer weiss, wie lange es wieder geht, bis einer gewählt wird, und dann noch einer, der uns, unserem Adel, gut tut. Auf jeden Fall ist klar: Wir Adeligen müssen zusammenstehen, und nicht nur wir im Tal, sondern auch die in Schwyz und Nidwalden. Ordnung muss wieder her in unseren Tälern. Unruhe ist das Letzte, was wir brauchen können. Das schadet nur. Und Macht abgeben? Kommt gar nicht in Frage! „Helveticus 2: Die Überquerung des Gotthards Der Bund von 1291 1291 ist ein wichtiges Datum der Schweizergeschichte. Was steckt hinter dieser Jahreszahl? Blicken wir wieder über die Täler am Vierwaldstättersee hinaus auf die übrige Schweiz in der damaligen Zeit! Nur so verstehen wir die Gründung der Eidgenossenschaft richtig. Bevor Rudolf von Habsburg im Jahre 1273 zum deutschen König gewählt wurde, stand es schlecht um die Königsherrschaft. Viele deutsche Könige waren zu schwach, um in Stadt und Land für Frieden und Sicherheit, Recht und Ordnung zu sorgen. Was blieb den Leuten anderes übrig, als sich selber zu helfen? Wie aber sollte das geschehen? Unter der Führung einheimischer Adeliger und reicher Bürger und Bauern schlossen sich Städte und Talschaften zusammen. Mit vereinten Kräften konnte man sich besser wehren, wenn es galt, im Grenzland erworbene Alpweiden zu verteidigen oder Land und Leute ausserhalb der Stadtmauern zu schützen. Und weil der König nicht zum Rechten sah, begaben sich die verbündeten Städte und Talschaften in den Schutz eines mächtigen Herzogs oder Grafen. Was Recht und Unrecht sein sollte, schrieben sie selber auf. 4 Am meisten taten sich dabei die Berner hervor. Im 13. Jahrhundert schlossen sie Bündnisverträge nicht nur mit Freiburg, Avenches, Murten, Solothurn und Biel, sondern auch mit deutschen Städten am Rhein. 1255 handelten Bern, Murten und das Haslital einen Schutzvertrag mit dem Herzog von Savoyen aus. Die Schutzsuchenden betonten dabei ausdrücklich, die Abmachung sollte nur so lange gelten, bis der König mit einem Heer nach Basel komme. Dann sei nämlich erwiesen, dass dieser in der Lage sei, sie in seinen eigenen Schutz zu nehmen. Anders als die Berner halfen sich die Luzerner. 1252 kamen sie zusammen und beschworen eine Stadtordnung. Die zerstrittenen Familiengruppen wurden aufgelöst und verboten. Sie hatten häufig die ganze Bürgerschaft in ihren Zank hineingezogen. Gewalttaten und Streitigkeiten wurden unter schwere Strafe gestellt. Gab es in den Waldstätten Händel, unternahmen die Luzerner alles, um die Gegner auszusöhnen. Wenn sie in der Innerschweiz ihres Lebens nicht sicher waren, machten die Händler einen Umweg um den Gotthard. Für den Umschlagplatz Luzern brachte das schwere Einbussen. Was hat all das aber mit dem Bund der Urner, Schwyzer und Nidwaldner von 1291 zu tun? Die Leute in den Waldstätten (Urschweizer) befürchteten nach dem Tode Rudolfs von Habsburg, in Mitteleuropa sei man wieder gleich weit wie zwanzig oder dreissig Jahre zuvor. Damals hatte ja die Fehde zwischen den Izzeli und den Gruoba das ganze Reusstal in Angst und Schrecken versetzt. Die Städte mussten sich zusammenschliessen und in den Schutz mächtiger Herren begeben, weil kein starker König im Lande war. Wenn sich damals Städte verbünden konnten, warum sollten das jetzt nicht auch Landleute fertigbringen? Der Bundesbrief von 1291 war die erste, einfache Verfassung der alten Eidgenossenschaft. Sie hatten nur zwölf Artikel und fand auf einem einzigen Pergament Platz. 1848 wurde die Eidgenossenschaft zu unserem Bundesstaat umgestaltet. Der Bundesbrief von 1291 Im Namen Gottes, amen. 1. Alle sollen wissen, dass die Leute von Uri, Schwyz und Unterwalden in Anbetracht der Arglist der Zeit und damit sie sich eher verteidigen können, einander mit Hilfe, Rat und Tat, mit Leib und Gut beistehen wollen, innerhalb und ausserhalb der Täler gegen jeden, der ihnen Gewalttat oder Unrecht zufügen will. 2. Hierüber haben die Orte einen Eid geschworen, den sie ohne Hintergedanken halten und durch dieses Bündnis erneuern wollen. 3. Es besteht die Meinung, dass jedermann gemäss dem Stande seiner Familie seinem Herrn nach Gebühr Untertan sein und dienen soll. 4. In gemeinsamem Rat haben wir auch angeordnet, dass wir keinen Richter annehmen, der sein Amt um irgendeinen Preis oder um Geld erworben hätte oder der nicht unser Landsmann wäre. 5. Wenn zwischen Eidgenossen Uneinigkeit entsteht, sollen die Verständigeren unter ihnen den Streit zwischen den Parteien schlichten. 6. Wer einen andern hinterlistig und ohne Schuld tötet, soll sein Leben verlieren, wenn er ergriffen wird, ausser er beweise seine Unschuld. Wenn er entweicht, so darf er niemals zurückkehren. 7. Wer einen Eidgenossen bei Tag oder bei Nacht hinterlistig durch Brand schädigt, der soll niemals mehr als Landsmann angesehen werden. 8. Wenn ein Eidgenosse einen andern seines Gutes beraubt oder irgendwie schädigt, so soll das Gut des Übeltäters beschlagnahmt werden und den Geschädigten zufallen. 9. Es soll niemand den andern pfänden, ausser er sei sein Schuldner oder Bürge, und auch dies nur mit besonderer Erlaubnis eines Richters. 10. Jeder soll seinem Richter gehorchen. Wer sich dem Urteil widersetzt und durch seine Hartnäckigkeit einem Eidgenossen Schaden zufügt, soll von allen Verbündeten zur Wiedergutmachung gezwungen werden. 11. Sollte unter den Eidgenossen Zwietracht sich erheben, sind die übrigen Eidgenossen gehalten, die Partei, die im Recht ist, zu schützen. 12. Die aufgestellten Abmachungen sollen, so Gott will, ewig dauern und mit dem Siegel der drei Täler bekräftigt werden. 5 Die Datierung des Bundesbriefes auf das Jahr 1291 hält auch neusten Untersuchungen mit der C14-‐Methode stand: Das verwendete Pergament stammt tatsächlich aus dem späten 13. Jahrhundert! Der Bundesbrief von 1291 lag lange vergessen in Schwyz im alten Archivturm, und auch nach seiner Wiederentdeckung im 18. Jahrhundert wurde ihm zunächst keine allzu grosse Beachtung geschenkt. Erst die Bildung von Nationalstaaten rund um die Schweiz herum um 1860 -‐ 1880 und der Zeitgeist des wissenschaftsgläubigen 19. Jahrhundert (mit seiner Vorliebe für das mittels Experimenten oder wenigstens alten Urkunden Beweisbare) holte den Bundesbrief aus seinem Dornröschenschlaf. Während des 2. Weltkrieges errichtete man in Schwyz ein eigenes Bundesbriefmuseum. Der Bundesbrief wurde damals in einer alleinstehenden Vitrine in einem kirchenähnlichen Raum wie eine Heilige Schrift ausgestellt. Der Datumsstreit: 1291 oder 1307 ? Erst als um 1890 in Bern die Idee aufkam, das 700-‐Jahr-‐Jubiläum der Stadt Bern und das 600-‐Jahr-‐Jubiläum des Bundesbriefs gemeinsam zu feiern, brach eine grosse Diskussion über den echten Ursprung der Alten Eidgenossenschaft zwischen den Zentralschweizer Urkantonen und den städtischen Industriezentren aus. Im Bewusstsein der breiten Bevölkerung durchgesetzt hat sich letztlich diejenige Variante, die wohl am wenigsten mit der historischen Wahrheit übereinstimmt: Bundesbrief, Rütlischwur und die Taten von Wilhelm Tell wurden in einen unmittelbaren und direkten Zusammenhang gestellt und dafür das Datum des 1. August 1291 festgelegt. F Lies und bearbeite im „Spuren – Horizonte die Seite 94. Rütlischwur – ein Mythos? Bis etwa 1890 hielt man allerdings nach einer alten Überlieferung den Rütlischwur für das eigentliche grundlegende Bündnis der Alten Eidgenossen und datierte ihn auf 1307, ebenso wie den in einer bekannten Sage überlieferten Apfelschuss des Freiheitshelden Wilhelm Tell und den Tyrannenmord am Landvogt Gessler. Der Rütlischwur soll auf der Rütliwiese am Abhang des Seelisberges am linken Ufer des Vierwaldstättersees stattgefunden haben. Die älteste schriftliche Quelle für dieses Ereignis ist das Weisse Buch zu Sarnen des Landschreibers Hans Schriber von Obwalden. Dieser sammelte um 1470 Urkunden und Sagen zum Ursprung der Alten Eidgenossenschaft. Im Weissen Buch zu Sarnen heisst es: «. und kamen also ihrer drei zusammen, der Stoupacher zu Schwyz, und einer der Fürsten zu Uri und der aus Melche von Unterwalden, und klagte ein jeglicher dem anderen seine Not und seinen Kummer, . Und als die drei einander geschworen hatten, da suchten sie und fanden einen nid dem Wald, . und schwuren einander Treu und Wahrheit, und ihr Leben und ihr Gut zu wagen und sich der Herren zu erwehren. Und wenn sie etwas tun und vornehmen wollten, so fuhren sie für den Mythen Stein hin nachts an ein End, heisst im Rütli .» (Hans Schriber, Weisses Buch zu Sarnen, um 1470, zitiert nach Chronik der Schweiz, S. 145) Die Namen der drei Eidgenossen, die am Rütlischwur beteiligt sind, meint man seit Friedrich von Schillers Drama Wilhelm Tell genau zu kennen: Werner Stauffacher aus Schwyz, Walter Fürst aus dem Kanton Uri und Arnold von Melchtal -‐ und dies, obwohl die älteste Quelle der Rütli-‐Sage die Vornamen nicht nennt. „Helveticus 3: Der Rütlischwur Wilhelm Tell Durch die Erschliessung des Gotthardpasses zu Beginn des 13. Jahrhunderts wurde das Gebiet der heutigen Zentralschweiz politisch höchst bedeutungsvoll. Im Jahre 1231 erhielt Uri einen kaiserlichen Freiheitsbrief und unterstand damit unmittelbar dem Kaiser. Die Herzöge von Habsburg und auch der Kaiser wollten jedoch ihren Einfluss in Uri verstärken. 6 Gegen Ende des Jahrhunderts sassen Habsburger auf dem Königsthron. Habsburger kamen als königliche Vögte ins Land und versuchten, die Waldstätte ganz ihrer Hausmacht einzuverleiben. Die Landsleute von Uri, Schwyz und Unterwalden sahen dieser Entwicklung indessen nicht tatenlos zu. Der eidgenössische Bund von 1291 war gegen Habsburg gerichtet. Die Tell-‐Sage „Der habsburgische Landvogt Hermann Gessler wollte die Gesinnung der Landleute von Uri prüfen. Er liess zu diesem Zweck auf dem Hauptplatz in Altdorf einen habsburgischen Hut auf einer Stange anbringen und befahl, jedermann, der am Hut vorbeigehe, müsse als Zeichen der Ehrfurcht den Hut mit entblösstem Haupt grüssen. Wilhelm Tell und sein Sohn Walter aus Bürglen gingen achtlos am Hut vorbei. Tell wurde festgenommen und vor den Landvogt gebracht. Auf die Frage Gesslers, warum er den Grussbefehl missachtet habe, antwortete Tell ausweichend. Gessler war über diese Antwort erbost und befahl Tell, der als guter Armbrustschütze bekannt war, dem eigenen Sohn Walter einen Apfel vom Kopfe zu schiessen. Tell erschrak, bot sein eigenes Leben an, um nicht jenes seines Sohnes zu gefährden. Umsonst flehte er Gessler an, diese unmenschliche Strafe zu mildern. Der Vogt entschied sogar, dass Vater und Sohn sterben müssten, falls Tell den Schuss verweigere oder nicht beim ersten Versuch den Apfel treffe. Tell hatte in der Tat keine Wahl. Er zielte und der Pfeil traf den Apfel mittendurch. Das herbeigeströmte Volk hielt mit seiner Sympathie nicht zurück und zeigte ungestüme Freude über Tells Meisterschuss. Gessler war jedoch nicht entgangen, dass Tell zwei Pfeile in seinen Köcher gesteckt hatte und wollte wissen wozu. Tell antwortete, das sei so Brauch bei den Schützen. Gessler liess diese Ausrede nicht gelten und wollte den wahren Grund erfahren. Er sicherte Tell zu, dessen Leben zu schonen, wenn dieser ihm die Wahrheit sage. Nun erklärte Tell aufgebracht, dass er ihn, Gessler, sicher mit dem zweiten Pfeil getroffen hätte, falls der Schuss auf den Apfel missglückt wäre. Auf diese kühne Antwort hin liess der Vogt Tell neuerlich ergreifen, um ihn für den Rest seines Lebens auf der Burg bei Küssnacht einzukerkern. Gessler und sein Gefolge begaben sich mit dem gefesselten Tell in Flüelen aufs Schiff. Kaum unterwegs, setzte ein gewaltiger Föhnsturm ein, der das Boot zu kentern drohte. Die Schiffsleute erkannten die lebensbedrohende Lage. Sie vermochten Gessler zu überzeugen, dass nur Tell der als erfahrener Schiffsmann ebenso berühmt war wie als Armbrustschütze sie aus der Seenot retten könne. Tell wurde losgebunden, übernahm das Steuer des Bootes und hatte nur ein Ziel im Auge, die ihm wohlbekannte Felsplatte am Axen zu erreichen. Als er nahe genug war, ergriff er seine Armbrust, sprang auf den Felsblock und stiess das Boot mit aller Kraft ins windgepeitschte Wasser zurück. Tell eilte sodann auf kürzestem Wege über Berg und Tal zur „Hohlen Gasse bei Küssnacht, wo er auf den Landvogt wartete. Gessler, der dem stürmischen See doch noch entkommen war, kam mit seinem Gefolge herangeritten. Mit dem zweiten Pfeil, den er bereits in Altdorf in seinen Köcher gesteckt hatte, erschoss Tell den tyrannischen Landvogt. Tells Taten wurden schnell im ganzen Land bekannt und stärkten die Bewegung für Freiheit und Unabhängigkeit in der Urschweiz. Wilhelm, Tell – Sage oder Wahrheit? Neben Urkunden berichten viele Sagen über die Entstehung der Eidgenossenschaft. Die einen sind vermutlich frei erfunden. Andere haben vielleicht einen geschichtlichen Kern, da sie von Personen handeln, die wirklich gelebt haben. Wenn diese Sagen an langen Winterabenden weitererzählt, von den Eltern auf die Kinder übertragen wurden, kamen immer wieder selbsterdachte Ergänzungen hinzu. Schliesslich konnte niemand mehr unterscheiden, was ursprünglich Kern und was Zusatz gewesen war. Wie bei den Sagen um Rudolf von Habsburg haben wir es auch hier mit Geschichten, nicht mit Geschichte zu tun. Wie steht es nun mit Wilhelm Tell? Ist er eine Figur der Geschichte oder der Sage? Die Befreiungssage ist eine prächtige Geschichte, handlungsreich und spannend. Der deutsche Dichter Friedrich Schiller (1759-‐1805) hat daraus ein grossartiges Schauspiel gemacht. Fast alles, was man über Tell weiss, geht auf dieses Theaterstück von Schiller zurück. Durch ihn ist unser Nationalheld erst richtig populär geworden. Aber auch Friedrich Schiller standen keine Urkunden zur Verfügung, die ihm Auskunft gegeben hätten. Es gibt ganz einfach keine Quellen aus der Zeit um 1300, die Tell erwähnen. Zum ersten Mal wurde die Tell-‐Sage um 1470 im Weissen Buch von Sarnen aufgeschrieben. „Helveticus 4: Wilhelm Tell F Lies und bearbeite in „Spuren – Horizonte die Seite 95 und die AB „Wilhelm Tell (KM 95.1), AB „Die Burgen brannten nicht (KM 95.2) und AB „Es gibt viele Tellen (KM 95.3ab). 7 F Zusatz: Lies und bearbeite in „Spuren – Horizonte die Seite 98 und 99 und die AB „Liebi Buebe und Meitli (KM 98.1), AB „Ein Aufsatz von Eva Zimmer (KM 98.2) und AB „Unsere Vorbilder, alles Helden? (KM 99.2). Ein Grenzstreit führt zum Krieg Im Grenzstreit zwischen Schwyz und dem Kloster Einsiedeln ging es um das Land in den Tälern von Biber und Alp und im Quellgebiet der Sihl (siehe Bild). Das Kloster liess die umstrittenen Weiden nicht bewirtschaften, während die Schwyzer diese Alpengebiete dringend gebraucht hätten. Unter diesen Umständen musste es zum Streit kommen. Zum Richter aufgerufen, entschied Graf Rudolf der Alte von Habsburg im Jahre 1217 für die Schwyzer. Der Grenzkrieg mottete aber weiter. Ein Schiedsgericht verpflichtete die Schwyzer, die eigenmächtig beanspruchten Alpen wieder zu verlassen. Als sich diese dem Gerichtsurteil nicht beugten, verhängte der Papst über sie und die beteiligten Urner und Unterwaldner die schwerste Strafe, die es gab: den Kirchenbann. In den drei Ländern durften die Geistlichen keine kirchlichen Handlungen mehr vornehmen, so etwa keine Messen mehr lesen, keine Kinder mehr taufen, keine Brautpaare mehr trauen, keine Toten mehr bestatten. Dazu waren die Innerschweizer geächtet. Jeder konnte sie straflos berauben oder sogar töten. Wir können uns leicht vorstellen, wie das die Betroffenen erbittern musste. Angeführt von ihrem Landammann Werner Stauffacher, überfielen die Schwyzer in der Nacht des Dreikönigstages 1314 das Kloster Einsiedeln. Elf Wochen wurden die Mönche, die alle aus adeligen Familien stammten, gefangen gehalten. Danach setzten die Schwyzer sie erst wieder auf freien Fuss. Aber damit war der böse Streit noch nicht bereinigt. Schutzvögte von Einsiedeln waren nämlich seit 1283 die Habsburger. Wollten sie ihr Amt ernst nehmen, waren sie geradezu verpflichtet, gegen die Schwyzer vorzugehen. Ein habsburgerisches Heer unternahm 1315 einen energischen Angriff, wurde aber am Morgarten, nahe der Schwyzer Grenze, zurückgeschlagen. Die österreichische Niederlage erregte Aufsehen im Deutschen Reich. Ein Ritterheer war von einem Haufen Hirtenkrieger in gebirgigem Gelände besiegt worden. Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein Drei Wochen nach der Schlacht am Morgarten bestätigten und erweiterten die Urner, Schwyzer und Unterwaldner in Brunnen den Bund von 1291. Aus einem Landfriedensbündnis war 1315 ein Abwehrbund gegen Habsburg geworden. Von nun an traten die drei Waldstätten nach aussen nur noch gemeinsam auf. Schlacht am Morgarten Unerwartet für die Angreifer wandten die Eidgenossen eine neue Taktik an: Nicht das ritterliche Kräftemessen nach klar festgelegten Regeln der Fairness, sondern die Vernichtung des Gegners war ihr Ziel. Darauf war das Ritterheer der Habsburger nicht vorbereitet und dies begründete die psychologische Überlegenheit der Eidgenossen für die kommenden Jahrhunderte. Somit stellt diese Schlacht eine klare Wende in der Kriegführung dieser Zeit dar. Morgarten gilt als mustergültiges Beispiel der geschickten Ausnützung des Geländes. Der Kampf wird dort gesucht und dem Gegner aufgezwungen, wo das Gelände den Verteidiger stark macht und den zahlenmässig überlegenen Gegner schwächt. Die Schwyzer erlaubten den Rittern bei Morgarten beispielsweise nicht, Formen des Reiterkampfes 8 anzuwenden, sondern zwangen ihnen den Nahkampf auf. Ein wesentliches Element der Kriegsführung bestand zudem im Überraschungseffekt. Das habsburgische Heer versammelte sich in Zug und setzte sich am frühen Morgen des 15. November 1315 gegen Ägeri und Sattel in Marsch. Die Schwyzer waren über die Route des österreichischen Heeres unterrichtet. An den Abhängen zu beiden Seiten des Weges nach Schafstetten erwarteten rund 1500 Schwyzer und Verbündete die 3000 bis 5000 Österreicher, davon vielleicht ein Drittel Berittene. Der Hinterhaltskampf muss kurz und brutal gewesen sein. Mit grossen Handsteinen und ihren Halbarten überraschten die Schwyzer die im engen Gelände benachteiligten Ritter und liessen ihnen kaum Raum zur Gegenwehr. Der Flucht der schwer geschlagenen Ritterschar folgte wohl rasch jene des noch weit hinten am Ägerisee aufmarschierenden Fussvolkes. Der Krieg war mit der Schlacht noch lange nicht vorbei. Erst 1318 wurde ein Waffenstillstand geschlossen und in den Folgejahren mehrmals erneuert. Der Sieg am Morgarten aber gab Anlass für den Bund von Brunnen vom 19. Dezember 1315 und schmiedete die drei Länder am See enger zusammen. Die Urschweizer Eidgenossenschaft war gefestigt und konnte ihr weiteres Schicksal an die Hand nehmen. Schlacht bei Sempach Laßt hören aus alter Zeit von kühner Ahnen Heldenstreit, von Speerwucht und wildem Schwertkampf, von Schlachtstaub und heißem Blutdampf. Wir singen heut ein heilig Lied, es gilt dem Helden Winkelried. So beginnt das „Sempacherlied. Das Lied hat seine Entstehung der Schlacht bei Sempach zu verdanken. Die Herzöge von Österreich, die früher in so mächtig waren, konnten es nicht verwinden, dass sie bei Morgarten von den drei Ländern Uri, Schwyz und Unterwalden besiegt worden waren. Die Winkelried-‐Sage „So zog denn der österreichische Herzog Leopold der Glorreiche mit einem gewaltigen, aufs Beste ausgerüsteten Heere gegen die Bergländer aus. Es war im Jahre 1386 zur Erntezeit, als das stolze Kriegsheer vor ein Städtlein namens Sempach kam, das an einem stillen, kleinen See liegt. Die Eidgenossen von Luzern, Uri und Unterwalden, mit Zuzügen von Zug und Glarus, lagen im Walde versteckt und sahen den jungen Herzog mit seinem glänzenden Heere von viertausend Reitern und Fussvolk bei Sempach stehen. Die Österreicher trieben es gar übermütig, da sie sicher glaubten zu siegen. Sie führten auch ganze Wagen voll Stricke mit sich, an denen sie die Eidgenossen aufhängen wollten. Als nun Herzog Leopold die Eidgenossen im Walde merkte, befahl er, dass sich sein Heer in Schlachtordnung im freien Felde aufstellen solle, und kein Ritter dürfe auf dem Pferde bleiben. Jetzt zeigten sich die Eidgenossen am Waldrand. Es war ein gar warmfeuchter Tag und die Sonne brannte vom Himmel. Jetzt rannten die Schweizer in Keilform, wie bei ihnen gebräuchlich, mit gewaltigem Kriegsgeschrei von den Hügeln herab ins Feld. Wild schwangen sie ihre Hellebarden und Knüttel und meinten gleich im ersten Anlauf an den Feind zu kommen. Doch des Herzogs Heer hatte sich so aufgestellt, dass den heranstürmenden Schweizern ein gar stachliger Eisenhag von lauter langen Spiessen, die bis aus dem vierten Glied sollen vorgeragt haben, entgegenstand. Also prallten die Eidgenossen an dieser fürchterlichen Hecke gar böse auf mit ihrem lebendigen Keil und sahen mit Schrecken, dass sie dem Ritterheer, das mit Schild und Speer wie eine Mauer dastand, mit ihren Schlagwaffen nicht beizukommen vermochten. Ratlos standen sie vor den Spiessen. Obwohl sie darauf loshämmerten mit ihren Knütteln und viele zerbrachen, kamen sie doch nicht an die Ritter, denn immer wieder wurden die zerbrochenen Spiesse aus den hinteren Reihen rasch ersetzt. Noch nicht ein Feind war gefallen und schon lagen viele Eidgenossen sterbend unter den Spiessen. 9 Da rief auf einmal ein Mann aus Unterwalden namens Arnold Winkelried mit gewaltiger Stimme: Eidgenossen, ich will euch eine Gasse machen. Sorgt für mein Weib und meine Kinder! Er griff mit beiden Armen in die dichtstehenden Spieße und riss sie mit Riesenkraft mit sich zu Boden. Aber wie ein gestauter, plötzlich losbrechender Wildbach rasten jetzt die Eidgenossen über ihn hinweg, brachen in die im Speerwald entstandenen Lücke ein und ließen ihre Hellebarden, Knüttel und Morgensterne so herumwirbeln, dass den Rittern die Helme von den Köpfen und die Speere aus den Fäusten flogen. Eine blutige Straße tat sich in ihren dichten Reihen auf; die wütenden Eidgenossen bahnten sich mit wildem Jauchzen, zu dem die Panzer der Ritter einen gar schrillen Klang gaben, den Weg zur Freiheit weiter, immer weiter bis gegen die Mitte, wo der junge Herzog Leopold hielt. Der rief: Retta Österreich, retta, retta! Er hielt die Fahne, bis auch er zusammengehauen wurde. Bald war die Schlacht aus. Bereits 1387 wurde zum Gedenken eine Schlachtkapelle errichtet, in der jährlich eine Schlachtjahrzeit abgehalten wird. Arnold von Winkelried ist der Legende nach der Held dieser berühmten Schlacht. „Helveticus 5: Arnold von Winkelried F Lies und bearbeite die AB „Die Burgen brannten nicht (KM 95.2) und AB „Gute oder böse Eidgenossen (KM 95.4). Entstehung der modernen Eidgenossenschaft (Kurzfassung) In den folgenden Jahrhunderten traten im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem heutigen Staatsgebiet, vor allem mit den Adelshäusern der Habsburger und Burgunder, nach und nach weitere Gebiete dem Staatenbund bei. (Siehe nächste Seite.) Mit dem Einmarsch Frankreichs unter Napoleon im Jahr 1798 ging die alte Eidgenossenschaft unter. Unter Napoleon wurden im Jahr 1803 die neuen Kantone gebildet, die der Schweiz beitraten. Im letzten kurzen Bürgerkrieg, dem Sonderbundskrieg, wurden jene Kantone besiegt, die sich von der Schweiz lösen und eigene Wege gehen wollten. 1848 wurde die Schweiz mit der so genannten Bundesverfassung in einen modernen Bundesstaat umgewandelt, etwa nach dem Modell der Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Mit der Festhaltung dieser ersten bundesstaatlichen Verfassung wurde die Selbstständigkeit der Kantone eingeschränkt und die moderne Schweiz gegründet. Der neue Staat stärkte den Zusammenhalt der heutigen 26 Kantone und förderte damit die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz. Die Schweiz ist ein wohlhabendes Land mit direkter Demokratie. F Lies und bearbeite in „Spuren – Horizonte die Seiten 96 und 97 und die AB „Verbündet (KM 96.1) und AB „Uneinige Schweiz (KM 97.1) und AB „Denkmal – Denk mal! (KM 97.4) 10 Die Erweiterung der Eidgenossenschaft 11 Notizen . . . . . . . . . . . . . . . . 12