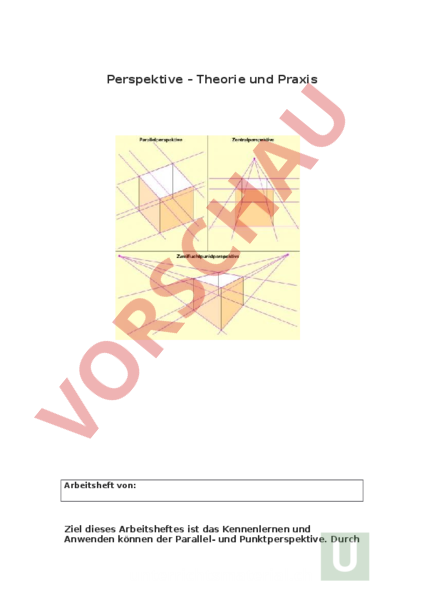Arbeitsblatt: Perspektive - Theorie und Praxis
Material-Details
Arbeitsdossier zur Perspektive
Die SUS erarbeiten die Grundlagen der Perspektive eigenständig.
Bildnerisches Gestalten
Anderes Thema
7. Schuljahr
17 Seiten
Statistik
163752
1908
106
17.08.2016
Autor/in
Sarah Giori
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Perspektive – Theorie und Praxis Arbeitsheft von: Ziel dieses Arbeitsheftes ist das Kennenlernen und Anwenden können der Parallel- und Punktperspektive. Durch die selbständige Auseinandersetzung mit der Theorie und gezielten Übungen wird dir dies gelingen. Fragen kannst du jederzeit der Lehrperson stellen. Du erhältst eine Note für das Lösen der Übungen in diesem Arbeitsheft und eine Note für einen abschliessenden Test. Beurteilungskriterien Dossier: Die Aufgaben sind vollständig gelöst. Konstruktionen sind mit Lineal und Bleistift ausgeführt. Wo nötig zusätzlich mit Farbstiften farblich gestaltet. Die Konstruktionen sind sorgfältig und genau ausgeführt: Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3 Aufgabe 4 Aufgabe 5 Aufgabe 6 Aufgabe 7 Aufgabe 8 erreichte Pkt. (max. 18): Note: Geschichte der perspektivischen Darstellung Die Kenntnisse für perspektivische Darstellungen waren nicht immer selbstverständlich. Wie wir die geometrischen Konstruktionen erfahren müssen, mussten auch andere Völker die Möglichkeiten der räumlichen Darstellung erst erproben und erforschen. In der westlichen Kunst kam die perspektivische Gestaltung mittels Konstruktionen ab dem 15. Jahrhundert in Gebrauch. Zuvor hatte man entweder keine oder keine vollständigen Kenntnisse solcher Darstellungsweisen oder man mass der korrekten Abbildung der Wirklichkeit keinen grossen Wert bei. Im Alten Ägypten (3100-30v.Chr.) bediente sich die Kunst einer sehr strengen Ausdrucksweise mit religiösen und sozialen Symbolen. Tiefe in Bildern wurde durch Überdeckungen oder Staffelungen dargestellt. Wichtig war einerseits die sog. Bedeutungspersepktive. Hohe Persönlichkeiten wie z.B. der Pharao wurden gross, Beamte kleiner und Diener ganz klein dargestellt, ungeachtet der tatsächlichen realen Grössen. Eine solche Bedeutungsperspektive wurde auch in der mittelalterlichen Malerei in Europa verwendet. In der Romanik (ca. 1150-1250 n.Chr.) waren Figuren und Landschaften in hohem Mass stilisiert. Auch in der Gotik (ca. 1150-1500 n.Chr.) verhindern verschiedene Aspekte wie Goldgründe oder willkürliche Grössen von Figuren den Eindruck der Bildtiefe. Dargestellt ist ein spiritueller Raum, kein realer Raum. Dreidimensionalität wurde vor allem bei Figuren durch Modellierung von Licht und Schatten erreicht. Erst in der Renaissance (15. Jh.) begann man wieder, die Kunst als eine Art Spiegel der realen Welt zu sehen. In der Folge entwickelten italienische Künstler und Wissenschaftler Theorien und Gesetzmässigkeiten, um diese Welt abzubilden. Sie stützten sich auf Beobachtungen und einfache Messungen. Nach und nach wurden die Regeln der Fluchtpunktperspektive aufgestellt. Der italienische Künstler Massacio (1401-1428) schuf 1427 ein Fresko der Dreifaltigkeit, in welchem er als Erster konsequent die Zentralperspektive anwendete, eine Unterform der Fluchtpunktperspektive. Damit gelang ihm die perfekte Illusion einer Maueröffnung, die in einen scheinbar dahinter liegeneden Raum mündet. Im nördlichen Europa setzt man anstatt auf die Errungenschaften der Mathematik und Geometrie viel eher auf genaues Beobachten von Linien, Formen, Oberflächen und Licht (Erfahrungsperspektive). Jan van Eyck (1390-1441) beispielsweise malte Innenräume und Landschaften, welche den Raum auf verblüffende Weise widergeben, ohne eine genaue geometriche Konstruktion zu verwenden. Erst mit Albrecht Dürer (14711528) wurden die Gesetze der Perspektive auch im Norden in die Bilder aufgenommen. Neben der Linearperspektive wurden auch die Luft- und Farbperspektive zunehmend verbreitet. Bei Beobachtungen von Landschaften stellte man fest, dass die Farben mit zunehmender Entferung nicht nur einen höheren Blauanteil aufweisen und heller werden, sondern auch Konturen und Details unscharf verschwimmen. In Leonardo da Vincis (1452-1519) Mona Lisa ist die Anwendung dieser Arten der Raumdarstellung zu sehen. Er nannte die Technik sfumato (von ital. verraucht, verschwommen). Bis zum Ende des 19.Jh. standen die Malerei und die perspektivischen Möglichkeiten in enger Beziehung. Ein Bild war umso besser, je grosser die Übereinstimmung von Wirklichkeit und Abbild waren. Durch die Erfindung der Fotografie anfangs des 19.Jh. wandte sich die Malerei jedoch zunehmend anderen Themen als der Darstellung von Realittät zu. Malerische Gesten, Farbwirkungen, das Darstellen von fantastischen oder unmöglichen Räumen, das Wiedergeben von Gefühlen usw. rückte im Kubismus (ca. 1907-1920), dem Expressionismus (ca. 1905-1914) oder auch dem Surrealismus (ab 1919) immer mehr ins Zentrum. Der konstruierte, korrekt dargestellte Raum verlor an Bedeutung, existiert jedoch je nach aktueller Strömung in der Kunst nach wie vor. Aufgabe 1: In diesem Text hast du eine kleine Zeitreise durch die Kunstgeschichte gemacht. Es wurde erläutert, in welcher Epoche der Raum und die Perspektive wie dargestellt wurden. Erstelle nun einen Zeitstrahl mit Jahreszahlen und den im Text fettgedruckten Epochennamen! Im Folgeden lernst du die Parallelperspektive kennen. Ziel ist es, dass du nach dem Durcharbeiten folgendes beherrschst: Lernziele: Du kennst die Regeln der Parallelperspektive. Du kennst die vier Formen der Parallelperspektive. Du kennst die Parallelperspektive und ihre Merkmale. Du kannst Gegenstände und Räume in dieser Perspektive konstruieren. Parallelperspektive Nachstehend werden die vier gebräuchlichsten Arten der Parallelperspektive kurz erläutert. Kavalierperspektive Die Horizontalen und Vertikalen bleiben unverkürzt, die in die Tiefe laufenden Linien werden um 50 gekürzt und verlaufen im 45 Winkel zur Waagerechten. Die Vorderseite des Objekts liegt hingegen auf der Waagerechten. Die Kavalierperspektive zeigt die Vorderansicht, den Aufriss, unverzerrt und eignet sich daher, wenn etwas in der Vorderansicht Wesentliches gezeigt werden soll. Militärprojektion Alle drei Seiten werden unverkürzt wiedergegeben. Die in die Tiefe gehenden Linien verlaufen meist im 60 bzw. 30 Winkel zur Waagerechten, wobei keine Seite des Objekts mit der Waagerechten identisch ist, sondern das Objekt auf der Ecke steht. Weil auch diese Projektionsart ungenormt ist, werden für die Militärprojektion gelegentlich auch andere Winkel benutzt, doch stets ergeben beide Winkel addiert 90, denn nur so wird die Grundfläche unverzerrt wiedergegeben. Da die Grundfläche unverzerrt wiedergegeben wird, eignet sich diese Darstellungsart besonders, wenn die Aufsicht betont werden soll oder etwa in einen architektonischen Raum Einsicht genommen werden soll. Um die Möglichkeiten der Einsicht zu verbessern, werden mitunter auch die Vertikalen (etwa auf 50 %) verkürzt. Isometrische Projektion Alle drei Seiten werden unverkürzt wiedergegeben. Beide in die Tiefe gehenden Linien verlaufen im 30 Winkel zur Waagerechten, so dass die Grundfläche verzerrt wird. Die Isometrie kommt zur Anwendung, wenn an einem Körper Wesentliches in drei gleichwertigen Ansichten gezeigt werden soll, doch eignet sie sich nicht (wie man am Würfel sehen kann) zur Darstellung zentralsymmetrischer Objekte. Dimetrische Projektion Die Vertikalen bleiben unverkürzt. Von den beiden in die Tiefe laufenden Linien wird die eine im 42 Winkel zur Waagerechten gezeichnet und zugleich um 50 gekürzt, die andere wird unverkürzt im 7 Winkel zur Waagerechten eingezeichnet. Die Dimetrie wird vor allem benutzt, wenn die (nur leicht verzerrte) Vorderansicht betont werden soll. Aufgabe 2: Such dir einen Gegenstand aus dem Zimmer aus und stelle ihn in der Kavaliersperspektive wie im Beispiel dar. Konstruiere mit Lineal, Geodreieck, Bleistift und färbe den Gegenstand anschliessend mit Farbstiften ein. Aufgabe 3: Aus den unten aufgezeigten Elementen ist zeichnerisch eine physisch realisierbare Brücke zu konstruieren. Jedes Element darf gekippt oder gedreht werden, muss jedoch in Form und Proportion übernommen und mindestens einmal benutzt werden. Die Brücke ist als Freihandzeichnung mit parallelperspektivischem Verfahren in der Militärperspektive linear zu entwickeln. Dabei soll die Zusammensetzung der Elemente für einen externen Betrachter nachvollziehbar und in Realität rekonstruierbar sein. Die gesamte Zeichenfläche ist sinnvoll zu nutzen, die Brücke darf jedoch vom Bildrand nicht angeschnitten werden. Du kannst dazu auch ein A4 Häuschenpapier verwenden. Im Folgeden lernst du die Punktperspektive kennen. Ziel ist es, dass du nach dem Durcharbeiten folgendes beherrschst: Lernziele: Du kennst die Regeln der Zentralperspektive. Du kennst die Begriffe Fluchtpunkt, Fluchtlinien, Horizont und kannst diese in einem Bild einzeichnen. Du kennst die Zentral- und Übereckperspektive und ihre Merkmale. Du kannst Gegenstände und Räume in diesen Perspektiven darstellen. Punktperspektive Die Punktperspektive erlaubt eine Darstellung des dreidimensionalen Raumes auf einer zweidimensionalen Fläche. Im Gegensatz zur Parallelperspektive wirkt die Punktperspektive wirklichkeitsnäher und eignet sich deshalb z.B. zur Präsentation von Bauvorhaben, phantastischen Räumen oder Ergänzungen in Fotografien. Im Folgenden wird eine knappe Zusammenstellung weniger Typen gemacht. Anzahl der Fluchtpunkte Die Punktperspektive kann mit einem, zwei oder drei Fluchtpunkten dargestellt warden: 1 Fluchtpunkt (Zentralperspektive) 2 Fluchtpunkte (Übereckperspektive) 3 Fluchtpunkte Die Zentralperspektive Als Erstes schauen wir uns die bekannteste Perspektive an, die sog. Zentralperspektive mit einem Fluchtpunkt. Regeln der Zentralperspektive: 1. 2. 3. 4. Die Augenhöhe entspricht dem Horizont. Auf dem Horizont werden die Fluchtpunkte gesetzt. In den Fluchtpunkten schneiden sich die Fluchtlinien. Die Raumdistanzen verkürzen sich zum Fluchtpunkt. Aufgabe 4: Bestimme in folgenden vier Bildern den Fluchtpunkt, indem du Fluchtlinien mit Lineal und Bleistift einzeichnest. Der Fluchtpunkt liegt immer auf dem Horizont. Der Horizont liegt auf Augenhöhe. Notiere auf den Linien rechts also zusätzlich, auf welcher Höhe sich der Betrachter in diesen Bildern wohl ungefähr befindet. Höhe des Horizontes Auf welcher Höhe liegt der Horizont? Diese Frage hat einen erheblichen Einfluss auf die Wirkung eines Bildes. Man unterscheidet im Prinzip drei Formen der Perspektive: 1. Normal: Horizont ungefähr in der Mitte des Bildes Augenpunkt auf Höhe eine stehenden Menschen 2. Froschperspektive: Horizont eher unten im Bild 3. Vogelperspektive: Horizont eher oben im Bild Unterschiede zwischen Parallel- und Zentralperspektive Räume darstellen mithilfe der Zentralperspektive Hier siehst du Schritt für Schritt wie man einen Raum zentralperspektivisch darstellt: Aufgabe 5: Zeichne in der folgenden Darstellung zwei weitere Quader ein. Aufgabe 6: Zeichne nun den Blick in dein Zimmer wie in Bild 12 oben. Positioniere Tisch, Bett und Schrank und evtl. weitere Dinge, die sich in deinem Zimmer befinden. Konstruiere mit Bleistift und Lineal. Darstellung einer Strasse mithilfe der Zentralperspektive Abgebildet siehst du Schritt für Schritt wie eine Strasse mithilfe der Zentralperspektive dargestellt werden kann. Aufgabe 7: Setz dich an einen Strassenrand und versuche diese wie oben darzustellen. Du kannst auch eine Strasse frei erfinden. Beachte aber die Regeln der Zentralperspektive! Du kannst dazu ein separates Blatt verwenden. Die Übereckperspektive Kommen wir nun zur Übereckperspektive mit zwei Fluchtpunkten. Das räumliche Darstellen mit zwei Fluchtpunkten wird angewandt, wenn der Blick auf die Kante oder Ecke eines Objekts fallen soll. Aus der Eckperspektive zeichnen zu lernen ist bereits ein wenig schwieriger, als Anschauungsobjekt können jedoch abermals Würfel dienen. Deren Kanten liegen auf den Fluchtlinien, diese wiederum überschneiden sich dort, wo die vertikalen Kanten des Würfels ihren Ursprung haben. Aufgabe 8: Zeichne dein Traumhaus aus der Vogelperspektive mit zwei Fluchtpunkten von aussen. Konstruiere zuerst mit Lineal und Bleistift und gestalte anschliessend mit Farbstiften. Nimm dazu ein separates Blatt. Hier siehst du zwei Schülerbeispiele: Zusatzaufgabe für Schnelle: Konstruiere einen Wolkenkratzer aus der Froschperspektive! Diese perspektivische Darstellungsweise wird häufig für Architekturzeichnungen verwendet. Mann kann damit z.B. Wolkenkratzer sehr eindrucksvoll perspektivisch zeichnen.In der Zeichnung unten seht Ihr wie die vertikalen Kanten eines Kubus über den dritten Fluchtpunkt (FP3) perspektivisch verzerrt werden.