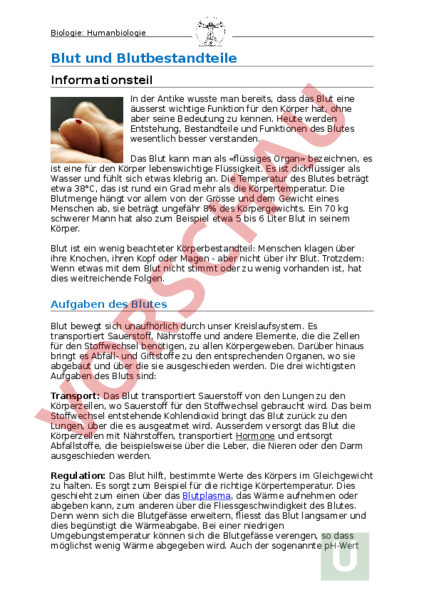Arbeitsblatt: Blut und Blutbestandteile
Material-Details
Beschreibung und Funktion der verschiedenen Blutbestandteile. Inkl. Aufgabenteil
Biologie
Anatomie / Physiologie
9. Schuljahr
14 Seiten
Statistik
163970
1590
18
21.08.2016
Autor/in
David Hafner
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Biologie: Humanbiologie Blut und Blutbestandteile Informationsteil In der Antike wusste man bereits, dass das Blut eine äusserst wichtige Funktion für den Körper hat, ohne aber seine Bedeutung zu kennen. Heute werden Entstehung, Bestandteile und Funktionen des Blutes wesentlich besser verstanden. Das Blut kann man als «flüssiges Organ» bezeichnen, es ist eine für den Körper lebenswichtige Flüssigkeit. Es ist dickflüssiger als Wasser und fühlt sich etwas klebrig an. Die Temperatur des Blutes beträgt etwa 38C, das ist rund ein Grad mehr als die Körpertemperatur. Die Blutmenge hängt vor allem von der Grösse und dem Gewicht eines Menschen ab, sie beträgt ungefähr 8% des Körpergewichts. Ein 70 kg schwerer Mann hat also zum Beispiel etwa 5 bis 6 Liter Blut in seinem Körper. Blut ist ein wenig beachteter Körperbestandteil: Menschen klagen über ihre Knochen, ihren Kopf oder Magen aber nicht über ihr Blut. Trotzdem: Wenn etwas mit dem Blut nicht stimmt oder zu wenig vorhanden ist, hat dies weitreichende Folgen. Aufgaben des Blutes Blut bewegt sich unaufhörlich durch unser Kreislaufsystem. Es transportiert Sauerstoff, Nährstoffe und andere Elemente, die die Zellen für den Stoffwechsel benötigen, zu allen Körpergeweben. Darüber hinaus bringt es Abfall- und Giftstoffe zu den entsprechenden Organen, wo sie abgebaut und über die sie ausgeschieden werden. Die drei wichtigsten Aufgaben des Bluts sind: Transport: Das Blut transportiert Sauerstoff von den Lungen zu den Körperzellen, wo Sauerstoff für den Stoffwechsel gebraucht wird. Das beim Stoffwechsel entstehende Kohlendioxid bringt das Blut zurück zu den Lungen, über die es ausgeatmet wird. Ausserdem versorgt das Blut die Körperzellen mit Nährstoffen, transportiert Hormone und entsorgt Abfallstoffe, die beispielsweise über die Leber, die Nieren oder den Darm ausgeschieden werden. Regulation: Das Blut hilft, bestimmte Werte des Körpers im Gleichgewicht zu halten. Es sorgt zum Beispiel für die richtige Körpertemperatur. Dies geschieht zum einen über das Blutplasma, das Wärme aufnehmen oder abgeben kann, zum anderen über die Fliessgeschwindigkeit des Blutes. Denn wenn sich die Blutgefässe erweitern, fliesst das Blut langsamer und dies begünstigt die Wärmeabgabe. Bei einer niedrigen Umgebungstemperatur können sich die Blutgefässe verengen, so dass möglichst wenig Wärme abgegeben wird. Auch der sogenannte pH-Wert Biologie: Humanbiologie des Blutes wird auf einem für den Köper idealen Wert gehalten. Der pHWert sagt etwas darüber aus, wie sauer oder basisch eine Flüssigkeit ist. Ein konstanter pH-Wert ist für die Körperfunktionen sehr wichtig. Biologie: Humanbiologie Schutz: Wird ein Blutgefäss verletzt, klumpen bestimmte Bestandteile des Blutes nach kurzer Zeit zusammen und sorgen beispielsweise dafür, dass eine Schürfwunde bald zu bluten aufhört. So wird der Körper vor Blutverlusten geschützt. Weisse Blutkörperchen und bestimmte Botenstoffe spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr. Blut als Transportmittel Güterzüge und Lastwagen transportieren täglich riesige Mengen von lebenswichtigen Gütern an Orte, wo sie benötigt werden. Auch unser Körper benötigt ein Transport-mittel, das Blut. Es bringt den Zellen in unserem Körper die zum Leben notwendigen Stoffe: 1. Sauerstoff aus der Lunge 2. Nährstoffe und Wasser aus dem Darm Es führt auch alle Abfallstoffe aus den Zellen zurück zur „Recyclinganlage: 3. Giftige Stoffe in die Leber 4. Abfallstoffe und Wasser in die Niere (wird als Urin ausgeschieden) 5. Kohlendioxid CO2 in die Lunge Daneben enthält das Blut noch weitere wichtige Stoffe: 6. Hormone (Botenstoffe) 7. Abwehrstoffe gegen Krankheitserreger Das Blut fliesst in besonderen Bahnen, den Adern oder Blutgefässen. Die Adern, in denen das Blut vom Herzen wegfliesst, heissen Arterien. Die Blutgefässe, welche das Blut aus dem Körper wieder in das Herz zurückführen, werden Venen genannt. Wärmeregulierung Die ‚Betriebstemperatur unseres Körpers beträgt 36.0 bis 37.4 Celsius. Wärme entsteht vor allem in den arbeitenden Zellen unseres Körpers. Das Blut verteilt diese Wärme im ganzen Körper. Überschüssige Wärme wird durch erweiterte Blutgefässe in der Haut abgestrahlt. Reicht diese Kühlung nicht aus wird die Kühlung durch Schwitzen verstärkt. Biologie: Humanbiologie Soll Wärme gespeichert werden, verengen sich die Blutgefässe in der Haut und die Haare stellen sich auf um den Wärmeverlust möglichst gering zu halten. Biologie: Humanbiologie Zusammensetzung des Blutes Unser Blut enthält wesentlich mehr Bestandteile als nur die roten Blutzellen, deren scheibenartige Form jeder von uns schon einmal auf irgendeiner Abbildung gesehen hat. Schon Hippokrates beobachtete im 4. Jahrhundert vor Christus, dass sich Blut durch Senkung in drei Schichten trennt, wenn man es im Messkolben stehen lässt. Die unterste und schwerste Schicht macht etwa 45 Prozent des Gesamtvolumens aus. Sie enthält die roten Blutzellen, die auch Erythrozyten genannt werden. Darauf folgt eine dünne Mittelschicht, die aus den weissen Blutzellen (Leukozyten) und den Blutplättchen (Thrombozyten) besteht, und darüber die klare wässrige, blassgelbe Oberschicht, das sogenannte Blutplasma. Die roten Blutzellen, auch rote Blutzellen oder Erythrozyten genannt, enthalten den roten Blutfarbstoff Hämoglobin, mit dessen Hilfe sie Sauerstoff von der Lunge zu allen Körpergeweben (z. B. den Muskeln oder den Organen) transportieren. In den Körpergeweben wird der Sauerstoff zur Energiegewinnung verbraucht. Dabei entsteht Kohlen(stoff)dioxid als Abfallprodukt. Es wird von den roten Blutzellen wieder zurück zur Lunge transportiert und dort mit der Atmung ausgeschieden. Weisse Blutzellen sind in weitaus geringerer Zahl enthalten. Sie werden unterteilt in Lymphozyten, Monozyten und Leukozyten. Als ein Teil unseres Immunsystems haben sie die Hauptaufgabe, unseren Körper vor Krankheitskeimen und Schadstoffen zu schützen. Die Blutplättchen oder Thrombozyten sind eher Zellbruchstücke als ganze Zellen. Sie besitzen keinen Zellkern und sind viel kleiner als die roten und weissen Blutzellen. Sie haben aber eine ebenso wichtige Aufgabe: Sie tragen wesentlich dazu bei, dass Blutungen gestoppt werden. Das Blutplasma, das mehr als die Hälfte des Blutvolumens ausmacht, besteht zu über 90 Prozent aus Wasser. Darin vorhanden sind eine Vielzahl Biologie: Humanbiologie weiterer Substanzen wie z. B. Salze, Eiweissstoffe, Fette, Zucker, Mineralstoffe oder Vitamine, Hormone oder Gerinnungsfaktoren, die allesamt lebenswichtige Aufgaben haben. Biologie: Humanbiologie Bestandteile des Blutes Rote Blutkörperchen (Erythrozyten) Die roten Blutkörperchen sind das eigentliche Transportmittel des Menschen. Ihre Hauptaufgabe ist der Transport des Sauerstoffs. In einem Kubikmillimeter Blut sind etwa 5 Millionen rote Blutkörperchen vorhanden. Da Erwachsene etwa 5 bis 6 Liter Blut führen, kreist in ihrem Körper eine unvorstellbar grosse Menge roter Blutkörperchen. Wie wir leicht ausrechnen können, beträgt ihre Zahl rund 25 Billionen. Geldrollenartig aneinandergereiht, würden sie eine Schnur bilden, die um den Erdäquator reichte und diesen noch um ein Viertel seiner Länge überträfe. Die Erythrozyten haben die Form einer oben und unten eingedellten Scheibe mit einem Durchmesser von 0,0075 mm und einer Dicke von 0.002 mm. Die Erythrozyten entstehen im Knochenmark des Brustbeines und des Beckens. Die Produktion beläuft sich auf ca. 2.5 Millionen pro Sekunde. Alte Blutkörperchen (Lebensdauer etwa 120 Tage) werden vorwiegend in der Milz abgebaut. In der Lunge besetzen die Sauerstoffmoleküle die roten Blutkörperchen und werden an jede Stelle des Körpers gebracht. Dort geben die roten Blutkörperchen den Sauerstoff ab und nehmen für den Rückweg Kohlendioxid auf. Das Blut ändert dabei seine Farbe: Sauerstoffhaltiges Blut ist hellrot. Sauerstoffarmes Blut ist dunkelviolett. Hauptbestandteil der roten Blutkörperchen ist das Hämoglobin. Dieses eisenhaltige Molekül kann den Sauerstoff binden und ihn in den Zellen mit Kohlendioxid austauschen. Der menschliche Körper enthält ca. 4 Gramm Eisen. Biologie: Humanbiologie Weisse Blutkörperchen (Leukozyten) Die weissen Blutkörperchen bestehen eigentlich aus drei Blutzellen: Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten. Für uns reicht aber der Begriff weisse Blutkörperchen oder Leukozyten. Sie entstehen im Knochenmark und in den Lymphknoten und werden in der Milz abgebaut. Im Gegensatz zu den roten können die weissen Blutkörperchen ( Leukozyten) sich aktiv fortbewegen und durch die Wände der Gefässe die Blutbahn verlassen. So befindet sich im Blut selbst etwa nur die Hälfte aller Leukozyten des Körpers (etwa 5000 pro Kubikmillimeter), während sich die übrigen im Knochenmark und in den Geweben aufhalten. Die weissen Blutkörperchen übernehmen in ihren differenzierten Ausformungen die vielfältigen Aufgaben des Immunsystems. Genaue Zählungen haben ergeben, dass auf etwa 700 bis 800 rote nur ein weisses Blutkörperchen entfällt. Weisse Blutkörperchen haben je nach Typ eine Lebensdauer von einem Tag bis zu mehreren Jahren. Sie sind zwischen 0.007 mm und 0.015 mm gross. Wer einmal Amöben unter dem Mikroskop beobachtet hat, der erkennt deren grosse Ähnlichkeit mit den weissen Blutkörperchen. Beide bewegen sich mittels Scheinfüsschen fort, beide ändern also fortwährend ihre Gestalt. Man bezeichnet die weissen Blutkörperchen daher auch mit Recht als Schutzorgan, zumal sie aus der Blutbahn auswandern können und diese eigentlich nur dazu benutzen, um im Körper schnell von Ort zu Ort zu gelangen. Sie haben nämlich eine äusserst vielseitige und wichtige Aufgabe zu erfüllen, die ihnen auch den Namen Polizeitruppe eingebracht hat. Biologie: Humanbiologie Makrophagen zum Beispiel sind besonders grosse, weisse Blutkörperchen. Sie werden auch Fresszellen genannt, weil sie die Fähigkeit besitzen, Krankheitserreger, abgestorbene Zellen und Zellbruchstücke sich aufzunehmen (Phagozytose). Ansammlungen solcher weisser Blutkörperchen sind in einem entzündeten Gewebe als Eiter sichtbar. Biologie: Humanbiologie Blutplättchen (Thrombozyten) Die Blutplättchen sind die kleinsten Zellen des Blutes. Sie werden in speziellen Zellen des Knochenmarkes und in den Lymphorganen gebildet. Weitere Blutzellen sind die Blutplättchen, etwa 300 000 bis 600 000 pro Kubikmillimeter Blut. Die Blutplättchen oder Thrombozyten sind runde, ovale oder unregelmässig geformte farblose Scheibchen von 2 mm Durchmesser, die die Blutgerinnung einleiten. Die Lebensdauer von Blutplättchen beträgt nur etwa 10 Tage. Wenn wir uns verletzen und Blut aus der Wunde tritt, bildet sich bald eine Kruste, und die Blutung hört auf. Sobald Blut aus der Wunde tritt platzen die Blutplättchen. Dadurch wird ein Stoff frei, der das flüssige Vorfibrin (Fibrinogen) des Blutplasmas in faserige Eiweissfäden (Fibrin) verwandelt, in denen sich rote und weisse Blutkörperchen verfangen. So wird die Blutung gestillt und die Wunde geschlossen. Dieser Vorgang heisst „Blutgerinnung. Menschen, deren Blut bei einer Wunde nicht gerinnt, nennt man Bluter. Sie müssen sich vor jeder kleinsten Verletzung hüten, da sie sonst daran verbluten können. Die Bluterkrankheit ist eine seltene Erbkrankheit, welche fast ausschliesslich bei Männern vorkommt. Infolge einer Entzündung der Adernwand kann das Blut auch im Innern der Blutgefässe gerinnen (Thrombose). Wenn ein solches Blutgerinnsel vom Blut fortgeschwemmt wird und zum Beispiel ein wichtiges Blutgefäss in der Lunge, Herz oder Hirn verstopft, droht Lebensgefahr. Man spricht dann von einer Embolie oder einem Herzinfarkt. Biologie: Humanbiologie Blutplasma Das Blutplasma ist eine gelbliche Flüssigkeit und besteht zu 90% aus Wasser und zu 10% aus gelösten Stoffen. Es ermöglicht das Schwimmen der 3 Hauptbestandteile und des reibungslosen Zu- und Abtransportes von Stoffen. Es enthält auch die Antikörper und ist für den Wärmeaustausch zuständig. Das Plasma setzt sich zusammen aus Vorfibrin (Fibrinogen) und Blutserum. Vorfibrin ist ein löslicher Eiweissstoff, der sich bei der Gerinnung in feste Fibrinfasern (Fibrin) verwandelt, ähnlich wie flüssiges Eiweiss beim Kochen fest wird. Das Blutserum ist eine wässrige Flüssigkeit, die gelöste Stoffe transportiert: Nährstoffe (Traubenzucker, Fettstoffe, Eiweissbestandteile und Mineralsalze). Abfallstoffe (Kohlendioxid, Harnstoff, Milchsäure und andere Stoffwechselgifte). Hormone werden von der Drüse zum Ausführorgan befördert (stoffliche Befehlsübermittlung). Abwehrstoffe im Serum sind bereit, eine neue gleichartige Erkrankung zu verhindern (Immunabwehr). Blut schützt vor Krankheiten Neben der Transport- und Regulationsfunktion besitzt das Blut noch eine weitere äusserst wichtige Aufgabe: die Abwehrfunktion gegen Krankheitserreger. Die eingedrungenen Krankheitserreger setzen den Körper in Alarm. Der Blutstrom führt die weissen Blutkörperchen an die bedrohte Körperstelle. Dort verlassen sie die Blutbahn, indem sie durch die Aderwand schlüpfen und zwischen den Körperzellen weiter wandern. Die betreffende Körperstelle rötet und erwärmt sich, sie schwillt an und schmerzt sie ist entzündet. Der Körper erhöht seine Temperatur, wir haben Fieber. Im Kampf gegen die eingedrungenen Bakterien gehen viele weisse Blutkörperchen zugrunde und bilden so den Eiter. Wenn die weissen Blutkörperchen nicht den Sieg davontragen, wird der Mensch krank, eine Infektionskrankheit bricht aus, oder es entsteht eine „Blutvergiftung Der Körper bildet zudem Abwehrstoffe (Antikörper), die dann im Blutserum bleiben und unseren Körper dann während einiger Zeit vor einer weiteren Ansteckung schützt. Bei einigen Krankheiten dürfen wir es aber gar nicht soweit kommen lassen. Wir müssen uns vorher gegen den Ausbruch einer Krankheit schützen. Wir lassen uns impfen. Biologie: Humanbiologie Verbreitete Impfungen sind: Kinderlähmung (Polio), Starrkrampf, Pocken, Hepatitis B, Scharlach, Keuchhusten, Röteln, Mumps und Masern. Bei einer Impfung spritzt der Arzt direkt Antikörper in unsere Blutbahn. Leider gibt es noch nicht gegen jede Krankheit Antikörper. Biologie: Humanbiologie Blutgruppen und Rhesusfaktor Blut ist nicht gleich Blut. Was der eine Mensch verträgt, kann für einen andern schädlich sein. Grund dafür sind die verschiedenen Blutgruppen. Die Oberfläche der roten Blutkörperchen unterscheidet sich in ihren Strukturen. Jeder Mensch lässt sich einer der 4 Blutgruppen A, B, AB und 0 (Null) zuordnen. Bei einer Blutübertragung darf ein Mensch nur Blut eines Spenders der gleichen Blutgruppe erhalten, sonst kann Lebensgefahr drohen. Blut verschiedener Blutgruppen verklumpt nämlich, wenn sie vermischt werden (siehe Abbildung unten). Notfalls (!) kann einzig Blut der Gruppe 0 auf Kranke anderer Blutgruppen übertragen werden. Neben den Blutgruppen ist der Rhesusfaktor ein entscheidendes Merkmal des menschlichen Blutes. Es wurde 1940 beim Rhesusaffen entdeckt. Rund 85% der europäischen Bevölkerung besitzt diese Eigenschaft und ist deshalb Rhesus positiv. Wundversorgung Bei einer Verletzung der Körperoberfläche sind fast immer auch Blutgefässe betroffen, die Wunde blutet. Bei Schürfwunden kommt es nur zu geringen, punktförmigen Sickerblutungen, auch wenn ausgedehntere Hautflächen betroffen sind. Weil dabei nur Haargefässe und kleinste Gefässverästelungen verletzt worden sind, genügen in der Regel die Gefässkontraktionen, um die Blutungen zu stillen. Schürfwunden sollten lediglich vor Verunreinigungen geschützt werden und bedürfen keiner weiteren Versorgung. Werden bei tieferen Wunden Venen getroffen, fliesst gleichmässig dunkelrotes Blut aus. Aus verletzten Arterien spritzt dagegen stossweise im Rhythmus des Herzschlages hellrotes Blut. Es besteht dann immer die Gefahr eines lebensgefährdenden Blutverlustes. Deshalb muss bei einer Arterienverletzung die betroffene Schlagader sofort herzwärts abgedrückt und dann unter Hochlagerung des betroffenen Körperteiles bis zum Eintreffen des Arztes mit einem Druckverband zusammengepresst werden. Biologie: Humanbiologie Grössere Wunden sollten stets ärztlich versorgt werden. Bei kleineren mit geringfügigen Blutungen genügt ein keimfreier Schutzverband. Biologie: Humanbiologie Aufgabenteil Aufgabe 1 Berechne deine ungefähre Blutmenge: Mein Körpergewicht: Ungefähre Blutmenge: Aufgabe 2 Vervollständige die folgende Abbildung «Blut als Transportmittel». Aufgabe 3: Beantworte die folgenden Fragen: a) Welche Blutgruppen gibt es? . b) Welches ist die häufigste Blutgruppe in der Schweiz? . c) Rein theoretisch könnten die roten Blutzellen einer bestimmten Blutgruppe auf das Blut aller andern Blutgruppen übertragen werden («Universalspender»). Die Blutzellen welcher Blutgruppe? . Biologie: Humanbiologie d) Rein theoretisch könnte das Blut einer bestimmten Blutgruppe rote Blutzellen aller anderen Blutgruppen aufnehmen («Universalempfänger»). Das Blut welcher Blutgruppe? . Aufgabe 4 Schreibe die folgenden 5 Sätze in der richtigen Reihenfolge zur den Abbildungen hin: 1. 2. 3. 4. 5. Biologie: Humanbiologie Aufgabe 5 Blut besteht zum grösseren Teil aus Plasma, einer gelblichen Flüssigkeit, die hauptsächlich Wasser enthält. Neben bzw. in dem Plasma sind unterschiedliche Typen von Blutzellen enthalten. Durch Zentrifugieren kann man das Plasma von den Blutzellen trennen – durch die schnelle Kreisbewegung bewegen sich die festen und den flüssigen Teilen des Blutes auseinander. Fülle die leeren Kästen in der folgenden Abbildung «Zusammensetzung des Blutes». Aufgabe 6 Schreibe sechs wichtige Funktionen des Blutes auf: 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . Biologie: Humanbiologie Aufgabe 7 Benenne die Bestandteile des Blutes und deren Aufgaben! Biologie: Humanbiologie Aufgabe 8 Ergänze den Lückentext «Blut, ein ganz besonderer Saft» mit folgenden Begriffen: Biologie: Humanbiologie Aufgabe 9 Vervollständige die folgenden tabellarischen Streckbriefe mit den wichtigsten Informationen zum Text «Bestandteile des Blutes». Rote Blutkörperche Grösse Anzahl Lebensdauer Funktion(en) Weisse Blutkörperche Grösse Anzahl Lebensdauer Funktion(en) Blutplättchen Grösse Anzahl Lebensdauer Funktion(en)