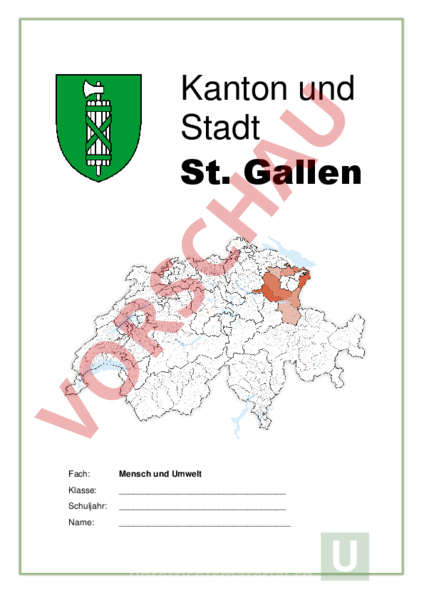Arbeitsblatt: M&U Stadt und Kanton St. Gallen
Material-Details
ausführliches Dossier zum Thema Kanton und Stadt St. Gallen
Geographie
Schweiz
5. Schuljahr
27 Seiten
Statistik
167125
7010
288
18.12.2016
Autor/in
Bettina Wagner
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Kanton und Stadt St. Gallen Fach: Mensch und Umwelt Klasse: Schuljahr: Name: Kanton und Stadt St. Gallen INHALTE UND LERNZIELE Nr. 1 2 3 4 5 6 7 BEWAG 2016 Titel Zahlen und Fakten Ich kenne die wichtigsten Eckdaten von St. Gallen (Fläche, Einwohnerzahl etc.). Ich kann den Umriss von St. Gallen grob skizzieren und finde den Kanton auf der Schweizerkarte. Ich kenne die Nachbarn von St. Gallen. Das St. Galler Kantonswappen Ich kenne die Bedeutung der Farben und Symbole des St. Galler Kantonswappens. Die Geografie St. Gallens Ich weiss, warum sich Regionen bilden können. Ich kenne die fünf Regionen des Kantons St. Gallen. Besiedelung und Verkehr Ich kenne die grössten Orte des Kantons St. Gallen und weiss, wo sich Flugplätze, Bergbahnen etc. befinden. Stadt St. Gallen Ich kenne Zahlen und Fakten zur Stadt St. Gallen (Einwohnerzahl, wichtige Gebäude, Bedeutung des Namens von St. Gallen, Wappen,). Ich weiss, was eine Legende ist und kann die Legende von Gallus und dem Bär in meinen eigenen Worten erzählen. Ich weiss, wer Gallus war und warum er so wichtig ist in der St. Galler Stadtgeschichte. Ich kann die Entwicklung der Stadtgeschichte mit Hilfe von Bildern kurz beschreiben. Ich weiss, was die Aufgaben der Klöster und Mönche waren (Zentrum für). Ich kenne wichtige Gebäude und Orte bzw. Sehenswürdigkeiten in der Stadt St. Gallen und kann einige Fakten zu ihnen erzählen (Kathedrale, Stiftsbibliothek, Karlstor, Gallusplatz, ). Ich weiss, was Erker sind und kenne ihren Nutzen. Sehenswürdigkeiten Ich kenne mindestens fünf Sehenswürdigkeiten in und rund um die Stadt St. Gallen. Wissens-Check Seite 3-5 6 7-13 14 15-24 25 26-27 2 1 Lernziel: St. Gallen Zahlen und Fakten Ich kenne die wichtigsten Eckdaten von St. Gallen (Fläche, Einwohnerzahl etc.). Ich kann den Umriss von St. Gallen grob skizzieren und finde den Kanton auf der Schweizerkarte. Ich kenne die Nachbarn von St. Gallen. Im Jahre 613 baute der heilige Gallus am Flüsschen Steinach eine Art Kapelle. Auf diesen Mönch geht auch der Name „St. Gallen zurück. Im Jahr 2003 feierte der Kanton sein 200 jähriges Jubiläum. Napoleon bestimmte damals die noch heute gültigen Kantonsgrenzen. St. Gallen war ab diesem Zeitpunkt ein eigenständiger Kanton in der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 1. Fülle den Steckbrief über den Kanton St. Gallen aus. Steckbrief Lage: Der Kanton St. Gallen liegt in der ; im Gebiet der . Kürzel: Amtssprache: Fläche: (Rang der Schweiz)! Einwohnerzahl: Bevölkerungsdichte: Hauptort: Regierungssitz: Grösste Stadt: Höchster Punkt: Tiefster Punkt: Eintritt in den Bund: Berge Flüsse BEWAG 2016 Die wichtigsten Berge im Kanton sind: Die wichtigsten Flüsse im Kanton sind: 3 Seen Teile vom, und Die Nachbarn von St. Gallen St. Gallen grenzt an drei Länder: im Norden an und im Osten an und das . Dersee, see undsee liegen teilweise auf dem Gebiet des Kantons. Der Bodensee gehört zur , und zu einem grossen Teil zu Deutschland; der Walensee liegt zu etwa gleichen Teilen in und St. Gallen. Den Zürichsee schliesslich teilen sich die Kantone , St. Gallen und , dem der grösste Teil gehört. 2. Bezeichne mit Hilfe der St. Galler Schulkarte auf der untenstehenden Karte die Nachbarländer, die Nachbarkantone und die Seen. BEWAG 2016 4 Der Kanton St. Gallen in seiner heutigen Form wurde am 19. März gegründet. Im Kanton St. Gallen leben rund Einwohner auf einer Fläche von Quadratkilometern (ca. 202‘600 Fussballfelder gross). Damit ist St. Gallen flächenmässig der Kanton der Schweiz (nach Bern, Graubünden, Wallis, Waadt und Tessin), bevölkerungsmässig der fünftgrösste (nach Zürich, Bern, Waadt und Aargau). 3. Lies im Buch „St. Gallerland die Seiten 12 und 13 durch und streiche wichtige Stellen an. 4. Beschrifte auf der Karte unten die Nachbarländer, Nachbarkantone, Seen, Flüsse sowie Berge mit Hilfe der St. Galler Schulkarte. BEWAG 2016 5 2 Lernziel: St. Gallen Das St. Galler Kantonswappen Ich kenne die Bedeutung der Farben und Symbole des St. Galler Kantonswappens. Das Kantonswappen Das grüne St. Galler Wappen besteht ursprünglich aus einem Bündel mit acht Stäben (Ruten), in deren Mitte ein Beil eingeschlossen ist. Die Ruten symbolisieren die acht Bezirke (heute nur noch fünf sichtbar), aus denen sich der Kanton laut der ersten Kantonsverfassung von 1803 zusammensetzte. Das Rutenbündel (Fasces) im St. Galler Wappen stammt aus dem antiken Rom. Wenn Richter oder hohe Beamte öffentlich auftraten, gingen ihnen zwei oder mehr Leibwächter voran. Diese trugen als Symbol der Gerichtsgewalt ein Rutenbündel mit einem Beil. Die Bänder standen für den Zusammenhalt und das Beil für die gemeinsame Stärke. Die Farbe Grün galt 1803 als Farbe der Freiheit. Weiss deutete man als Farbe der Unschuld: der neue Staat sollte die Ungerechtigkeit der alten Zeit überwinden. 5. Lies die Seite 108 im Buch „St. Gallerland durch und streiche wichtige Stellen an. 6. Male das St. Galler Kantonswappen richtig aus und schreibe unten auf, wofür die einzelnen Symbole des Wappens stehen. Erklärung des Wappens Grün bedeutet Das Beil bedeutet Die fünf Stäbe stehen für die Regionen im Kanton St. Gallen BEWAG 2016 6 3 Lernziel: St. Gallen Die Geografie St. Gallens Ich weiss, warum sich Regionen bilden können. Ich kenne die fünf Regionen des Kantons St. Gallen. Die Gliederung der Landschaft Zwei Landschaftstypen prägen den Kanton St. Gallen: Die Alpen im Süden und das Mittelland im Norden. Der höchste Punkt St. Gallens ist der Ringelspitz (3247 Meter über Meer) an der Grenze zum Kanton Graubünden. Der tiefste Punkt liegt am Bodenseeufer (Steinach) auf einer Höhe von rund 396 Metern über Meer. Etwas mehr als die Hälfte der St. Galler Bevölkerung lebt in den breiten Tälern im Süden des Kantons: im Rheintal, Seeztal, der Linthebene und dem Toggenburg. Durch diese Täler fliessen die wichtigsten Flüsse St. Gallens, nämlich der Rhein, die Thur (im Toggenburg), die Linth und die Seez. Der Norden des Kantons St. Gallen ist eine Hügellandschaft, geformt von Gletschern, die bei ihrem Rückzug Schutt als kleine und grosse Hügel zurückgelassen haben. Die Altstadt von Wil passt sich einem solchen Schutthügel an. Kleinere Hügel von einigen zehn Metern Höhe prägen die Landschaft von Wittenbach über Häggenschwil und Waldkirch bis Niederbüren. Beim Rückgang der Gletscher hat sich das viele Schmelzwasser tief in die weiche und kaum bewachsene Unterlage eingefressen und so die Einschnitte der Flüsse Sitter, Glatt, Goldach und Steinach gebildet. Die durchschnittliche Jahrestemperatur St.Gallen laut Meteo Schweiz 7,4 Grad. beträgt in Der Kanton St. Gallen besteht aus 85 Gemeinden. Sie sind in acht Wahlkreise aufgeteilt. Diese sind: St. Gallen, Rorschach, Rheintal, Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg und Wil. 7. Lies die Seiten 32 und 33 im St. Gallerland durch und notiere anschliessend, aus welchen Gründen sich Regionen bilden können. Beantworte auch die Fragen in der Box rechts unten auf einem Beiblatt. Vergiss den Titel nicht! BEWAG 2016 7 8. Fülle die Tabellen mit Hilfe der St. Galler Schulkarte aus. Bemale die Seen und Flüsse mit blauer Farbe. 9. Aufgabe: Beschrifte mit Hilfe der St. Galler Karte auf der Karte oben die fünf Regionen und male jede Region mit einer anderen Farbstiftfarbe aus. BEWAG 2016 8 Die Regionen des St. Gallerlandes 10. a. Welche Region ist gesucht? Schaue dir die Bilder unten an und überlege dir, um welche Region es sich handeln könnte. Schreibe den Namen der Region in die oberste leere Zeile der Tabelle. b. Lies die Seiten 58 bis 60 im Buch „St. Gallerland durch. c. Fülle die Tabelle mit Hilfe des Buches „St. Gallerland (s. 58 60) aus. In welchem Teil des Kantons liegt diese Region? Landschaftsmerkmale: Besiedelung: Wichtige sowie besondere Orte Wahrzeichen: Veranstaltungen Attraktionen besondere Bräuche sowie Traditionen: Besonderes: BEWAG 2016 9 Die Regionen des St. Gallerlandes 11. a. Welche Region ist gesucht? Schaue dir die Bilder unten an und überlege dir, um welche Region es sich handeln könnte. Schreibe den Namen der Region in die oberste leere Zeile der Tabelle. b. Lies die Seiten 64 bis 67 im Buch „St. Gallerland durch. c. Fülle die Tabelle mit Hilfe des Buches „St. Gallerland (s. 64 67) aus. In welchem Teil des Kantons liegt diese Region? Landschaftsmerkmale: Besiedelung: Wichtige sowie besondere Orte Wahrzeichen: Veranstaltungen Attraktionen besondere Bräuche sowie Traditionen: Besonderes: BEWAG 2016 10 Die Regionen des St. Gallerlandes 12. a. Welche Region ist gesucht? Schaue dir die Bilder unten an und überlege dir, um welche Region es sich handeln könnte. Schreibe den Namen der Region in die oberste leere Zeile der Tabelle. b. Lies die Seiten 52 und 53 im Buch „St. Gallerland durch. c. Fülle die Tabelle mit Hilfe des Buches „St. Gallerland (s. 52/53) aus. In welchem Teil des Kantons liegt diese Region? Landschaftsmerkmale: Besiedelung: Wichtige sowie besondere Orte Wahrzeichen: Veranstaltungen Attraktionen besondere Bräuche sowie Traditionen: Besonderes: BEWAG 2016 11 Die Regionen des St. Gallerlandes 13. a. Welche Region ist gesucht? Schaue dir die Bilder unten an und überlege dir, um welche Region es sich handeln könnte. Schreibe den Namen der Region in die oberste leere Zeile der Tabelle. b. Lies die Seiten 70 und 71 im Buch „St. Gallerland durch. c. Fülle die Tabelle mit Hilfe des Buches „St. Gallerland (s. 70/71) aus. In welchem Teil des Kantons liegt diese Region? Landschaftsmerkmale: Besiedelung: Wichtige sowie besondere Orte Wahrzeichen: Veranstaltungen Attraktionen besondere Bräuche sowie Traditionen: Besonderes: BEWAG 2016 12 Die Regionen des St. Gallerlandes 14. a. Welche Region ist gesucht? Schaue dir die Bilder unten an und überlege dir, um welche Region es sich handeln könnte. Schreibe den Namen der Region in die oberste leere Zeile der Tabelle. b. Lies die Seiten 34 bis 37 im Buch „St. Gallerland durch. c. Fülle die Tabelle mit Hilfe des Buches „St. Gallerland (s. 34 37) aus. In welchem Teil des Kantons liegt diese Region? Landschaftsmerkmale: Besiedelung: Wichtige sowie besondere Orte Wahrzeichen: Veranstaltungen Attraktionen besondere Bräuche sowie Traditionen: Besonderes: BEWAG 2016 13 4 Lernziel: BEWAG 2016 St. Gallen Besiedelung und Verkehr Ich kenne die grössten Orte des Kantons St. Gallen und weiss, wo sich Flugplätze, Bergbahnen etc. befinden. 14 5 Lernziel: St. Gallen Stadt St. Gallen Ich kenne Zahlen und Fakten zur Stadt St. Gallen (Einwohnerzahl, wichtige Gebäude, Bedeutung des Namens von St. Gallen, Wappen,). Ich weiss, was eine Legende ist und kann die Legende von Gallus und dem Bär in meinen eigenen Worten erzählen. Ich weiss, wer Gallus war und warum er so wichtig ist in der St. Galler Stadtgeschichte. Ich kann die Entwicklung der Stadtgeschichte mit Hilfe von Bildern kurz beschreiben. Ich weiss, was die Aufgaben der Klöster und Mönche waren (Zentrum für). Ich kenne wichtige Gebäude und Orte bzw. Sehenswürdigkeiten in der Stadt St. Gallen und kann einige Fakten zu ihnen erzählen (Kathedrale, Stiftsbibliothek, Karlstor, Gallusplatz, ). Ich weiss, was Erker sind und kenne ihren Nutzen. Die Kantonshauptstadt St. Gallen Die Stadt St. Gallen (schweizerdeutsch Sanggale, französisch Saint-Gall, italienisch San Gallo, rätoromanisch Sogn Gagl) ist eine politische Gemeinde und der namensgebende Hauptort des ostschweizerischen Kantons St. Gallen. St. Gallen zählt rund 80�00 Einwohner und ist mit rund 700 ü. M. eine der höher gelegenen Städte der Schweiz. St. Gallen liegt an der Steinach, einem Fluss, der in den Bodensee mündet. Die Stadt liegt an den Hauptverkehrsachsen (München–)St. Margrethen– Rorschach–St. Gallen–Winterthur–Zürich und (Konstanz– )Romanshorn–St. Gallen–Rapperswil–Luzern und gilt als Tor ins Appenzellerland. Touristisch interessant ist die Stadt aufgrund der Stiftskirche und der Stiftsbibliothek, von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. St. Gallen ist auch für seine Stickereien bekannt. Zu sehen sind diese heute im Textilmuseum St. Gallen, das sich der Geschichte der Ostschweizer Textilindustrie widmet. BEWAG 2016 15 Wappen Das Wappen der Stadt St. Gallen erinnert an die Legende von Gallus und dem Bären. Es zeigt einen aufrecht stehenden, männlichen Bären mit einem goldenen Halsband. Kaiser Friedrich III. hatte im Jahre 1475 der Stadt das Privileg zugesprochen, ihrem Bären ein goldenes Halsband umzuhängen, als Dank für die Unterstützung in den Burgunderkriegen. Deutlich sind die Klauen, die Zähne und das Geschlechtskennzeichen zu sehen. 15. Lies die Seiten 36 und 37 im St. Gallerland durch und beantworte anschliessend die folgenden Fragen in ganzen Sätzen auf ein Beiblatt. Vergiss den Titel sowie deinen Namen nicht und achte auf Sorgfältigkeit! a. b. c. d. e. f. g. h. i. Wie hoch liegt die Stadt St. Gallen? Wie viele Einwohner leben ungefähr in der Stadt St. Gallen? Wie hiess der Mönch, der das Kloster St. Gallen gründete? Zwischen welchen beiden Hügeln liegt die Stadt St. Gallen? Welche wichtigen grossen Schulen liegen in der Stadt St. Gallen? Wie viele Messen bzw. Ausstellungen finden jährlich auf dem Olma-Areal statt? Welches ist die berühmteste Messe in St. Gallen? Wie viele Patientinnen und Patienten werden jährlich im Kantonsspital SG behandelt? Warum reisen viele Touristen nach St. Gallen? Was wollen sie sich anschauen? Die Legende von Gallus und dem Bär Was ist eine Legende? Das Wort Legende ist lateinisch. Es bedeutet: Das, was man Lesen soll. Legenden waren ursprünglich mittelalterliche Lebensgeschichten von Heiligen, die in der Kirche vorgelesen wurden. Die meisten Menschen konnten damals nämlich nicht selber lesen. Deshalb waren sie froh, wenn der Pfarrer ihnen Geschichten erzählte. Bei Legenden handelt es sich um Erzählungen und nicht um historische Tatsachenberichte. Was an der Legende vom Heiligen Gallus stimmt und was nicht, bleibt offen. Sicher aber ist, dass es eine uralte Geschichte ist, die bei uns schon vor mehr als tausend Jahren erzählt wurde. Immerhin wird in ihr erklärt, wie das Kloster entstanden sein soll. Auch Sankt ist lateinisch und bedeutet heilig. St. Gallen heisst also bis heute „Heiliger Gallus. Vorgeschichte St. Gallen im Hochtale der Steinach, eine halbe Stunde vom Bodensee entfernt, verdankt seinen Namen und Entstehung dem Heiligen Gallus. Dieser grosse Heilige stammte aus Irland und stellte sich dort im Kloster Bangor unter die Leitung des Heiligen Kolumban. Er begleitete ihn als Mönch und Priester mit elf Brüdern nach Gallien (heutiges Frankreich). Er teilte treuherzig die Schicksale seines Lehrers, seine Vertreibung aus Burgund und seine Wanderungin die östliche Schweiz. Sie siedelten sich am südlichen Ende des Zürichsees bei Tuggen an, um den dortigen Heiden (Nichtchristen) das Evangelium zu verkünden. Allein die Tuggener gaben zur Antwort: „Unsere alten Götter haben uns und unsere Väter mit Regen wohl versehen. Wir wollen sie nicht verlassen. Sie regieren wohl. Hierauf brachten sie ihren Götzen Opfer. Da geriet Gallus in Eifer und legte Feuer an den Götterhain (Ort, wo man Götter verehrt). Dies erregte den Zorn der Leute von Tuggen. Sie wollten Gallus ermorden. Die Missionare vom Tode bedroht, mussten flüchten. Sie fanden freundliche Aufnahme bei Pfarrer Willimar in Arbon am Bodensee, bauten sich einige Mönchszellen (Räume) bei Bregenz und legten dort den Grund zu einem Kloster. Da inzwischen Alemannien (früheres Deutschland) in die Hände des Königs von Burgund kam, einem Feind des Heiligen Kolumban, wanderte er mit den Brüdern nach Italien aus. Gallus war zu diesem Zeitpunkt krank und musste deshalb in Arbon zurückbleiben, wo er unter sorgsamer Pflege gesund wurde. BEWAG 2016 16 Gallus und der Bär Gallus und ein weiterer Mönch, Hildibald, erkundeten oft die Gegend rund um Arbon. Eines Tages kamen sie durch eine waldreiche Gegend, wo das Flüsschen Steinach von einem Felsen herabstürzt und im Laufe der Zeit ein Becken in den Felsen ausgehöhlt hatte, das einen kleinen Fischweiher bildete. Sie fingen einige Fische und brieten sie am Feuer. Nach dem spärlichen Mahle zog sich Gallus einige Schritte in den Wald hinein und stolperte 16. Wie geht die Geschichte von Gallus und dem Bär weiter? Schreibe sie hier in deinen eigenen Worten auf. Tipp: Schau auf der Seite 39 im St. Gallerland! Vom Wachsen der Stadt St. Gallen 17. Lies die Seiten 38 und 39 im St. Gallerland durch. Suche in den Abschnitten nach Schlüsselwörtern. Fasse die Entwicklung zu jedem Bild stichwortartig in vier Schritten auf der folgenden Seite zusammen. BEWAG 2016 17 BEWAG 2016 18 Entdeckungsreise in der St. Galler Altstadt Die St. Galler Altstadt Stiftsbezirk 18. Lies die Seite 40 im St. Gallerland durch. Bezeichne danach mit den vorgegebenen Farben die folgenden Gebäude und Orte in der Karte: a) Kathedrale (rot) b) Calatrava Wartehalle am Bohl (orange) c) Waaghaus (gelb) d) Karlstor (hellgrün) e) Haupt-Einkaufsstrasse von St. Gallen (dunkelgrün) f) Vadian-Denkmal (hellblau) g) Gallusplatz (dunkelblau) h) St. Laurenzen Kirche (violett) i) Kirche St. Mangen (pink) Kloster St. Gallen – Ein Leben hinter Klostermauern 19. Lies die Seite 102 im St. Gallerland durch und beantworte die Fragen in der gelben Box auf einem Beiblatt. Die Geschichte des Klosters beginnt mit Gallus, der sich 612 im Steinachtal niederliess. Bald schon sammelten sich Schüler um ihn, die auch nach seinem Tod (an einem 16. Oktober um 640) eine Gemeinschaft bildeten. Der Priester Otmar führte am Gallusgrab das Klosterleben ein, das sich später nach der Benediktsregel ausrichtete. Es wurden Wohnstätten für die Mönche, eine Kirche aus Stein, eine Herberge für Arme und ein Haus für Aussätzige gebaut. Die Schenkung umfangreichen Landes durch alemannische Einwohner brachte dem Kloster bedeutenden Grundbesitz. Vom 9. bis 11. Jahrhundert entwickelte sich das Kloster zu einer der wichtigsten Kultur- und Bildungsstätten nördlich der Alpen. In der Schreibwerkstatt entstanden Bücher von einmaliger Ausführung. Wahrzeichen von St.Gallen ist die barocke Kathedrale mit der Stiftsbibliothek, in der 170�00 zum Teil handgeschriebene und über tausendjährige Dokumente aufbewahrt werden. BEWAG 2016 19 Religiöses Zentrum Im Mittelalter wählten Menschen ein Leben im Kloster aus verschiedenen Gründen: Starker Glaube an Gott, Adeliger ohne Erbschaft, Versorgung und Schutz. Die Regeln des Ordens gaben den Mönchen eine klare Tagesordnung vor und das Alltagsleben der Mönche wurde durch das Gebet und die Arbeit stark geprägt. Sie standen um zwei Uhr auf, beteten und sangen siebenmal am Tag, assen zweimal warm und arbeiteten dazwischen hart. Im Benediktinerkloster war der Tagesablauf durch strenge Regeln des heiligen Benedikt bestimmt. Die Mönche lebten nach drei Gelübden: Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam gegenüber dem Abt, dem Klosterführer, und ihrem obersten Grundsatz, der lautet: „Ora et labora! („Bete und arbeite!). Bei groben Regelverstößen wurden die Mönche vom Abt aus dem Kloster verbannt. Die Benediktinerregel bildete auch die Grundlage für Frauenklöster, deren Vorschriften meist noch strenger ausfielen.Der Mönch besass kein privates Eigentum, er wurde aus dem Klosterbesitz mit allem Notwendigen versorgt. In der Klosterkirche gab es regelmässig Gottesdienste für die Bevölkerung. Die Menschen im Mittelalter waren wesentlich enger mit Gott verbunden als heute. Sie erflehten Segen für Hütten und Häuser, reiche Ernten oder das Gelingen eines guten Geschäftes. Das Kloster war Mittelpunkt der Seelsorge. Zentrum für Medizin und soziale Tätigkeit Das Kloster war auch ein Ort der Nächstenliebe: Oft war es die einzige Hilfe für Kranke und Arme. Gerade in den Städten des Mittelalters gab es viele Krankheiten und Seuchen. Die Menschen lebten auf engstem Raum und die Hygiene war sehr schlecht. Der Pförtner kümmerte sich um die Armen. Hierfür 1 wurde aller Einkünfte zur Verfügung gestellt. Die Armen 10 wurden mit Nahrung, Kleidung und selten auch mit Geld versorgt. In besonderen Fällen wurden sie auch für kurze Zeit im Kloster aufgenommen – hierzu musste aber zuerst die traditionelle Fusswaschung vorangehen. Die Sorge für die Kranken selbst lag im frühen Mittelalter ausschliesslich in den Händen der Geistlichkeit, vor allem der Mönche, die häufig medizinisches Wissen und Erfahrung in der Krankenpflege besassen. Die Mönche, und die Nonnen in Frauenklöstern, stellten Medizin und Salben selbst her. Die Heilpflanzen dafür bauten sie ebenfalls an. Den grösseren Klöstern, deren Hauptaufgabe die Seelsorge darstellte, war meist ein Spital angegliedert. Hier konnten Kranke Zuflucht suchen, doch nahm man auch Schwache, Bedürftige, Arme und Waisen auf. Klöster beherbergten auch Reisende. Sie fanden dort Ruhe und Verpflegung und konnten sich auf das Gebet konzentrieren. Zentrum für Wirtschaft Die Klöster waren nicht nur Orte des Gottesdienstes, sondern auch selbstständige Wirtschaftsbetriebe. So waren sie von der restlichen Bevölkerung relativ unabhängig und konnten sich selbst versorgen. Die Klöster besassen ihre eigenen Ländereien, die meist durch Schenkungen in ihren Besitz kamen. Schenkungen an Klöster waren in der damaligen Zeit weit verbreitet. Man tat es um Gott zu gefallen und die Klöster zu unterstützen, aber auch um die politische Macht der Kirche und der Klöster zu stärken. Klöster besassen neben dem eigentlichen Hauptgebäude eine Reihe von Wirtschaftsgebäuden, z.B. Werkstätten wie Schmiede, Wagnerei (Herstellung und Reparatur von Wagen), Küferei (Herstellung von hölzernen Gefässen) und Mühle, Brauereien, Bäckereien, Viehställe und Gärten. Die Mönche hatten eine eigene Landwirtschaft und trieben Handel mit Wein und Salz. Der Unterhalt der Klöster wurde durch den Verkauf von Wirtschaftsprodukten finanziert, sowie durch die Verpachtung von Grundbesitz. Die Pächter mussten Abgaben leisten und meist auch Frondienste. Die Mönche arbeiteten auf dem Feld, rodeten Wälder und legten Sümpfe trocken. Sie gründeten Dörfer und zeigten den Bauern, wie man Ackerland gewinnt und BEWAG 2016 20 ein landwirtschaftliches Gut führt. Als Wirtschaftsbetrieb waren die Klöster Musterbetriebe für die gesamte Umgebung. Zentrum für Bildung und Kultur Bis zum 12.Jahrhundert lag das Bildungswesen ausschliesslich in den Händen der Kirche. Bis auf wenige Ausnahmen, konnten nur die Mönche und Nonnen in den Klöstern Lesen und Schreiben. Dadurch konnten nur sie diese Fähigkeiten weitervermitteln. Die wohlhabende Gesellschaft schickte ihre Kinder in Klöster, um dort das Lesen und Schreiben zu erlernen. Die Klöster erhielten dafür Ländereien und finanzielle Unterstützung. Eine Schulpflicht bestand nicht. Die Klosterschulen waren für die Öffentlichkeit verschlossen, aber nicht nur Söhne und Töchter von Adeligen wurden aufgenommen, sondern auch begabte Bauernkinder. Die Schüler, welche später selbst Mönch oder Nonne werden sollten, nannte man Novizen. Der Schulalltag der Klosterschüler begann erst im Alter von sieben Jahren und dauerte acht Jahre an. Neben schulischen Tätigkeiten wurden z.B. auch Feldarbeiten verrichtet; dadurch hatten die Kinder fast keine Freizeit. Es wurde Lesen und Schreiben in lateinischer Sprache und eher selten auch Mathematik unterrichtet. Die Lehrer konnten über den Lehrstoff selbst frei entscheiden, da keine Lehrpläne vorhanden waren. Die Prügelstrafe war auch in Klöstern erlaubt und allgegenwärtig. Die Mönche schrieben Bücher und Bibeln mit der Hand ab und bemalten die Seiten kunstvoll. Die meisten Bücher im Mittelalter hatten Bibeltexte zum Inhalt. Die Mönche verwendeten Tierhäute als Papier, die getrocknet und geglättet wurden. Man nannte sie Pergament. Auf das Pergament zogen die Mönche vorsichtig Linien, damit jeder Buchstabe seinen eigenen Platz hatte. Als Schreibwerkzeug wurden Federn und Tinte gebraucht. Um die Anfangsbuchstaben auszumalen, verwendeten die Mönche feine Pinsel und dicke Farben. Eine Bibel, die auf Pergament geschrieben war, kostete damals mehr als ein kleines Bauernhaus! 20. Schau dir das Alphabet genau an. Es zeigt eine Schrift aus dem Mittelalter. Versuche auf einem separaten Blatt einige Buchstaben zu schreiben. Kannst du deinen Namen in mittelalterlicher Schrift schreiben? BEWAG 2016 21 21. Erstelle eine Zusammenfassung des gelesenen Textes über das Klosterleben, indem du dieses Mindmap erweiterst und vollständig ausfüllst. BEWAG 2016 22 BEWAG 2016 23 Die Stiftsbibliothek Die Stiftsbibliothek St.Gallen ist die älteste Bibliothek der Schweiz und eine der grössten und ältesten Klosterbibliotheken der Welt. Ihr ausserordentlich wertvoller Bücherbestand, der den bedeutendsten Handschriftenkorpus der Schweiz aus dem Mittelalter darstellt, dokumentiert die Entwicklung der europäischen Kultur und offenbart die kulturelle Leistung des Klosters St.Gallen vom 8. Jahrhundert bis zur Aufhebung der Abtei im Jahr 1805. Die Stiftsbibliothek ist auch eine moderne wissenschaftliche Bibliothek mit Ausrichtung auf die Epoche des Mittelalters. Die Stiftsbibliothek ist heute eine aktive Leihbibliothek. Sie besitzt rund 170‘000 Bücher und andere Medien, von denen die nach 1900 erschienenen Dokumente ausgeliehen werden können. Die Stiftsbibliothek beherbergt die wissenschaftlichen und literarischen Handschriften der ehemaligen Abtei. Diese decken den Zeitraum von zirka 400 bis 1805 ab. Kern des Bestandes sind die rund 2�00 Handschriften, von denen viele aus dem St.Galler Skriptorium (Schreibwerkstatt) stammen. Als besonderer Publikumsmagnet gilt – obwohl eigentlich gar nicht zum Umfeld passend – Schepenese, eine ägyptische Mumie. Die Erker Insgesamt sind noch 111 dieser Erker in der Stadt erhalten. Eine Erker-Bau-Blüte erlebte St.Gallen etwa zwischen 1650 und 1720, damals entstanden viele der heute noch bestehenden Erker mit blühenden Namen wie Kamelerker, Pelikanerker, Schwanenerker etc. Erker waren seit jeher weit mehr als Vorsprünge von der Aussenwand. Erker schufen Licht und Raum, waren aber vor allem eines: Statussymbol. Wo ein Haus einen Erker trug, wohnten Leute mit viel Geld. Das Karlstor Es ist das einzig erhaltene und reichste der einst acht St.Galler Stadttore. Nach Absprachen mit der Stadt wurde das Tor 1569/70 errichtet. Der Durchlass ist benannt nach Karl Borromäus, der anlässlich seiner Inspektionsreise durch das Schweizerland 1570 auch St.Gallen besuchte. Dabei hat er das Tor durchschritten, laut Legende als Erster überhaupt. Nach 1805 dienten die über dem Durchlass liegenden Etagen als Gefängnis, heute als Untersuchungsgefängnis des Kantons St. Gallen. Der Gallusplatz Am Gallusplatz nahm die städtische Siedlungsentwicklung ihren Anfang. Unmittelbar vor den Klostermauern liessen sich Handwerker und andere Leute nieder, die als erste St. Galler nicht zur klösterlichen Gemeinschaft gehörten. Ihre Siedlung, die bereits im 10. Jahrhundert belegt ist, dehnte sich allmählich in nördlicher Richtung aus. Mitten auf dem Platz erinnert ein Brunnen an den heiligen Gallus. Die Stadtkirche St. Laurenzen und Vadian Die evangelisch-reformierte Stadtkirche St. Laurenzen liegt in unmittelbarer Nähe des Stiftsbezirks und weist noch heute auf die einstige Rivalität zwischen der protestantischen (evangelischen) Stadt und dem katholischen Galluskloster hin. Über viele Jahrhunderte waren nämlich viele Teile der Stadt rund um das Kloster evangelisch, während dem im Kloster sowie in vielen Teilen des restlichen Kantons der Katholizismus gelebt wurde. Joachim Vadian verbreitete ab 1521 den evangelischen Glauben in der Stadt St. Gallen. Im Zentrum von St. Gallen erinnert heute ein Denkmal beim Marktplatz an Vadian. BEWAG 2016 24 6 Lernziel: St. Gallen Sehenswürdigkeiten Ich kenne mindestens fünf Sehenswürdigkeiten in und rund um die Stadt St. Gallen. 22. Wähle aus der Liste mindestens eine Sehenswürdigkeit des Kantons St. Gallen aus. Suche im Internet und in Büchern Informationen zu diesen Sehenswürdigkeiten. Erstelle ein Infoblatt (A4) bzw. einen Steckbrief zu den Sehenswürdigkeiten und stelle sie deiner Klasse vor. Freizeit Säntispark Abenteuerland Walter Zoo Textilmuseum St. Gallen Wildpark Peter und Paul Fliegermuseum Altenrhein Knies Kinderzoo Roter Platz St. Gallen Familien- und Gemeinschaftsbad Dreilinden (Drei Weihern) Universität St. Gallen Freizeitpark Niederbüren Theater St. Gallen Naturmuseum St. Gallen Historisches und Völkerkundemuseum Botanischer Garten St. Gallen Kunstmuseum Museum im Kornhaus Olma und weitere Messen FC St. Gallen Rock- und Pop Museum Saurer Museum Maestrani Schoggiland Mosterei Möhl Seilpark gründenmoos Cinedome Abtwil Kristallhöhle Kobelwald Planetenweg Fägnäscht – Indoor Spielplatz Flughafen Sitterdorf Kybun Park und Shopping Arena Taminaschlucht Feste, Bräuche und Kulinarisches 23. Lies die Seiten 122 bis 125 im St. Gallerland durch und beantworte die Fragen in der Box rechts unten auf einem Beiblatt. BEWAG 2016 25 7 St. Gallen Wissens-Check 24. Beantworte die nachfolgenden Fragen mit Hilfe des St. Gallerlandes, des Internets und dem Dossier über den Kanton und die Stadt St. Gallen. 1) Wie viele Einwohner hat der Kanton St. Gallen ungefähr? 2) Wie gross ist der Kanton? 3) Wie viel Mal grösser ist die ganze Schweiz als der Kanton? 4) Wie heissen die drei grossen Seen im Kanton? 5) Wie heissen die vier grossen Flüsse im Kanton? 6) Wie heisst der höchste Berg und wie hoch ist er? 7) Von welchem Berg ist das die Spitze? 8) Wie hoch ist dieser Berg? 9) Wie viele Einwohner hat die Stadt St. Gallen ungefähr? 10) Welches sind die drei grössten Städte im Kanton St. Gallen? 11) Wann wurde das Kloster St. Gallen erbaut? 12) Wie hoch sind die Türme des Klosters? 13) Was hat es in der Stiftsbibliothek ausser Büchern und Schriften auch noch? 14) Warum wurden in den Gassen von St. Gallen (zum Beispiel in der Spisergasse) die Häuser schmal und hoch gebaut? 15) Was für eine Funktion haben die Erker an den Häusern? 16) Welcher Platz gehört zum ältesten Stadtteil St. Gallens? 17) Wie heisst die bekannteste Einkaufsstrasse der Stadt? 18) Wie heissen die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt? 19) Zwischen welchen zwei Hügeln liegt die Stadt eingebettet? BEWAG 2016 26 20) Wie heisst der Tierpark bei St. Gallen? 21) Welche Tiere können dort in freier Natur beobachtet werden? 22) Warum sind die Drei Weihern im Sommer so beliebt? 23) Wie heissen die Brücken im Westen von St. Gallen? 24) Was mussten die Leute früher bei diesen Brücken zahlen? 25) Was bedeutet die Abkürzung „OLMA? 26) Wann findet die OLMA statt? 27) Was wird dort ausgestellt und angeboten? 28) Was kann man in der Hochschule St. Gallen (Universität) studieren? 29) Was ist das Open-Air-Festival und wo findet es statt? 30) Was hat dieses Bild mit St. Gallen zu tun? Welche Dinge und wer sind darauf dargestellt? Welche Bedeutung haben die einzelnen Elemente? BEWAG 2016 27