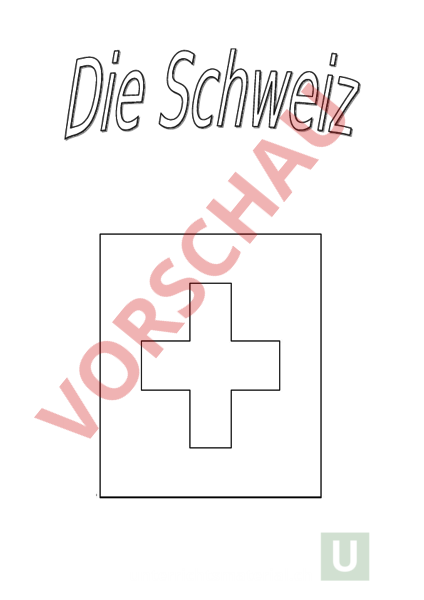Arbeitsblatt: Schweiz Geschichte
Material-Details
Von 1291 bis zum modernen Bundesstaat
Geographie
Schweiz
klassenübergreifend
19 Seiten
Statistik
167605
694
47
08.01.2017
Autor/in
Barbara Schüpbach
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Wichtige Jahreszahlen zur Schweiz 1291 1315 13321353 1386 14811513 Um 1500 1798 1815 1847 1848 1850 Rütlischwur Gründung der Eidgenossenschaft durch die drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden. Gründungsurkunde der Schweiz: Bundesbrief Schlacht bei Morgarten Erste Schlacht der Eidgenossen gegen die Habsburger. Sieg der Eidgenossen. Acht alte Orte Die Städte Zürich, Bern, Luzern, Glarus und Zug schliessen sich den drei Urkantonen an. Schlacht bei Sempach Höhepunkt des Konfliktes gegen die Habsburger. Die dreizehnörtige Eidgenossenschaft Als zugewandte Orte (Städte) kommen dazu: Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, Basel und Appenzell. Weisses Kreuz auf rotem Grund Die Eidgenossen führen diverse Kriege, die sie meistens gewinnen. Auf ihrer Kriegsrüstung tragen sie erstmals ein weisses Kreuz auf rotem Grund. Helvetische Republik Die Franzosen erobern unter Napoleon die Schweiz. Die alte Eidgenossenschaft bricht zusammen. An ihre Stelle tritt die helvetische Republik. Sie ist von Frankreich abhängig. Bundesvertrag Die Schweiz erhält die heutige Form. Die letzten Kantone treten bei. Alle Kantone sind nun gleichberechtigt. Die Grossmächte anerkennen die Neutralität der Schweiz. Sonderbundskrieg Der letzte schweizerische Bürgerkrieg. Bundesstaat Es gilt die Bundesverfassung und Bern wird zur Hauptstadt. Als neue Behörden werden Nationalrat, Ständerat und Bundesrat geschaffen. Einführung des Schweizer Frankens Die Schweiz vor 1291 Die Schweiz, wie wir sie heute kennen, gab es noch nicht. Das Gebiet der heutigen Schweiz gehörte zum deutschen Reich und unterstand dem deutschen Kaiser. Jedes Jahr schickte er einen Vogt, der Steuern einzog. Ein wichtiger Verdienstzweig waren Wegzölle. Als es den Menschen um 1200 herum gelang, einen Weg über den Gotthard zu erschliessen, erhöhten sich die Einnahmen massiv. Das machte die Gegend um den Gotthard für fremde Vögte und Könige interessant. Im Jahr 1273 wurde Rudolf I. von Habsburg zum König gewählt. Habsburgische Vögte verwalteten nun das Land. Sie verlangten überhöhte Steuern und das Volk verarmte. Als Rudolf I. 1291 starb, nutzten seine geplagten Untertanen in den Waldstätten die Gelegenheit zum Aufstand. Männer aus Uri, Schwyz und Unterwalden versammelten sich der Legende nach auf dem Rütli und schlossen einen ewigen Bund. Das war die Gründung der Schweiz. Der Gotthardpass Beschrifte die Wappen mit dem richtigen Kanton. Schreib auch die Orte und Gewässer an. Die Bedeutung des Gotthardpasses Um zu verstehen, was der Pass für den Verkehr so wichtig macht, muss man zuerst einmal die geographische Situation betrachten. Der Gotthard ist nämlich nicht ein einzelner Berg, sondern ein ganzes Gebirgsmassiv mit vielen Berggipfeln, Seen und Gletschern. Es liegt im Herzen der Schweiz und verbindet die Kantone Uri, Graubünden, Tessin und Wallis miteinander. Vier grosse Flüsse und Ströme entspringen in diesem Gebiet und fliessen in die verschiedenen Himmelsrichtungen: der Rhein nach Osten, die Rhône nach Westen, die Reuss nach Norden und der Tessin nach Süden. Zwei Seen der Vierwaldstättersee im Norden und der Lago Maggiore im Süden erleichterten den Zugang zum Passübergang in einer Zeit, als es noch keine Eisenbahn und keine Autos gab. Über den Gotthard wurde Vieh getrieben und mit Maultieren eine Menge Waren transportiert: Glas aus Venedig, Leinwand aus dem Aargau, Sensen aus Schwyz, Harnische aus Deutschland, Oliven und Olivenöl aus Sizilien, Rinder und Kühe aus Uri, Farbstoffe zum Färben der deutschen Tücher, Gewürze aus dem Morgenland, Schmuck aus Rom, Weihrauchkörner aus dem Osten, Käse aus dem Luzernerland, Samt und Seide aus Florenz, Reis, Meerfische aus den Niederlanden, Schlösser und Schlüssel aus Schwaben. Vor der Eröffnung des Saumpfades über den Gotthard, hatten die Bauern in den Tälern um den Vierwaldstättersee ein freies Leben geführt, weit ab von der Politik der grossen Reiche. Nun war es mit der Ruhe vorbei. Rasch hatte sich herumgesprochen, dass es einen neuen, kürzeren und schnelleren Weg vom Norden in den Süden gab. Von Jahr zu Jahr nahm die Zahl der Reisenden zu, die über den Gotthardpass zogen. Den hier ansässigen Menschen, die sich ihr Leben bisher allein als Bergbauern verdient hatten, eröffneten sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Die Wegzölle, die damals für alle Reisenden und alle Handelsgüter erhoben wurden, brachten reiche Einnahmen. Wer über den Pass wollte, musste berggewohnte Saumtiere für sein Gepäck oder seine Waren mieten, und wer es sich leisten konnte, warb sogar Träger an, die ihn in einer Sänfte über den Gotthard brachten. Welche Waren wurden von Norden nach Süden oder umgekehrt transportiert? Schreibe deine Antworten auf die richtige Seite der Tabelle. Beantworte folgende Fragen: a. Welche Kantone verbindet der Gotthard? b. Welche Flüsse entspringen im Gotthardgebiet und in welche Himmelsrichtung fliessen sie? c. Wieso erleichterten früher der Lago Maggiore und der Vierwaldstättersee den Zugang zum Pass? . d. Zwischen welchen Regionen ist der Gotthard auch heute noch die leichteste und kürzeste Verbindung? e. Wieso hatten die Habsburger Interesse am Gotthardpass? Schreib einen Satz. f. Was feiert die Schweiz jedes Jahr am 1. August? Der Rütlischwur Die Menschen im Urnerland waren weit entfernt von den grossen Städten; sie hatten bis anhin in Ruhe gelebt. Doch nun brachen für sie unruhige Zeiten an. Der habsburgische König, er hiess, sandte_ in die Untertanengebiete; diese sollten für ihn die Bergtäler. Die Bauern wurden gezwungen, für ihre neuen Herren grosse zu bauen. Ausserdem mussten sie nun den_ Vögten Jahr für Jahr einen Teil ihrer abliefern. Die Bauern ärgerten sich darüber. Manchmal wurde ihre Wut so gross, dass sie sich dagegen auflehnten. Sie trafen sich heimlich am Abend und schmiedeten Pläne. Diese fanden in einem Privathaus statt, im Wohnzimmer der Familie . Eines Abends, als die Bauern wieder gemeinsam , brachte Frau Stauffacher folgenden Vorschlag ein: Alle der drei Gebiete Uri, Schwyz und Unterwalden sollten sich und sich auf ewig und schwören. Lückenwörter: verwalten, Burgen, Zusammenkünfte, Stauffacher, Rat hielten, Landvögte, Ernte, Treue, habgierigen, Bewohner, vereinigen, Hilfsbereitschaft, Rudolf Der Legende nach wurde die Eidgenossenschaft am 1. August 1291 auf dem Rütli besiegelt. Eines Abends, als der Mond schien, trafen sich viele Menschen aus den drei Bergtälern auf einer abgelegen Waldwiese. Der Ort war geheim; man nannte die Lichtung „Rütliwiese. Sie lag unterhalb des Dorfes Seelisberg, nahe beim Ufer des Vierwaldstättersees, an jenem Arm des Sees, den man Urnersee nennt. Die Menschen schworen, einander zu helfen und sich beizustehen. Sie wollten kämpfen, um ihre Freiheit und Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Sie schlossen also einen Bund und leisteten darauf einen Eid. Fortan wollten sie sich nun EidGenossen nennen. «. und kamen also ihrer drei zusammen, der Stoupacher zu Schwyz, und einer der Fürsten zu Uri und der aus Melche von Unterwalden, und klagte ein jeglicher dem anderen seine Not und seinen Kummer, . Und als die drei einander geschworen hatten, da suchten sie und fanden einen nid dem Wald, . und schwuren einander Treu und Wahrheit, und ihr Leben und ihr Gut zu wagen und sich der Herren zu erwehren. Und wenn sie etwas tun und vornehmen wollten, so fuhren sie für den Mythen Stein hin nachts an ein End, heisst im Rütli .» Hans Schriber, Weisses Buch zu Sarnen, um 1470, zitiert nach Chronik der Schweiz, S. 145) Der Bundesbrief von 1291 Der Bundesbrief, datiert auf Anfang August 1291, gilt in der traditionellen Geschichtsschreibung als eine oder gar als die Gründungsurkunde der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Der Bundesbrief von 1291 ist ein Vertrag zwischen den drei Ländern Uri, Schwyz und Unterwalden. Am Anfang des Monats August verbündeten sich diese drei Länder. Sie wollten auf diese Weise ihre Freiheitsrechte schützen. Er ist erhalten und im Bundesbriefmuseum in der Gemeinde Schwyz ausgestellt. Der Bundesbrief liegt als Pergamentblatt vor und umfasst 17 Zeilen in lateinischer Sprache und zwei verbundene Siegel. Das Siegel von Schwyz ging zwischen 1330 und 1920 verloren. Der Bund von 1291: einzigartig? In der Geschichte gibt es Fragen, die man nicht einfach mit ja oder nein beantworten kann. So ist es auch hier. Einzigartig war das Bündnis zur Sicherung von Friede und Ordnung in den Waldstätten keineswegs. Dutzende ähnlicher Bünde beweisen dies. Zwischen 1251 und 1386 gibt es über 80 Dokumente, mit denen ähnliche Bünde besiegelt wurden. Und doch: Im Unterschied zu vielen anderen Bündnissen ist der Bund der Waldstätten von 1291 bis in die Gegenwart weiterentwickelt worden. Spannendes über den Bundesbrief Der Bundesbrief von 1291 wurde erst im 18. Jahrhundert entdeckt. Doch erst im späten 19. Jahrhundert, genau 1891, schenkte man diesem Bundesbrief die Beachtung, die er heute geniesst. Jedes Jahr seit 1891 feiern wir den 1. August. Der Geburtstag der Schweiz. Zuvor wurde als Gründung der Schweiz meist ein Bund aus dem Jahr 1307 oder 1315 angesehen, denn für den Rütlischwur existiert auch das überlieferte Datum 8. November 1307. Zudem wird im Bundesbrief von 1291 auf ein früheres Abkommen Bezug genommen, dessen Text jedoch nicht erhalten geblieben ist. Bis 1966 erachtete man den Bundesbrief als echt und Erneuerung eines früheren Schreibens. Viele weisen nach 1966 dann darauf hin, dass der Bundesbrief mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Fälschung aus dem 14. Jahrhundert darstellt, wie sie im Mittelalter üblich waren. Rütlischwur und Bundesbrief Was stimmt und was ist falsch? Kreuze an, wenn du denkst, dass eine Aussage nicht stimmt. Die Sage von Wilhelm Tell Lies bitte folgende Textabschnitte. Schneide die texte und die Bilder aus und kleb sie richtig zusammen. Bei zwei Abschnitten werden zwei Bilder beschrieben. Es fügte sich, dass des Kaisers Landvogt, genannt der Gessler gen Uri fuhr; als er da eine Zeit wohnte, liess er einen Stecken unter der Linde, da jedermann vorbeigehen musste, richten, legte einen Hut drauf und hatte einen Knecht zur Wacht dabeisitzen. Darauf gebot er durch öffentlichen Ausruf: Wer der wäre, der da vorüberginge, sollte sich dem Hut neigen, als ob der Herr selber zugegen sei; und übersähe es einer und täte es nicht, den wollte er mit schweren Bussen strafen. Nun war ein frommer Mann im Lande, hiess Wilhelm Tell, der ging vor dem Hut über und neigte ihm keinmal; da verklagte ihn der Knecht, der des Hutes wartete, bei dem Landvogt. Der Landvogt liess den Tell vor sich bringen und fragte: warum er dem Stecken und Hut nicht neige, als doch geboten sei? Wilhelm Tell antwortete: „Lieber Herr, es ist von ungefähr geschehen; dachte nicht, dass es Euer Gnad so hoch achten und fassen würde; wär ich witzig, so hiess ich anders dann der Tell. Nun war der Tell gar ein guter Schütz, wie man sonst keinen im Lande fand, hatte auch hübsche Kinder, die ihm lieb waren. Da liess der Landvogt, die Kinder holen, und als sie gekommen waren, fragte er Tellen, welches Kind ihm das allerliebste wäre. „Sie sind mir alle gleich lieb. Da sprach der Herr: „Wilhelm, du bist ein guter Schütz, und findt man nicht deinsgleichen; das wirst du mir jetzt bewähren; denn du sollst deiner Kinder einem den Apfel vom Haupte schiessen. Tust du das, so will ich dich für einen guten Schützen achten. Der gute Tell erschrak, fleht um Gnade und dass man ihm solches erliesse, denn es wäre unnatürlich; was er ihm sonst hiesse, wolle er gerne tun. Der Vogt aber zwang ihn mit seinen Knechten und legte dem Kinde den Apfel selbst aufs Haupt. Nun sah Tell, dass er nicht ausweichen konnte, nahm den Pfeil und steckte ihn hinten in seinen Göller, den andern Pfeil nahm er in die Hand, spannte die Armbrust und bat Gott, dass er sein Kind behüten wolle; zielte und schoss glücklich ohne Schaden den Apfel von des Kindes Haupt. Da sprach der Herr, das wäre ein Meisterschuss. „Aber eins wirst du mir sagen: Was bedeutet, dass du den ersten Pfeil hinten ins Göller stiessest? Tell sprach: „Das ist so Schützengewohnheit. Der Landvogt liess aber nicht ab und wollte es eigentlich hören; zuletzt sagte Tell, der sich fürchtete, wenn er die Wahrheit offenbarte: wenn er ihm das Leben sicherte, wolle er sagen. Als das der Landvogt getan, sprach Tell: „Nun wohl! Sintemal Ihr mich des Lebens gesichert, will ich das Wahre sagen. Und fing an und sagte: „Ich hab es darum getan: hätte ich des Apfels gefehlt und mein Kindlein geschossen, so wollte ich Euer mit dem andern Pfeil nicht gefehlt haben. Da das der Landvogt vernahm, sprach er: „Dein Leben ist dir zwar zugesagt; aber an einen Ort will ich dich legen, da dich Sonne und Mond nimmer bescheinen; liess ihn fangen und binden und in denselben Nachen legen, auf dem er wieder nach Schwyz schiffen wollte. Wie sie nun auf dem See fuhren und kamen bis gegen Axen hinaus, stiess sie ein grausamer starker Wind an, dass das Schiff schwankte und keiner wusste mehr das Fahrzeug vor den Wellen zu steuern. Indem sprach einer der Knechte zum Landvogt: „Herr, hiesset Ihr den Tell aufbinden, der ist ein starker, mächtiger Mann und versteht sich wohl auf das Wetter: so möchten wir wohl aus der Not entrinnen. Sprach der Herr und rief dem Tell: „Willst du uns helfen und dein Bestes tun, dass wir von hinnen kommen, so will ich dich heissen aufbinden. Da sprach der Tell: „Ja, gnädiger Herr, ich will gerne tun und getraue mir. Da ward Tell aufgebunden und stand an dem Steuer und fuhr redlich dahin; doch so lugte er allenthalben auf seinen Vorteil und auf seine Armbrust, die nah bei ihm am Boden lag. Da er nun kam gegen einer grossen Platte die man seither stets genannt hat des Tellen Platte und noch heut beitag also nennet , deucht es ihm Zeit zu sein, dass er entrinnen konnte; rief allen munter zu, fest anzuziehen, bis sie auf die Platte kämen, denn wann sie davonkämen, hätten sie das Böseste überwunden. Also zogen sie der Platte nah, da schwang er mit Gewalt, als er denn ein mächtig starker Mann war, den Nachen, griff seine Armbrust und tat einen Sprung auf die Platte, stiess das Schiff von ihm und liess es schweben und schwanken auf dem See. Lief durch Schwyz schattenhalb (im dunkeln Gebirg), bis dass er kam gen Küssnacht in die hohle Gassen; da war er vor dem Herrn hingekommen und wartete sein daselbst. Und als der Landvogt mit seinen Dienern geritten kam, stand Tell hinter einem Staudenbusch und hörte allerlei Anschläge, die über ihn gingen, spannte die Armbrust auf und schoss einen Pfeil in den Herrn, dass er tot umfiel. Da lief Tell hinter sich über die Gebirge gen Uri, fand seine Gesellen und sagte ihnen, wie es ergangen war. Krieg gegen die Habsburger Die Habsburger stammten aus dem Elsass (Region im Nordosten Frankreich). Um 1020 bauten sie im Aargau die Habichtsburg (siehe Bild) und erwarben so viele Ländereien und Rechte, dass sie schliesslich zu den mächtigsten Herren im Gebiet der heutigen Schweiz gehörten. Das ursprünglich kleine Grafengeschlecht im Aargau erwarb später in Österreich riesige Ländereien. Diese wurden viel wichtiger als die Gebiete in der Schweiz. Die Habsburger verlegten auch ihren Sitz nach Österreich. Aus diesem Grund wurden sie auch Österreicher genannt. Die Habsburger gelten als die Erzfeinde der Eidgenossen. Während Jahrzehnten erlitten die Habsburger dabei aber eine Niederlage nach der anderen und die Eidgenossen wurden immer selbstbewusster: 1315 Schlacht am Morgarten (bei Sattel SZ): Die Eidgenossen überfielen das habsburgisch österreichische Ritterheer aus dem Hinterhalt. Gemäss einer unbestätigten Legende stürzten sie Baumstämme auf die zwischen Berg und See eingezwängte Reiterkolonne. 1386 Schlacht bei Sempach LU: Arnold von Winkelried ist der Legende nach der Held dieser berühmten Schlacht. 1388 Schlacht bei Näfels GL 1403 Schlacht bei Vögelinsegg und 1405 Schlacht bei Stoss AR: Freiheitskampf der Appenzeller gegen das Kloster St. Gallen und mit ihm verbündete süddeutsche Städte und Herzog Friedrich IV. von HabsburgÖsterreich zur Wiedererlangung der 1345 an das Kloster verlorenen Freiheit. Die Schlacht von Sempach 1386 Herzog Leopold III. von Österreich wollte mit Luzern und den Eidgenossen gründlich abrechnen. Leopold hatte aber Mühe, ein Heer für diesen Feldzug aufzubieten, denn die in österreichischhabsburgischen Diensten kämpfenden Ritter waren an vielen anderen Stellen der Reichsgrenzen in Abwehrkämpfe verwickelt. So mussten für teures Geld zunächst mühsam Söldner angeworben werden und Leopold musste deswegen gar einige oberitalienischen Ländereien verpfänden. Dies war es ihm wert, denn er wollte seine Stammlande unter keinen Umständen kampflos aufgeben. In Brugg sammelte er ein glänzendes Ritterheer und marschierte zuerst nach Luzern, denn dort hatten die Sempacher das Burgrecht bekommen. Sie wurden von den Eidgenossen schnell bemerkt. Allerdings erwarteten diese, dass das Habsburger Heer zunächst gegen Zürich vorstossen würde, weshalb sie dort ein starkes Heer zusammengezogen und sich zunächst dort postierten. Als sie ihren Irrtum bemerkten, dass Leopold III. gegen Sempach zog, eilten sie schnell herbei. Unweit von Sempach, bei der habsburgtreuen Ortschaft Sursee, bezog das österreichische Heer ein letztes Nachtlager und Leopold III. bereitete sich vor, die Schmach seines Grossvaters Leopold I., welche dieser bei der Schlacht am Morgarten erlitt, nunmehr zu sühnen. Bei Tagesanbruch des 9. Juli 1386 brachen sie in Richtung Sempach auf und in der Morgenfrühe stiessen die Vorhuten der beiden Heere aufeinander. Nachdem die Eidgenossen ein kurzes Gebet gesprochen hatten, griffen sie diese uneinnehmbar scheinende Stellung in keilförmiger Schlachtordnung an. Sie zerbrachen buchstäblich daran, verloren beim ersten Zusammenprall etwa 60 Luzerner darunter auch deren Anführer. Der Legende nach opferte sich nun ein Mann von Unterwalden, Arnold von Winkelried, indem er sich gegen die Speere warf – und dabei ums Leben kam. Er habe Dutzende von Speeren niedergedrückt, so dass die eidgenössischen Fusstruppen mit ihren Hellebarden über seinen Körper hinweg in die geschlossene Front des Ritterheeres einbrechen konnten. Die Erweiterung der Eidgenossenschaft Nach dem Sieg der Waldstätte (_, und) über die Habsburger bei Morgarten schlossen sich eine Reihe von Städten dem Bund der Waldstätte an. 1332 die habsburgische Stadt , 1351 , 1352 und und im Jahre 1353. Das neue Gebilde nennt man „. Sie haben untereinander Bündnisse abgeschlossen, die die gegenseitige Unterstützung absichern. Der Habsburger Herzog Leopold war nicht einverstanden, dass Luzern und Umgebung sich diesem Bund anschlossen. So kam es am 9. Juli 1386 zu einer weiteren Schlacht zwischen den Habsburgern und dem Bund der Waldstätten. Sie gewannen Die Schlacht bei Sempach und stärkten so die Eidgenossenschaft. Zwischen 1481 und 1513 traten die Orte , ,,, und dem Bund bei. Die Aufnahme dieser Orte in den Bund der Eidgenossen war jeweils die Folge von kriegerischen Auseinandersetzungen, bei denen die Eidgenossen und die neuen Orte zusammen gegen einen gemeinsamen Gegner gekämpft hatten. Aus der Achtörtigen wurde die Dreizehnörtige Eidgenossenschaft, die bis 1803 so blieb. 1. Male die Kantone des Bundes von 1291 mit roter Farbe aus. 2. Erweitere mit grün die Karte der 8 alten Orte von 1353. 3. Male die übrigen Kantone der 13 Orte von 1513 blau aus. Aus der Eidgenossenschaft wird die Schweiz Im Mittelalter und auch danach gab es in Europa immer wieder Kriege. Viele Eidgenossen dienten in fremden Armeen als Soldaten. Viele wurden dazu gezwungen, weil sie das Geld benötigten, um ihre Familien ernähren zu können. Die Armut auf der einen Seite und der Reichtum des Adels führten zu sozialen Unruhen. 1789 brach beispielsweise in Frankreich die Revolution aus und das Volk stürzte den König vom Thron. 1200 Schweizer standen zu dieser Zeit als Garde im Dienst des Königs Ludwig XVI. Die Revolutionäre stürmten den von der Königsfamilie bereits verlassenen Tuilerienpalast. Bei der Verteidigung des leeren Königspalastes durch rund 1000 Schweizer Gardisten fanden etwa 760 den Tod. Das Löwendenkmal befindet sich im Zentrum Luzerns und erinnert im Sinnbild eines sterbenden Löwen an die am 10. August 1792 beim Tuileriensturm in Paris gefallenen SchweizerGardisten. In der Schweiz wollte man auch eine Revolution und die 13örtige Eidgenossenschaft war sich alles andere als einig. Nicht einmal ein gemeinsames Heer konnte 1798 den anrückenden französischen Truppen entgegengestellt werden. So hatten die Franzosen ein leichtes Spiel. Innert weniger Tagen war das ganze Mittelland besetzt. Die Franzosen bildeten neue Staaten (z.B. Kanton Säntis mit Hauptort Appenzell usw.). In der Helvetik kamen im Jahr 1803 weitere Kantone zum Bund dazu. Unser Land war damals ein Bund von vielen kleinen Staaten (Kantonen). Fast jeder Kanton verfügte über eigenes Geld und eine eigene Armee. Aber immer noch hatten die Menschen nicht alle die gleichen Rechte. Das Interesse an einer neuen, einheitlichen Schweiz war sehr unterschiedlich, und ein schweizerisches Heimatgefühl gab es noch kaum. Befürworter und Gegner der neuen Schweiz konnte sich lange nicht einigen. Die Eidgenossenschaft vor 1848 «einer Die Eidgenossenschaft nach 1848 «einer Traube ähnlich» Orange ähnlich» Es kam 1847 sogar zu einem Krieg (Sonderbundskrieg) zwischen den Kantonen. Die Befürworter gewannen. In der Schweiz gab es von nun an endgültig keine regierenden Stadtherren und Untertanen mehr. Die Regierungen der einzelnen Kantone anerkannten die Landesregierung (Bundesrat). Die neue Verfassung (Vertrag) wurde 1848 in einer Volksabstimmung knapp angenommen und am 12. September von allen Kantonsregierungen unterzeichnet.