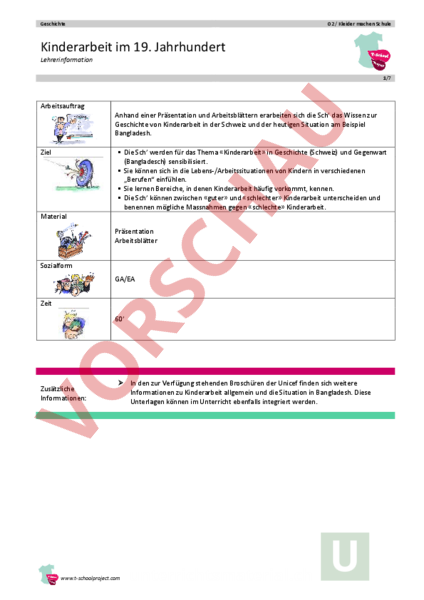Arbeitsblatt: Kinderarbeit
Material-Details
Kinderarbeit CH
Geschichte
Schweizer Geschichte
9. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
167667
818
14
12.01.2017
Autor/in
Rok Tominec
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Geschichte 02 Kleider machen Schule Kinderarbeit im 19. Jahrhundert Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Ziel Anhand einer Präsentation und Arbeitsblättern erarbeiten sich die Sch das Wissen zur Geschichte von Kinderarbeit in der Schweiz und der heutigen Situation am Beispiel Bangladesh. Die Sch werden für das Thema «Kinderarbeit» in Geschichte (Schweiz) und Gegenwart (Bangladesch) sensibilisiert. Sie können sich in die Lebens-/Arbeitssituationen von Kindern in verschiedenen „Berufen einfühlen. Sie lernen Bereiche, in denen Kinderarbeit häufig vorkommt, kennen. Die Sch können zwischen «guter» und «schlechter» Kinderarbeit unterscheiden und benennen mögliche Massnahmen gegen «schlechte» Kinderarbeit. Material Präsentation Arbeitsblätter Sozialform GA/EA Zeit 60 Zusätzliche Informationen: In den zur Verfügung stehenden Broschüren der Unicef finden sich weitere Informationen zu Kinderarbeit allgemein und die Situation in Bangladesh. Diese Unterlagen können im Unterricht ebenfalls integriert werden. www.t-schoolproject.com Geschichte 02 Kleider machen Schule Kinderarbeit im 19. Jahrhundert Arbeitsblatt 2/7 Aufgabe: www.t-schoolproject.com Seht euch die folgenden Bilder an und diskutiert in der Klasse eure Eindrücke und Gedanken. Geschichte 02 Kleider machen Schule Kinderarbeit im 19. Jahrhundert Arbeitsblatt 3/7 Aufgabe: Lest den Text über die Kinderarbeit in der Schweiz gut durch. Anschliessend hört Ihr einen Vortrag über die Kinderarbeit in der heutigen Zeit in Bangladesh. Macht euch dazu Notizen mit den wichtigsten Kennzahlen. Warum arbeiten Kinder? Kinderarbeit in der Schweiz seit dem 19. Jahrhundert Als Kinderarbeit gilt eine Erwerbstätigkeit unter der gesetzlichen Alterslimite des vollendeten 15. Altersjahres (Kindheit). In der Schweiz wird das Mindestalter durch das Arbeitsgesetz, das Heimarbeitsgesetz und die obligatorische Schulzeit von neun Jahren festgelegt. Am Anfang des 21. Jhs. war Kinderarbeit in der Schweiz kein gesellschaftliches Problem mehr. In der vorindustriellen Gesellschaft waren die Kinder vielfach Teil der Familienökonomie, wurden früh in den Arbeitsprozess integriert und leisteten einen oft unentbehrlichen Beitrag an das Einkommen (Arbeit). Mit der Industrialisierung mussten Familienmitglieder ausserhalb der traditionellen Hauswirtschaft einen Erwerb suchen. Die Arbeit an den Maschinen war vielfach einfach und körperlich nicht besonders anspruchsvoll, was den Einsatz von Frauen und Kindern begünstigte. Damit nahm die Ausbeutung der Arbeitskraft der Kinder neue Formen und ganz andere Ausmasse an. Sie verbreitete sich zu Beginn des 19. Jhs. rasch, insbesondere im Kanton Zürich und in der Ostschweiz. In den Baumwollspinnereien arbeiteten bereits sechs- bis zehnjährige Kinder (manchmal noch jüngere) unter miserablen Bedingungen (schlechte Luft, wenig Licht, gefährliche Maschinen) bis zu 16 Stunden pro Tag, oft auch nachts. Das hatte gravierende Konsequenzen für die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder, die wegen der Arbeit auch dem Schulunterricht fern blieben (Schulwesen). Kinderarbeit wurde zum sozialen Problem, auf das die Behörden mit Untersuchungen reagierten (1812 im Kt. St. Gallen, 1813 im Kt. Zürich). Als Folge wurde im Kanton Zürich 1815 die Verordnung wegen der minderjährigen Jugend überhaupt und an den Spinnmaschinen besonders erlassen, welche Nachtarbeit und Fabrikarbeit vor dem vollendeten neunten Altersjahr verbot und die tägliche Arbeitszeit auf 12 bis 14 Stunden beschränkte. Diese Regelungen waren nicht durchzusetzen, markierten jedoch den Anfang der Kinderschutzgesetzgebung. Es folgten Gesetze in Zürich (1837) und anderen Kantonen. Mit dem eidgenössischen Fabrikgesetz von 1877 wurde die Fabrikarbeit erstmals national geregelt (Verbot der Arbeit von Kindern unter 14 Jahren). Die Fabrikgesetze galten nur für die Fabrikindustrie. Wo es keine gesetzlichen Bestimmungen gab, wurde versucht, über die obligatorische Schulzeit die Kinderarbeit einzuschränken. Doch Kinderarbeit war noch zu Beginn des 20. Jhs. weit verbreitet, insbesondere in der Landwirtschaft und der Heimarbeit (Verdingung, Verdingkinder). Gemäss einer Erhebung von 1904 in zwölf Schweizer Kantonen arbeiteten in der Schweiz zu diesem Zeitpunkt rund 300�00 Kinder. www.t-schoolproject.com Geschichte 02 Kleider machen Schule Kinderarbeit im 19. Jahrhundert Arbeitsblatt 4/7 Im Verlauf des 20. Jhs. wurde die Kinderarbeit sukzessive weiter eingeschränkt: Das Bundesgesetz von 1922 über die Beschäftigung von jugendlichen und weiblichen Personen in den Gewerben legte das Mindestalter auf 14 Jahre fest und verbot die Nachtarbeit für Personen unter dem 19. Altersjahr und für Lehrlinge unter dem 20. Altersjahr. Das Bundesgesetz über das Mindestalter der Arbeitnehmer von 1938 setzte das Mindestalter auf 15 Jahre hinauf. Das Bundesgesetz über die Heimarbeit von 1940 verbot die Vergabe von selbstständiger Heimarbeit an Kinder unter dem vollendeten 15. Altersjahr. 1964 wurde der Geltungsbereich des Arbeitsschutzes im Arbeitsgesetz ausgeweitet, ausgenommen blieben die Landwirtschaft und die Heimarbeit. Mit der Revision des Kindesrechts von 1978 wurde der gesetzliche Schutz der Verdingkinder aufgenommen. 1997 ratifizierte die Schweiz die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes und beteiligt sich seither an dem 1991 gegründeten Programm zur Beseitigung der Kinderarbeit (IPEC) der Internationalen Arbeitsorganisation. 2006 wurde das Schutzalter für Nacht- und Sonntagsarbeit auf 18 Jahre heruntergesetzt. Quelle: Gull, Thomas, Art. «Kinderarbeit», Historisches Lexikon der Schweiz, (Zugriff: 17.6.2009). Differenzierung zwischen «guter» und «schlechter» Kinderarbeit Weltweit arbeiten schätzungsweise 246 Millionen Kinder – davon fast 70%, das heisst 171 Millionen, unter gefährlichen Bedingungen: In Minen, mit Chemikalien und Pestiziden in der Landwirtschaft oder in Fabriken mit gefährlichen Maschinen. Nicht jede Kinderarbeit ist schlecht. Es gibt wichtige Aufgaben, die Kinder übernehmen können – wenn sie dabei nicht ausgebeutet werden. Und vor allem: Wenn Schule und Erholung dadurch nicht zu kurz kommen. UNICEF ( United Nations International Childrens Emergency Fund) unterscheidet deshalb zwischen sinnvoller und gefährlicher Kinderarbeit. UNICEF kämpft gegen: Vollzeitarbeit für Kinder zu viele Arbeitsstunden am Tag Arbeit, welche die Gesundheit ruiniert gefährliche Arbeit ungerechte oder gar keine Löhne Arbeit, die Schulbesuch unmöglich macht sexuelle Ausbeutung Knechtschaft und Sklaverei Notizen zum Vortrag: . . . . . . www.t-schoolproject.com Geschichte 02 Kleider machen Schule Kinderarbeit im 19. Jahrhundert Arbeitsblatt 5/7 Aufgabe: Hier seht Ihr einige Bilder von arbeitenden Kindern in Bangladesh. Notiert zu jedem Antworten zu folgenden Fragen: In welchem Bereich arbeiten die Kinder? Was erleben diese Kinder während ihrer Arbeit? Welchen Gefahren sind sie ausgesetzt? Beantwortet zudem die Fragen am Schluss der Bilderreihe. Alle Antworten könnt ihr anschliessend mit eurer Lehrperson und den Klassenkameraden diskutieren. www.t-schoolproject.com Geschichte 02 Kleider machen Schule Kinderarbeit im 19. Jahrhundert Arbeitsblatt 6/7 www.t-schoolproject.com Geschichte 02 Kleider machen Schule Kinderarbeit im 19. Jahrhundert Arbeitsblatt 7/7 Welches sind Bereiche, in denen Kinderarbeit häufig vorkommt? Welche Faktoren begünstigen Kinderarbeit? . Was wären sinnvolle Massnahmen gegen Kinderarbeit? . www.t-schoolproject.com