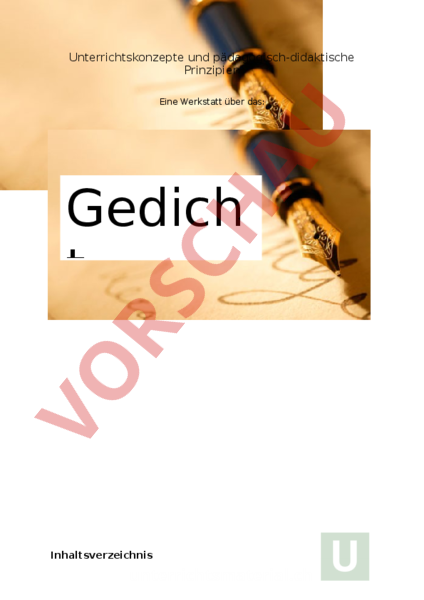Arbeitsblatt: Werkstatt über das Gedicht
Material-Details
Werkstatt über das Gedicht
Deutsch
Gemischte Themen
8. Schuljahr
25 Seiten
Statistik
168379
1013
84
29.01.2017
Autor/in
Sara Schafer
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Unterrichtskonzepte und pädagogisch-didaktische Prinzipien Eine Werkstatt über das: Gedich Inhaltsverzeichnis 1) Teil 1.1) Inhaltliche und Ausgestaltung didaktische Überlegungen zur und zum Einsatz der Werkstatt unter Bezugnahme der im Seminar erarbeiteten Inhalte Die Werkstatt kann zu jedem Zeitpunkt benutzt werden und eignet sich auch für alle Fächer. Werkstattunterricht kann gebraucht werden zum Einführen, Aufbauen, Vermitteln, Durcharbeiten und Üben. Bevor man beginnt mit dem Erstellen einer Werkstatt, muss man sich bewusst sein, welche Lerninhalte und Ziele man mit dem Werkstattunterricht erreichen möchte. Das Konzept erstellt man anhand von sechs Leitfragen, welche den Umfang, die Gliederung, die Art der Überprüfung, die Feinziele, das Layout und das Handling beinhalten. Der Umfang ist abhängig von den wöchentlichen Lektionen. Ob ich Selbstkontrollen, Peergruppen, Fremdkontrollen durch die Lehrperson durchführe, plane ich in der Art der Überprüfung. Das Sammeln und Suchen von Material erstreckt sich über eine längere Zeit. Danach beginnt die Bereitstellung der Werkstattposten. Wenn die Posten einmal erarbeitet sind, wird eine Übersicht über die Werkstattposten erstellt. Anschliessend muss das Schulzimmer dementsprechend eingerichtet werden (Auftragsblätter an Fenster und 2 Wände im Zimmer verteilen oder mit einer Schnur durchs Schulzimmer hängen, etc.). Bevor mit der Werkstatt begonnen wird, müssen die passenden Verhaltensregeln abgemacht werden und es muss auch geklärt werden, wie die SuS im Falle von Lernschwierigkeiten sich an die Lehrperson wenden können. Danach kann die Werkstatt in Betrieb genommen werden. Die Lehrperson tritt von diesem Augenblick in den Hintergrund als Berater oder Coach und die SuS müssen selber entscheiden, wie sie sich organisieren. Die Führungs-, bzw. Lernverantwortung wird bei Beginn der Werkstatt an die SuS abgegeben. Durch die eigenen Lernwege und die Eigendisziplin gelangen sie so zu den Lernzielen und Kompetenzen. Die Werkstatt ermöglich auch, dass jeder Schüler und jede Schülerin nach ihrem eigenen Tempo arbeiten kann. Mit dem Werkstattunterricht werden den SuS Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Wissen, Ausdauer, Konzentration, und vieles mehr vermittelt. Nicht zu empfehlen sind Werkstätte für den Aufbau von allgemein verbindlichen Strukturen, z.B. Aufbau von mathematischen Strukturen oder Analyse einer Textgattung. Die direkte Instruktion oder andere Lernarrangements wären hier empfehlenswert. In unserer Werkstatt bin ich auf mehrere Punkte wie folgt eingegangen: Art der Werkstatt: Die Zielstufe ist die 7.-8. Klasse. Diese Werkstatt dient der Einführung in die Lyrik, insbesondere ins Gedicht. Es wird kein Vorwissen über die Lyrik erwartet, denn in dieser Werkstatt soll das Wichtigste über die Lyrik erarbeitet werden. Daher definiere ich sie als Erfahrungswerkstatt. Ziel der Werkstatt: Ziel der Werkstatt ist es, dass sich die SuS mit der Gattung der Lyrik vertraut machen, insbesondere mit dem Gedicht. Vorgehen: 3 Wie bereits angedeutet im obigen Punkt „Art der Werkstatt brauchen die SuS keinerlei Vorwissen und kann somit nach jedem beliebig abgeschlossenen Thema durchgeführt werden. Doch bevor sich die SuS auf die Werkstatt stürzen, werden ihnen die nachfolgenden Punkte (1-6) nähergebracht: 1. Arbeitspass Als aller erstes wird jedem und jeder ein Arbeitspass ausgehändigt. Der Arbeitspass wird von der Lehrperson präsentiert und der Aufbau der verschiedenen Arbeitsblätter wird erklärt. Die Posten werden kurz und bündig erklärt und es wird auf Fragen eingegangen. Ausserdem wird erklärt, welche Posten obligatorisch sind und welche sie freiwillig machen dürfen. Doch von den freiwilligen müssen sie auch mind. 2 lösen (welche davon ist egal). Es wird erklärt was mit Fremdkontrolle, Lehrerkontrolle und Selbstkontrolle gemeint ist usw. 2. Verhaltensregeln: Rumschreien ist verboten Mit dem Material wird sorgfältig umgegangen jeder Posten bleibt an seinem Platz!!! Es wird im Schulzimmer gearbeitet (nicht in den Gängen) 3. Bei Fragen: Jede/r SuS hat ein Magnet, auf welchem sein Name draufsteht. Die Wandtafel wird mit den Zahlen 1-10 (von oben nach unten) beschriftet. Der Schüler oder die Schülerin, welche zuerst eine Frage hat, wird sein Magnet auf die Zahl 1 haften. Der nächste Schüler bzw. die nächste Schülerin wird sein bzw. ihr Magnet auf die Zahl 2 legen usw. Wenn die Lehrperson Zeit hat, nimmt sie somit das Magnet auf Platz 1, schiebt alle SuS eine Platzierung nach oben, und widmet sich diesem Schüler bzw. dieser Schülerin (somit haben die SuS auch sofort ihr Magnet wieder, wenn sie drangekommen sind). 4. Raumorganisation: 4 Jeder Posten kriegt im Raum seinen spezifischen Platz und beleibt auch dort. An der Wand wird die jeweilige Postennummer befestigt, um Überblick zu schaffen und somit das Rumlaufen im ganzen Klassenzimmer zu vermeiden. Das Arbeitsblatt (so viele Exemplare wie Schüler) wie auch das Lösungsblatt (3 Exemplare) wird sich dort befinden. Die Arbeitsblätter befinden sich in einem Mäppchen und die Lösungsblätter in einem anderen Mäppchen, welches natürlich nicht transparent ist. Didaktische Überlegung: Bewusst teile ich ihnen nicht gleich alle Arbeitsblätter aus, sondern lasse sie eben an ihrem Platz, da mehr als die Hälfte der Posten freiwillig ist und somit hätten sie dann zu viele Blätter, die sie evt. gar nicht benötigen. 5. Sozialform Sehr viele Posten werden in Partnerarbeit oder in Gruppenarbeiten gelöst. Die SuS haben daher noch ein zweites Magnet: Falls sie einen Partner oder mehrere für einen bestimmten Posten suchen, sollen sie einfach das zweite blauen Magnet 6. Art der Kontrolle: Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Ein A3-Plakat wird davon vorne an der Wandtafel angebracht. Die Schüler und Schülerinnen machen einen Kreis bei diesen Aufgaben, bei denen sie gerade sind und kreuzen schliesslich den Kreis durch, wenn sie den Posten erledigt haben. Dies ermöglicht mir als Lehrperson einen raschen Überblick und somit kann mich individuell den SuS widmen, die etwas langsamer sind. 1.2) Ausführungen zu den berücksichtigten pädagogisch- didaktischen Prinzipien (Merkmale guten Unterrichts nach Meyer) und Hinweise, wie diese die Werkstatt akzentuieren Methodenvielfalt: Mir ist die Methodenvielfalt sehr wichtig und ich denken, dass man mit der Methodenvielfalt auch in weiteren Punkten gewinnen kann: Wie beispielsweise in der „Echten Lernzeit, denn die Jugendlichen arbeiten mit Bestimmtheit bei abwechslungsreicheren Posten lieber und somit effizienter. Das Gedicht ist ein Thema bei welchem man sehr schön und auch eher einfach, mit den Methoden variieren kann. Dabei kennt die Kreativität keine Grenzen und mir scheint es auch als sinnvoll diesen Bereich der Lyrik kreativ zu gestalten, um somit selber ein Gefühl dafür zu entwickeln. Aus diesem Grund haben ich etwa die Hälfte der Posten kreativ gestaltet. Ein Posten wird mit dem Computer gelöst. Bei einem anderen wird mit Zeitung gearbeitet: geschnitten und geklebt. Bei einem weiteren wird gemalt und beim anderen können sie ein Gedicht vortragen oder vorspielen. Die andere Hälfte der Posten ist eher theoretisch und mit einem Auftrag verbunden. Doch auch hier wird mit den Methoden variiert. Bei einem 6 Posten müssen sie strikt Merkmale aus dem Text herausnotieren. Bei einem anderen analysieren sie ein Gedicht und vieles mehr. Inhaltliche Klarheit: Die inhaltliche Klarheit ist essentiell. Auch hier finden wir, dass sich das Ganze ansonsten negativ oder eben positiv wie das „Lernförderliche Klima. Es ist recht wichtig das richtige Mass zu finden, also weder zu ausführlich zu erklären noch zu offen, sodass Fragen entstehen. Dabei ist es natürlich wichtig bevor man die Jugendlichen auf die Posten loslässt, diese ihnen kurz vorzustellen. So haben sie bereits eine Idee vom Posten und auch wenn nicht alles hängen bleibt, haben sie es immerhin bereits einmal gehört. Doch eben, weil nicht alles hängen bleibt und die Posten über mehrere Wochen vielleicht überarbeitet werden ist es wichtig, den Auftrag klar zu formulieren. Das schont wie vorhin schon erwähnt vor allem das lernförderliche Klima. Was wiederum natürlich das absolute Muss ist für einen hohen Anteil echter Lernziel. Nun haben wir den Vorteil, dass wir drei bereits Werkstätte über Gedichte zur Hand genommen haben und viele Posten daraus genommen haben. Dabei sind die Aufträge natürlich schon ausformuliert. 2) Teil 2.1) Reflexion zum Werkstattunterricht Ich muss zugeben, dass ich dem Werkstattunterricht anfangs eher negativ gegenüberstand. In meiner Sekundarzeit bin mit dieser offenen Form des Unterrichts überhaupt nicht in Berührung gekommen. Je mehr ich selbst hinter meine Werkstatt gesessen bin, ist mir bewusst geworden welche Möglichkeiten ich meinen SuS damit öffne. Ich denke auch, dass ein Thema wie eben beispielweise die Lyrik nie in diesem Masse und auf dies Art gelernt werden könnte im Frontalunterricht. Ausserdem habe ich gemerkt, dass man zwar die Kontrolle bzw. die Verantwortung den SuS abgibt, aber damit überhaupt nicht weniger Kontrolle über das Ganze hat als im Frontalunterricht. Im Frontalunterrocht kann man auch nicht sicherstellen, ob jeder zuhört und mitmacht. Ausserdem sind die Kinder viel motivierter, und zwar intrinsisch, wenn sie selbst aussuchen dürfen 7 mit wem sie welche Aufgabe lösen möchten. Ich als Lehrperson habe Zeit mich den Schülerinnen und Schüler ganz individuell zu widmen und haben dennoch den Überblick und somit die Kontrolle, wo die SuS gerade stecken, dank dem Werkstattspass. Diese Form ist trotzdem nicht so komplett offen wie anfangs vermutet, denn das Wissen von den obligatorischen Posten ist bei allen SuS sichergestellt. Im Nachhinein sehe ich deshalb im Werkstattunterricht fast nur Positives. Natürlich kann es in der Praxis mit einer schwierigen Klasse heikel werden, doch ich bin überzeugt, dass die SuS mit der Zeit Gefallen am Werkstattunterricht finden und bestimmt gerne und souverän mit dieser Verantwortung umgehen werden. Bei meiner Werkstatt hat es bestimmt noch Verbesserungspotenzial. Doch was gut funktioniert bzw. weniger gut, wird sich wohl erst in der Praktik zeigen. 2.2) Schlussfolgerung zur Fortsetzung der berufspraktischen Ausbildung und zum Berufskonzept Für die Fortsetzung meines Studiums hilft es mir sicher ein Stück weit von dem wegzukommen, wie ich persönlich unterrichtet worden bin. Nicht umsonst sagt man: Man unterrichtet nicht so wie man es gelernt worden ist, sondern wie man selbst unterrichtet worden ist. Bei mir gab es in der Sekundarstufe wie erwähnt nie Werkstattunterricht und langsam bekomme ich ein Gespür dafür wie der heutige moderne Unterricht aussehen könnte und sollte, welches für mich als zukünftige Lehrperson eine essentielle Rolle spielt. Für mich war von Anfang an klar, dass ich diese Werkstatt einmal in meinem Unterricht benutzen möchte. Lyrik kann sehr trocken wirken, wenn es zu theoretisch rübergebracht wird. Ich denke aber, dass ich ein gutes Mass an produktiven und kreativen Posten in die Werkstatt gebracht haben, um diesem entgegenzuwirken. Schlussendlich kann ich sagen, dass Schulunterricht nicht nur von Frontalunterricht leben kann und, dass Werksstattunterricht sicher eine geeignete Alternative ist. 3) Teil 8 3.3) Werkstätte Klaps, Hannjürgen (2005): Lyrik-Werkstatt Herbst. Fotos, Gedichte, Arbeitsblätter. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. 3.4) Internet Posten 3: Posten 5: Posten 8: 3.5) Bilder Titelbild: (26.03.2016) 4) Teil 4.1) Dokumentation der Werkstattposten ARBEITSPASS von: 9 Poste Titel freiwillig (2. mindestens machen) Zei Schwer Sozialform Kontroll -form erledigt Einfach obligatorisch 1 Metrum bestimmen 15 EA Selbstkontroll 2 Reimschema: Endreim 20 PA Fremdkontroll 3 Sprachliche Mittel 15 PA Selbstkontroll 4 Rätselhaftes Gedicht 20 PA Selbstkontroll 5 Gedichtformen 15 GA Selbstkontroll 6 Liebesgedicht 30 GA Lehrerkontroll 7 Was ist Lyrik 15 PA Selbstkontroll 8 Gedicht künstlerisch darstellen 20 GA Im Plenum 9 Gedicht Der Panther 15 PA Fremdkontroll 10 Posten 1: 15 EA Selbstkontro lle Metrum Ziel: Du kannst das Metrum eines Gedichtes bestimmen. Auftrag: Lies den unterstehenden Text durch über das Metrum und deren vier Formen (Jambus, Trochäus, Daktylus und Anapäst). Versuche anschliessend die vier Gedichte zu analysieren: unterstreiche unbetonte Silben mit: unterstreiche betonte Silben mit: Tipp: Lies das Gedicht laut für dich durch (mit Klatschen) und überlege dir, welche Silbe du betonst. Entscheide anschliessend, welche Form das Gedicht angehört. Das Metrum: Viele Gedichte besitzen einen eigenen Schwung, einen Rhythmus. Betonte und unbetonte Silben wechseln sich in bestimmter, gelichbleibender Reihenfolge ab. Diese rhythmische Einheit nennt man Versfuss, auch Metrum oder Versmass. Die vier Formen: Jambus: unbetont – betont Trochäus: betont – unbetont Daktylus: betont – unbetont – unbetont Anapäst: unbetont – unbetont – betont 1) Wiederum leuchten die Blätter im Licht Tanzen und schwanken und fallen dann Doch 2) Das Fräulein stand am Meere Und seufzte lang und bang, Es rührte sie so sehre Der Sonnenuntergang. 3) Erste grosse Perlen fallen Wie aus grober Siebe Augen. Hell des Daches Bleche knallen, Fels und Strasse sprühn und saugen. 4) Und es wallet und siedet und brauset und Zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt 11 Quelle: Klaps, Hannjürgen (2005): Lyrik-Werkstatt Herbst. Fotos, Gedichte, Arbeitsblätter. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. Posten 2: 15 EA Fremdkontro lle Reimschema (Endreim) Ziel: Du kennst die drei verschiedenen Strophenformen. Auftrag: Lies die drei Strophenformen (Paarreim, Kreuzreim umrahmende Reime). Ergänze anschliessend das Schema des Kreuzreimes und des umarmenden Reimes mit Hilfe des bereits vorgegebenen Beispiels über den Paarreim (aabb). Schreibe ein Gedicht in einer der drei Strophenform. Die wohl häufigste Strophenform ist der Vierzeiler, der auf drei verschiedene Arten gereimt werden kann. Dabei reimen sich immer das letzte Worte eines Verses mit einem anderen: Paarreim: Paarweise zusammen, also erste und zweite, dritte und vierte: Schema: aabb Kreuzreim: Jeweils die erste und dritte, zweite und vierte Zeile gehören zusammen: Schema: Umrahmende Reime: Die erste und die vierte Zeile sowie die zweite und dritte Zeile reimen sich in einer Strophe: Schema: Mein persönliches Gedicht, Strophenform: 12 Quelle: Klaps, Hannjürgen (2005): Lyrik-Werkstatt Herbst. Fotos, Gedichte, Arbeitsblätter. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. Posten 3: 15 PA Selbstkontro lle Sprachliche Mittel Ziel: Du kannst sprachliche Mittel in einem Gedicht erkennen. Auftrag: Lies die unterstehende Liste mit den sprachlichen Mittel und deren Definitionen. Suche das passende Beispiel zum Begriff (du kannst sie mit der gleichen Farbe bemalen oder auch nummerieren). Einige Beispiele könnten auf mehrere Begriffe zutreffen, doch du darfst jeden Begriff nur einmal verwenden! Alliteration Gleichlautender Anlaut benachbarter Wörter Wiederholung ganzer Wörter Zusammenstellung entgegengesetzter Begriffe Häufung eines Vokals Unvollständiger Satzbau Ein Satz geht in Gedichten über das Versende hinaus, d.h. das Versende ist nicht das Satzende Wiederholung ganzer Wörter am Versende Das Ich im Gedicht, das sich als Dichter ausgibt Ein Ding erhält Eigenschaften oder ist verbunden mit Verben, die sonst nur Menschen zugeordnet sind Eine Sache wird mit einer anderen gleichgesetzt (oft unter Verwendung von wie) Anapher Antithese Assonanz Ellipse Enjambement Epipher Lyrisches Ich Personifikation Vergleich Und sahst mir nach mit nassem Blick: Und doch, welch Glück, geliebt zu werden! Und lieben, Götter, welch ein Glück! Schon stand Die Eiche, wie ein aufgetürmter Riese, da, In deinen Küssen Welche Wonne! Es schlug mein Herz, geschwind Zu Pferde! Doch frisch und fröhlich war mein Mut Wo Finsternis Aus dem Gesträuche Mit hundert Schwarzen Augen sah. Ich sah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz schlug meine Zähgne knirschend aufeinander; Ich weinte nicht Der Mond von einem Wolenhügel Ein aufgetürmter Riese, da, Wo Finsternis aus Dem Gesträuche ragte In deinen Küssen Welche Wonne! In deinem Auge Welcher Schmerz! 13 Quelle: Posten 4: 20 EA Selbstkontro lle Rätselhaftes Gedicht Ziel: Auftrag: Dies ist etwas für Tüftler und Bastler. Findest du die Originalversion heraus? Unter dem Gedicht stehen einige Hinweise, die dir helfen sollen. Hinweise: Die ersten zwei Wörter bedeuten WILLST DU Das dritte Wort in der zweiten Zeile heisst GUTE Nicht alle Buchstaben stammen aus dem deutschen Alphabet. Vielleicht benutzt du zuerst Grossbuchstaben, wie bei einem Kreuzworträtsel. Erst in einer zweiten Fassung schreibst du gross und klein Originalversion: 14 Quelle: Klaps, Hannjürgen (2005): Lyrik-Werkstatt Herbst. Fotos, Gedichte, Arbeitsblätter. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. 5. 15 GA Selbstkontro lle Posten: Gedichtformen Ziel: Du kennst verschiedene Gedichtformen. Auftrag: Bei diesem Posten werden dir 6 Gedichtformen vorgestellt. Jedoch ist der Begriff mit der jeweiligen Definition und das jeweilige Beispiel durcheinander-gekommen. Finde zu jedem Begriff die passende Definition. Du kannst sie nummerieren, verbinden, gleich anfärben oder auch ausschneiden und auf ein neues Blatt richtig aufkleben. Hymne Sonett Rondell Haiku Lehrgedicht Ist ein vierzehnzeiliges Gedicht, das aus zwei vierzeiligen und zwei dreizeiligen Strophen besteht. Die Vierzeiler werden Quartette und die Dreizeiler Terzette genannt. Ist eine traditionelle japanische Gedichtform. Diese besteht aus drei Wortgruppen (Verse) mit fünf, sieben und fünf Lauteinheiten (diese werden als Moren genannt). Im Deutschen werden die Lauteinheiten oft in Silben umgedeutet. Allerdings wird diese Gedichtform zumeist frei umgesetzt, weshalb viele davon weniger als 17 Silben aufweisen. Die erste Zeile des Haikus benennt zumeist einen konkreten Sachverhalt, häufig eine Jahreszeit und hat einen unmittelbaren Bezug zur Gegenwart, also zum Hier und Jetzt. Es war vor allem im Mittelalter und der Antike verbreitet. Es ist zumeist moralisch und hat einen lehrhaften Charakter und kann sämtliche Wissensgebiete streifen. Anzahl der Strophen und Verse sind hier nicht festgelegt. Diese Gedichtart hat keine feste Form, weshalb sie zumeist in freien Versen umgesetzt wird. Die Hymne ist die festliche Preisung, wobei häufig eine Gottheit besungen wird. Dennoch gibt es Beispiele, die Ortschaften oder auch Personen besingen. Gehört zu den Gedichtformen, die zumeist ungereimt sind und umfasst in der Regel ach Zeilen. Es gibt zwei verschiedene Arten, beide haben allerdings gemeinsam, dass sie mi Wiederholen einzelner Elemente spielen. In der ersten Variante besteht jede Zeile aus einem kurzen, aber vollständigen Satz oder einem abgeschlossenen Satzteil besteht, der in der zweiten Zeile durch einen Nebensatz ergänzt wird. Der Satz aus dem ersten Vers wird in Zeile 4 und 7 wiederholt. Die zweite wird im letzten Vers wiederholt. Die Verszeilen 3, 5 und 6 sind weitere Ergänzungen ode verstärken das Hauptthema. In der zweiten geläufigen Variante des Rondells, müssen die Zeilen keine vollständigen oder Satzeinheiten beinhalten. Es ist ausreichend, wenn der Satz, um vollständig zu sein nächsten Satz vervollständigt wird. Hierbei wird außerdem nicht die erste, sondern die 2 in Zeile 4 und Zeile 7 wiederholt. Weitere Wiederholungen sind kein Muss. 15 Quelle: 15 GA Fremdkontro lle Posten Liebesgedicht 6: Ziel: Du kannst selbst ein Gedicht schrieben zu einer vorgegebenen Gedichtform. Auftrag: Lies den Aufbau eines Elfchen-Gedichts durch. Nimm dir anschliessend die bereitgelegten Zeitungen zu Hand und durchblättere diese ein wenig. Entscheide dich für ein Thema (Hass, Liebe, Herbst, usw.). Suche anschliessend nach Wörtern in der Zeitung, mit welchen du dein Elfchen schrieben willst. Klebe sie auf. Aufbau eines Elfchen-Gedichts In der 1. Zeile steht 1. Zeile steht 1 Wort (eine Eigenschaft oder Farbe), In der 2. Zeile stehen 2 Wörter (eine Person oder ein Gegenstand mit dieser Farbe oder Eigenschaft) In der 3. Zeile stehen 3 Wörter (mehr über die Person oder den Gegenstand, z.B. wie er ist oder was er tut) In der 4. Zeile stehen 4 Wörter (ich.? also etwas über dich selbst) Und in der 5. Zeile steht wieder nur 1 Wort (ein abschliessendes Wort: ein Gedanke, ein Gefühl oder eine Stimmung eine Überschrift ähnlich) Beispiel eines Elfchens: Unsicher Dein Blick Alles scheint schwierig Ich lächle dir zu Liebe Eigenes Elfchen: 16 Quelle: Klaps, Hannjürgen (2005): Lyrik-Werkstatt Herbst. Fotos, Gedichte, Arbeitsblätter. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. Lyrik? 15 GA Fremdkontro lle Posten 7: Was ist Ziel: Du kannst die Lyrik von den beiden anderen Gattungen, der Epik und der Dramatik, abgrenzen. Auftrag: Recherchiere auf Internet was Lyrik ist. Konsultiere dabei mehrere Webseiten (nicht nur Wikipedia). Anschliessend löst du die beiden Aufträge. 1) Was ist Lyrik? Fasse das Wichtigste in deinen Worten zusammen (etwa in 4-5 Sätzen). Lyrik gehört neben der Epik und der Dramatik zu den drei Gattungen der Literatur. 2) Notiere mindestens 5 Merkmale der Lyrik. Was unterscheidet sie zu den beiden anderen Gattungen (der Epik und der Dramatik)? 17 8. 15 GA Fremdkontro lle Posten: Gedicht darstellen Ziel: Du kannst ein Gedicht verstehen und es auch auf kreativer Art vortragen. Auftrag: Schau dir mit deinen 3 Mitschüler/Innen das Video von Marco Lima „Der Erlkönig auf Internet an. Dann bist du an der Reihe: Stelle mit deiner Gruppe selbst das Gedicht des Erlkönigs künstlerisch dar (Rap, Vorsingen, Theater, Pantomime.). Diese Darbietung trägst du dann der ganzen Klasse vor. Der Erlkönig Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in dem Arm, Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? – Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? – Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. – „Du liebes Kind, komm, geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel ich mit dir; Manch bunte Blumen sind an dem Strand, Meine Mutter hat manch gülden Gewand. – Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, Was Erlenkönig mir leise verspricht? – Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In dürren Blättern säuselt der Wind. – „Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? Meine Töchter sollen dich warten schön; 18 Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn Und wiegen und tanzen und singen dich ein. – Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern Ort? – Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau: Es scheinen die alten Weiden so grau. – „Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. – Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan! – Dem Vater grausets; er reitet geschwind, Er hält in Armen das ächzende Kind, Erreicht den Hof mit Mühe und Not; In seinen Armen das Kind war tot. Quelle: 9. 15 EA Fremdkontro lle Posten (freiwillig) Ziel: Du kannst ein Gedicht interpretieren und deine Gedanken grafisch festhalten. Auftrag: Lies das Gedicht Der Panter einmal für dich durch. Überlege dir welche Bilder (Farben, Formen.) und Gefühle dir durch den Kopf gehen. Lies das Gedicht ein zweites Mal und zeichne parallel dazu diese Bilder aus deinem Kopf auf. Der Panther Im Jardin des Plantes, Paris Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Rainer Maria Rilke, 6.11.1902, Paris 19 Quelle: (05.04.2016) Lösungsblatt: Posten 1: Metrum Ziel: Du kannst das Metrum eines Gedichtes bestimmen. Auftrag: Lies den unterstehenden Text durch über das Metrum und deren vier Formen (Jambus, Trochäus, Daktylus und Anapäst). Versuche anschliessend die vier Gedichte zu analysieren: unterstreiche unbetonte Silben mit: unterstreiche betonte Silben mit: Tipp: Lies das Gedicht laut für dich durch (mit Klatschen) und überlege dir, welche Silbe du betonst. Entscheide anschliessend, welche Form das Gedicht angehört. Das Metrum: Viele Gedichte besitzen einen eigenen Schwung, einen Rhythmus. Betonte und unbetonte Silben wechseln sich in bestimmter, gelichbleibender Reihenfolge ab. Diese rhythmische Einheit nennt man Versfuss, auch Metrum oder Versmass. Die vier Formen: Jambus: unbetont – betont Trochäus: betont – unbetont Daktylus: betont – unbetont – unbetont Anapäst: unbetont – unbetont – betont 1) Wiederum leuchten die Blätter im Licht Daktylus 20 Tanzen und schwanken und fallen dann Doch 2) Das Fräulein stand am Meere Und seufzte lang und bang, Jambus Es rührte sie so sehre Der Sonnenuntergang. 3) Erste grosse Perlen fallen Wie aus grober Siebe Augen. Trochäus Hell des Daches Bleche knallen, Fels und Strasse sprühn und saugen. 4) Und es wallet und siedet und brauset und Zischt, Anapäst wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt Quelle: Klaps, Hannjürgen (2005): Lyrik-Werkstatt Herbst. Fotos, Gedichte, Arbeitsblätter. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. Lösungsblatt: Posten 3: Sprachliche Mittel Ziel: Du kannst sprachliche Mittel in einem Gedicht erkennen. Auftrag: Lies die unterstehende Liste mit den sprachlichen Mittel und deren Definitionen. Suche das passende Beispiel zum Begriff (du kannst sie mit der gleichen Farbe bemalen oder auch nummerieren). Einige Beispiele könnten auf mehrere Begriffe zutreffen, doch du darfst jeden Begriff nur einmal verwenden! Alliteration Anapher Antithese Assonanz Ellipse Enjambement Epipher Lyrisches Ich Personifikation Gleichlautender Anlaut benachbarter Wörter Wiederholung ganzer Wörter Zusammenstellung entgegengesetzter Begriffe Häufung eines Vokals Unvollständiger Satzbau Ein Satz geht in Gedichten über das Versende hinaus, d.h. das Versende ist nicht das Satzende Wiederholung ganzer Wörter am Versende Das Ich im Gedicht, das sich als Dichter ausgibt Ein Ding erhält Eigenschaften oder ist verbunden mit Verben, die sonst nur Menschen zugeordnet sind 21 Vergleich Eine Sache wird mit einer anderen gleichgesetzt (oft unter Verwendung von wie) Und sahst mir nach mit nassem Blick: Und doch, welch Glück, geliebt zu werden! Und lieben, Götter, welch ein Glück! Schon stand Die Eiche, wie ein aufgetürmter Riese, da, In deinen Küssen Welche Wonne! Es schlug mein Herz, geschwind Zu Pferde! Doch frisch und fröhlich war mein Mut Wo Finsternis Aus dem Gesträuche Mit hundert Schwarzen Augen sah. Ich sah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz schlug meine Zähgne knirschend aufeinander; Ich weinte nicht Der Mond von einem Wolkenhügel Ein aufgetürmter Riese, da, Wo Finsternis aus Dem Gestäuche ragte In deinen Küssen Welche Wonne! In deinem Auge Welcher Schmerz! Quelle: Lösungsblatt: Posten 4: 15 GA Fremdkontro lle Rätselhaftes Gedicht Ziel: Auftrag: Dies ist etwas für Tüftler und Bastler. Findest du die Originalversion heraus? Unter dem Gedicht stehen einige Hinweise, die dir helfen sollen. Hinweise: Die ersten zwei Wörter bedeuten WILLST DU 22 Das dritte Wort in der zweiten Zeile heisst GUTE Nicht alle Buchstaben stammen aus dem deutschen Alphabet. Vielleicht benutzt du zuerst Grossbuchstaben, wie bei einem Kreuzworträtsel. Erst in einer zweiten Fassung schreibst du gross und klein Originalversion: Willst du immer weiter schweigen? Sieh das Gute liegt so nah Lerne nur das Glück ergreifen Denn das Glück ist immer da Quelle: Klaps, Hannjürgen (2005): Lyrik-Werkstatt Herbst. Fotos, Gedichte, Arbeitsblätter. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. Lösungsblatt: 5. 15 GA Fremdkontro lle Posten: Gedichtformen Ziel: Du kennst verschiedene Gedichtformen. Auftrag: Bei diesem Posten werden dir 6 Gdichtformen vorgestellt. Jedoch ist der Begriff mit der jeweiligen Definition und das jeweilige Beispiel durcheinander-gekommen. Finde zu jedem Begriff die passende Definition. Du kannst sie nummerieren, verbinden, gleich anfärben oder auch ausschneiden und auf ein neues Blatt richtig aufkleben. Hymne Sonett Ist ein vierzehnzeiliges Gedicht, das aus zwei vierzeiligen und zwei dreizeiligen Strophen besteht. Die Vierzeiler werden Quartette und die Dreizeiler Terzette genannt. Ist eine traditionelle japanische Gedichtform. Diese besteht aus drei Wortgruppen (Verse) mit fünf, sieben und fünf Lauteinheiten (diese werden als Moren genannt). Im Deutschen werden die Lauteinheiten oft in Silben umgedeutet. Allerdings wird diese Gedichtform zumeist frei umgesetzt, weshalb viele davon weniger als 17 Silben aufweisen. Die erste Zeile des Haikus benennt zumeist einen konkreten Sachverhalt, häufig eine Jahreszeit und hat einen unmittelbaren Bezug zur Gegenwart, also zum Hier und Jetzt. 23 Rondell Haiku Lehrgedicht Es war vor allem im Mittelalter und der Antike verbreitet. Es ist zumeist moralisch und hat einen lehrhaften Charakter und kann sämtliche Wissensgebiete streifen. Anzahl der Strophen und Verse sind hier nicht festgelegt. Diese Gedichtart hat keine feste Form, weshalb sie zumeist in freien Versen umgesetzt wird. Die Hymne ist die festliche Preisung, wobei häufig eine Gottheit besungen wird. Dennoch gibt es Beispiele, die Ortschaften oder auch Personen besingen. Gehört zu den Gedichtformen, die zumeist ungereimt sind und umfasst in der Regel ach Zeilen. Es gibt zwei verschiedene Arten, beide haben allerdings gemeinsam, dass sie mi Wiederholen einzelner Elemente spielen. In der ersten Variante besteht jede Zeile aus einem kurzen, aber vollständigen Satz oder einem abgeschlossenen Satzteil besteht, der in der zweiten Zeile durch einen Nebensatz ergänzt wird. Der Satz aus dem ersten Vers wird in Zeile 4 und 7 wiederholt. Die zweite wird im letzten Vers wiederholt. Die Verszeilen 3, 5 und 6 sind weitere Ergänzungen ode verstärken das Hauptthema. In der zweiten geläufigen Variante des Rondells, müssen die Zeilen keine vollständigen oder Satzeinheiten beinhalten. Es ist ausreichend, wenn der Satz, um vollständig zu sein nächsten Satz vervollständigt wird. Hierbei wird außerdem nicht die erste, sondern die 2 in Zeile 4 und Zeile 7 wiederholt. Weitere Wiederholungen sind kein Muss. Quelle: Lösungsblatt: Lyrik? 15 GA Fremdkontro lle Posten 7: Was ist Ziel: Du kannst die Lyrik von den beiden anderen Gattungen, der Epik und der Dramatik, abgrenzen. Auftrag: Recherchiere auf Internet was Lyrik ist. Konsultiere dabei mehrere Webseiten (nicht nur Wikipedia). Anschliessend löst du die beiden Aufträge. 3) Was ist Lyrik? Fasse das Wichtigste in deinen Worten zusammen (etwa in 4-5 Sätzen). 24 Lyrik gehört neben der Epik und der Dramatik zu den drei Gattungen der Literatur Definition des Dudens: literarische Gattung, in der mit den formalen Mitteln von Reim, Rhythmus, Metrik, Takt, Vers, Strophe u. a. besonders subjektives Empfinden, Gefühle, Stimmungen oder Reflexionen, weltanschauliche Betrachtungen o. Ä. ausgedrückt werden; lyrische Dichtkunst 4) Notiere mindestens 5 Merkmale der Lyrik. Was unterscheidet sie zu den beiden anderen Gattungen (der Epik und der Dramatik)? metaphernreich Versform (äusserliche Form) Rhythmisiert Klangreichtum manchmal gereimt Kürze Strenge sprachliche Form Ausdruckskraft/ Bildhaftigkeit Ansprecher von Empfindungen Bezug auf ein lyrisches Subjekt Fern von Alltagssprache (abweichende Anordnung von Wörter) Quelle: 25