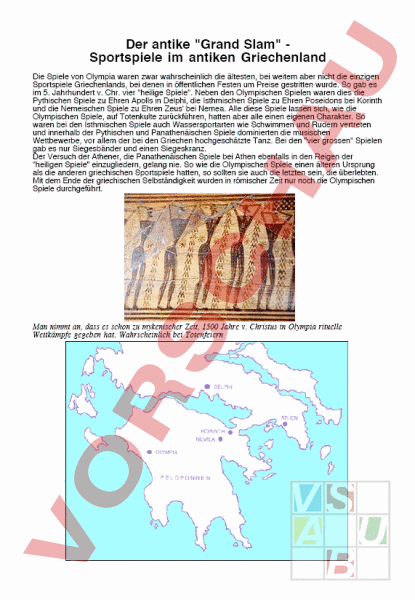Arbeitsblatt: Olympische Spiele (lang)
Material-Details
Ausführliche Schilderung der Geschichte der griechischen Kampfspiele, insbesondere der Olympischen
Geschichte
Altertum
6. Schuljahr
6 Seiten
Statistik
17017
1101
49
13.03.2008
Autor/in
Don (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Der antike Grand Slam Sportspiele im antiken Griechenland Die Spiele von Olympia waren zwar wahrscheinlich die ältesten, bei weitem aber nicht die einzigen Sportspiele Griechenlands, bei denen in öffentlichen Festen um Preise gestritten wurde. So gab es im 5. Jahrhundert v. Chr. vier heilige Spiele. Neben den Olympischen Spielen waren dies die Pythischen Spiele zu Ehren Apolls in Delphi, die Isthmischen Spiele zu Ehren Poseidons bei Korinth und die Nemeischen Spiele zu Ehren Zeus bei Nemea. Alle diese Spiele lassen sich, wie die Olympischen Spiele, auf Totenkulte zurückführen, hatten aber alle einen eigenen Charakter. So waren bei den Isthmischen Spiele auch Wassersportarten wie Schwimmen und Rudern vertreten und innerhalb der Pythischen und Panathenäischen Spiele dominierten die musischen Wettbewerbe, vor allem der bei den Griechen hochgeschätzte Tanz. Bei den vier grossen Spielen gab es nur Siegesbänder und einen Siegeskranz. Der Versuch der Athener, die Panathenäischen Spiele bei Athen ebenfalls in den Reigen der heiligen Spiele einzugliedern, gelang nie. So wie die Olympischen Spiele einen älteren Ursprung als die anderen griechischen Sportspiele hatten, so sollten sie auch die letzten sein, die überlebten. Mit dem Ende der griechischen Selbständigkeit wurden in römischer Zeit nur noch die Olympischen Spiele durchgeführt. Man nimmt an, dass es schon zu mykenischer Zeit, 1500 Jahre v. Christus in Olympia rituelle Wettkämpfe gegeben hat. Wahrscheinlich bei Totenfeiern Die Olympischen Spiele der Antike vereinten und begeisterten die Griechen und wurden in zeitgenössischen Berichten oft dokumentiert, diskutiert, ja sogar in Frage gestellt. Trotz einer Vielzahl vorliegender Quellen sind bis heute viele Fragen unbeantwortet. • • Waren Sie die idealisierten direkten Vorgänger unserer modernen Olympischen Spiele, ohne die negativen Momente des modernen Sportes? Oder waren sie nationale Wettkämpfe ohne Amateurstatus, mit blutigen Attraktionen? Weit über 1000 Jahre hindurch fanden alle vier Jahre an dem heiligen Ort Olympia die antiken Olympischen Spiele statt. Schon in mykenischer Zeit (Mykene liegt ca. 100 km östlich von Olympia), also um 1600-1200 v. Chr., waren sportliche Wettkämpfe ein Bestandteil kultischer Feste. Ein Athlet, der in einem feierlichen Wettkampf unter allgemein akzeptierten Regeln den Sieg errang, wurde als von den Göttern begünstigt angesehen. Kultische Handlungen Mit der dorischen Wanderung wurden die ursprünglich in Griechenland siedelnden Achaier durch dorische Stämme verdrängt. Mit den neuen Völkerstämmen änderten sich auch die Gottheiten, zu deren Ehren die kultischen Handlungen und Sportspiele veranstaltet wurden. Waren es in vordorischer Zeit Muttergottheiten wie Hera und Gaia, wurde Zeus von den Dorern zum wichtigsten Gott Olympias. Gleichzeitig entwickelten sich Jagd und Sport zur vornehmlichen Beschäftigung der entstandenen Adelsgesellschaft die kultischen Anteile verloren in der Folge immer mehr an Bedeutung. Leiteten früher die Priester die Wettkämpfe, so wurden sie nun von professionellen Schiedsrichtern abgelöst. Der heilige Friede Dieser Friede sollte, trotz ununterbrochenen Kriegen zwischen den griechischen Stämmen und Stadtstaaten, nicht nur die Durchführung von Olympischen Spielen für Jahrhunderte sichern, sondern auch die kulturelle Einheit der griechischen Welt fördern. Schon bei der Ausrufung zu den Olympischen Spielen wurde der heilige Friede verkündet, der für die An- und Abreise sowie für die Veranstaltung am heiligen Ort Olympia galt, und dem jeder Ort, der Athleten entsandte, zustimmen musste. Im Einklang mit der ständig steigenden Spezialisierung in den Städten, bedingt durch die billige Sklavenarbeit, kam es auch bei den Wettkämpfen zu Spezialisierungen und zum Berufsathletentum. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Sportspiele und die Höhe der Gewinne bei diesen Festen, so dass es sehr lukrativ sein konnte, Sieger zu sein. Neben die Siegespreise traten noch hohe Startgelder für berühmte Athleten sowie Belohnungen der Stadtstaaten, aus welchen die Gewinner kamen. Es gab Befreiung von den Steuern und kostenlose Verpflegung auf Lebenszeit, Ehrenplätze bei Veranstaltungen, Sach- und Geldgeschenke. Nur in Kriegszeiten hatte es ein Olympiasieger nicht so gut, denn auch hier kämpfte er in der ersten Reihe. Die Anlage von Olympia, im Zentrum der Zeustempel Mit der Eroberung Griechenlands durch die Römer ab 148 v. Chr. verloren die Olympischen Spiele ihren panhellenistischen Charakter. Jetzt waren auch nicht-griechische Teilnehmer zu den Spielen zugelassen. Gleichzeitig missfiel den Römern die Nacktheit der Athleten und die niedere Herkunft der berufsmässigen Trainer; zudem sahen sie keinen praktischen Nutzen in der griechischen Gymnastik und bezeichneten diese als den griechischen Müssiggang. Erst später, mit steigender Achtung der griechischen Kultur, wollten die Römer sich die Spiele zu Nutzen machen, indem sie versuchten, sie durch neue griechisch-römische Spiele in Rom zu ersetzen, was sich aber nicht durchsetzte. Die Olympischen Spiele selbst schrumpften auf eine eher lokale Bedeutung. In der Kaiserzeit versuchten die Römer schliesslich die Olympischen Spiele, die immer noch als Forum aller Griechen angesehen wurden, zu Demonstrationen eigener Macht umzuwandeln. Kaiser wie Tiberius, Germanicus oder Nero nahmen an den Spielen teil, die zum Teil extra für sie veranstaltet wurden. Statt eines nationalgriechischen Festes wurden die Spiele zu einem internationalen Zirkus, der wahrscheinlich nicht einmal mehr regelmässig veranstaltet wurde. So ist es auch eine Ironie des Schicksals, dass der letzte uns überlieferte Olympiasieger ausgerechnet zu den alten Erzfeinden der Griechen zählte: Er war ein persischer Prinz. Einführung Alle Kandidaten für die Wettbewerbe der Olympischen Spiele mussten ein mindestens zehnmonatiges Heimattraining mit speziellen Trainern nachweisen. Dies war aber in der Regel unproblematisch, da es zumindest in der Blütezeit der Spiele für die Adelsjugend Griechenlands zum guten Ton gehörte, eine sportliche, allgemeinkörperliche und geistige Ausbildung in einem Gymnasion zu erhalten. Diese Ausbildung umfasste also weit mehr als nur Körperübungen und war dem damaligen Bildungs- und Erziehungszie untergeordnet. Dabei ging es in erster Linie um das Streben nach militärischer Tugend und Tapferkeit, nicht um das Streben nach Macht, Ruhm oder Geld. Diese Zielsetzung wurde auch bei den Olympischen Spielen verfolgt, was bei anderen Nationen auf Unverständnis stiess. Während um 480 v. Chr. die Spartaner unter Leonidas den Thermopylenpass gegen die Perser verteidigten und starben, feierten die übrigen Griechen die 75. Olympischen Spiele. Dieses strikte Festhalten an der Durchführung der Spiele trotz höchster nationaler Gefahr und der Wettstreit nur um die Ehre und um einen Kranz des Ölbaumes soll die Perser fast zur Verzweiflung gebracht haben. Teilnehmen durften nur freie Griechen, keine Sklaven, keine Ausländer und vor allem keine Frauen. Ihnen ist das Teilnehmen und sogar das Zuschauen bei Todesstrafe untersagt Training im Gymnasion von Elis Neben dem Heimtraining war ein hartes dreissigtägiges Training im Gymnasion von Elis vorgeschrieben an dessen Ende für die erfolgreichen Absolventen der zweitägige Marsch von Elis nach Olympia über 57 Kilometer stand. Innerhalb der dreissig Tage versuchten die eigentlichen Trainer ihre Athleten mit allen legalen und illegalen Mitteln zu motivieren. So liess ein Trainer, dessen Schützling Liebeskummer hatte, seinen Athleten wissen, seine Geliebte wolle nur dann ihm gehören, wenn er olympischen Ruhm erränge. Seine Methode soll erfolgreich gewesen sein. Nicht alle Athleten hielten die Strapazen dieses Trainings durch; viele schieden schon vor den Spielen aus. Durch die immer stärkere Betonung des Kampfes veränderte sich bei den Spielen das Idealbild des Athleten. Besonders bei den Wettkämpfen des Kampfsporttages waren die Sieger nicht mehr die jungen, schönen, schlanken und fettpölsterchenfreien Modellathleten, sondern eher grosse, grobschlächtige, teils überschwere Kriegertypen. Sportlerdiät und Hygiene Gehörte zum Training der Fünfkämpfer und Läufer auch eine überwachte Ernährung aus Gerstenbrot, Weizenbrei, trockenen Feigen, Nüssen und frischem Käse, so wurde die Ernährung im 5. Jh. mit der Einführung des Berufsathletentums freigestellt. Der Ringer Milon von Kroton soll täglich etwa 20 Pfund Fleisch, ebensoviel Brot und dazu 10 Liter Wein zu sich genommen haben. Wenn dies auch sicher übertrieben ist, so wurden die Ringer, Boxer und Pankratiasten mit gebratenem Fleisch aller Art gemästet. Während damit die Diätvorschriften für die Sportler unhaltbar geworden waren, hielt man an den Hygienemassnahmen für die Athleten fest. Während des Trainings kontrollierten die Schiedsrichter das Baden der Athleten (wobei die Athleten die einzigen waren, denen Wasser in ausreichender Menge zur Verfügung stand), ihre Hygiene und ihren Schlaf auf Fellen am Boden. Besonders für die Ringer war es wichtig, die Haut mit Olivenöl und Sand einzureiben, um diese unempfindlich zu machen. Nach dem Training wurde die verschmierte Ölschicht mit dem Schabeisen wieder entfernt. Verstösse gegen die Hygienevorschriften wurden mit Geldstrafen, nicht selten aber auch mit der gefürchteten Peitsche bestraft. Die fünf Wettkampftage (472-400 v. Chr.) 1. Tag: Prozession Zeusopfer Olympischer Schwur der Athleten und Schiedsrichter Wettkämpfe der Knaben im Laufen, Ringen und Faustkampf 2. Tag: Die Hippischen Agonen Wettreiten und Wagenrennen im Hippodrom Fünfkampf der Männer mit Diskuswurf, Weitsprung und Speerwurf, danach Lauf und Ringkampf 3. Tag: Stieropfer für den Gott Zeus Langlauf Stadionlauf und Doppellauf 4. Tag: Der Kampftag Ringkampf, Faustkampf, Pankration und Waffenlauf 5. Tag: Siegerehrungen und kultische Handlungen Die Sportarten der antiken Olympischen Spiele 776 v. Chr.: 724 v. Chr.: 720 v. Chr.: 708 v. Chr.: 688 v. Chr.: 648 v. Chr.: 632 v. Chr.: 616 v. Chr.: 520 v. Chr.: 80 v. Chr.: 67 n. Chr.: Stadionlauf. Erstmals Doppellauf über zwei Stadien. Erster Langlauf, vermutlich 24 Runden. Beginn des Fünfkampfes und des Ringkampfes. Erster geregelter Faustkampf. Wettreiten und Allkampf in Olympia. Erstmals Knabenwettkämpfe im Stadionlauf und Ringen. Erstmals Knaben-Faustkampf. Erster Waffenlauf in Olympia. Von den 175. Olympischen Spielen findet nur der Stadionlauf der Knaben in Olympia statt. Die übrigen Teilnehmer werden zur Durchführung der Wettkämpfe nach Rom gebracht. Nero lässt sich in Olympia als Sieger im Zehnergespannrennen und im Gesang feiern. Der Fünfkampf (Pentathlon) Die Fünfkämpfer waren beim Publikum besonders geliebt. Ihr vielseitiges können und ihre athletischen Körper entsprachen den Vorstellungen der Griechen von einem vollkommenen Menschen 1. Der Diskuswurf: Die Technik des Diskuswurfes glich der heutigen, lediglich wurde damals von einem erhöhten Quadrat, der Balbis, geworfen. Wer dreimal übertrat, war disqualifiziert. Die Wurfweite wurde durch den Abdruck der ersten Bodenberührung bestimmt, wobei Weiten von knapp 30 Metern erreicht worden sein sollen. 2. Der Weitsprung: erfolgte aus dem Stand mit Hilfe von Schwunggewichten, den sogenannten Halteren. Die Sprungweiten wurden in der geharkten Erde der Sprunggrube mit Strichen markiert. Da Sprungweiten von über 16 Metern überliefert sind, wird angenommen, dass fünf Sprünge zusammengezählt wurden. 3. Der Speerwurf: Im Unterschied zum heutigen Speerwurf wurde der Speer mit Hilfe von zwei ledernen Fingerschlaufen von der Balbis aus geworfen. Diese vom Militär übernommene Technik ermöglichte grössere Weiten. Wie bei den anderen Übungen gab es auch hier mehrere Versuche, die grösste Weite zu erreichen. 4. Der Lauf: Der Start erfolgte bei allen Laufdisziplinen von einer Steinschwelle ab, in deren Einkerbungen die Athleten wie in den modernen Startblöcken Halt fanden. Die Laufbahnen waren wie heute 1,25 breit. Beim Fünfkampf wurde wahrscheinlich eine Stadie (ca. 197 Meter) weit gelaufen. 5. Der Ringkampf: Wahrscheinlich war der Ringkampf ein Standkampf, bei dem derjenige Sieger war, der den Gegner dreimal zu Boden werfen konnte. Inwieweit gewalttätige Griffe erlaubt waren, ist umstritten. Sicher war aber das Wegschlagen der Beine und das Beinstellen erlaubt. Beim Fünfkampf gewann wahrscheinlich derjenige, der zuerst drei Disziplinen gewonnen hatte. Gab es nach der vierten Disziplin noch keinen Gewinner, so musste ein Ringkampf der Einzelgewinner entscheiden. Die Kampfdisziplinen Der Faustkampf erforderte eine grössere Härte von den Athleten als der Ringkampf, denn die Kämpfer schlugen solange aufeinander ein, bis einer aufgab oder zusammenbrach. Der anfängliche Lederriemen um die Handknöchel wurde zum Ende durch mit Eisen gespickte Schlagkanten ersetzt. Noch härter als der Faustkampf war der Allkampf (Pankration). Man kämpfte solange mit blossen Händen bis der Gegner aufgab oder sich nicht mehr wehren konnte. So schlug man aufeinander ein, würgte, teilte Tiefschläge aus, trat den Gegner in den Unterleib oder riss ihn an den Ohren. Der Pankration ähnelte der Fortsetzung des Kampfes nach Verlust der Waffen um Leben und Tod, wie er in kriegerischen Zeiten oft wichtig war. Der Waffenlauf der Schwerbewaffneten über zwei Stadien galt als hervorragende Kriegsübung, bei der wie im Kampf mit Helm, Beinschienen und Schild gelaufen werden musste. Mit der Kampftaktik des Waffenlaufes mit dem überraschenden Anrennens des Gegners in voller Rüstung wurden in der Folgezeit in den Perserkriegen grosse Erfolge erzielt. Die Pferdewettkämpfe Die Wagenrennen: Die Rennen der Viergespanne dienten ausschliesslich dazu, Ruhm und Ehre der Fürsten und Herrscher Griechenlands zu veranschaulichen. Hier wurden die Ausstattung der Gespanne als Zeichen des Reichtums, die Siege als Zeichen der Macht angesehen. Am Anfang und Ende der Strecke des eigens für die Wettbewerbe der Pferde gebauten Hippodroms standen Säulen, die bis zu zwölf mal sehr eng und gewagt umfahren werden mussten, wobei es zwangsläufig zu Unfällen kam. Pferdewettreiten: Zur Bereicherung des Programms hatte man bei der 33. Olympiade das Wettreiten eingeführt. Wie bei allen Kämpfen, an denen Pferde beteiligt waren, wurde auch beim Wettreiten die Ehre des Sieges dem Besitzer des Pferdes, nicht dem Reiter zuteil. Damit waren die Pferde die wahren Helden der Wettkämpfe, die Reiter blieben unbedeutend. So wurde z.B. der Stute Aura nach gewonnenem Rennen der Sieg zuerkannt, obwohl sie schon kurz nach dem Start ihren Reiter verloren hatte Als Zuschauer bei den antiken Olympischen Spielen Wir müssen uns die Olympischen Spiele in ihrem goldenen Zeitalter als grosse, gesamtgriechische Volksfeste vorstellen. Die mehr als 40.000 Zuschauer, die die Spiele verfolgten, waren in dem kleinen Tal ohne Bäder, ohne sanitäre Einrichtungen, Unterkunftsmöglichkeiten und ausreichende Wasserversorgung zusammengezwängt; nur für die Athleten stand eine grosszügige Badeanlage bereit. Die Zuschauer mussten im Tal in der prallen Sonne ihre Zelte aufschlagen im Stadion selbst durften keine Kopfbedeckungen getragen werden. Als Folge dieser katastrophalen Zustände starb z.B. der Philosoph Thales von Milet bei den 58. Olympischen Spielen an Hitze und Durst. Strassenhändler boten Votivstatuen feil, Erfrischungen und Andenken wurden verramscht, Jongleure, Zauberer und Wahrsager führten ihre Künste vor. Dichter versuchten durch Lesungen auf sich aufmerksam zu machen, Philosophen der verschiedenen rivalisierenden Schulen diskutierten lautstark gegeneinander, um ihre Redekünste herauszustellen. Zu diesem ungeheueren Gedränge auf nur ca. 1000 Quadratmetern kam ein bestialischer Gestank durch die Exkremente und die Opferung unzähliger Tiere auf den Altären, deren Fleisch, da es meist nicht gegessen werden durfte, in der Sonne verfaulte. Wer diese Mischung aus Fäkalien, verbrannten oder verfaulendem Tierfleisch, menschlichen Ausdünstungen, Todesschreien der Tiere, monotoner Musik und endloser Rhetorik überlebte, geriet wahrscheinlich zwangsläufig in die berühmte Olympische Ekstase. Ein Scherz der Antike besagte, dass es für einen Sklaven eine härtere Bestrafung sei, als Zuschauer zu den Olympischen Spielen mitgenommen zu werden, als in der Mühle Schwerstarbeit zu leisten. Ein berühmter olympischer Sieger: Milon von Kroton Bestes Beispiel für einen berühmten Sieger war der Ringer Milon von Kroton, der vor seinen olympischen Erfolgen als Erwachsener schon Sieger im Knabenringen war. Seine Ess- und Trinkkünste müssen allerdings noch erstaunlicher gewesen sein als seine Fähigkeiten als Ringer; so soll er einst neun Liter Wein auf einen Sitz getrunken haben. Im Kriege trat er auf wie Herkules, mit Keule und Löwenfell. Wir dürfen uns Milon von Kroton trotzdem nicht wie einen geistlosen Muskelprotz vorstellen. Er war Sänger, Dichter und Buchautor, zudem ein enger Freund von Pythagoras, dem grossen griechischen Philosophen und verstand sich in seiner Lebensführung als Verkörperlichung des pythagoreischen Ideals der Harmonie von Körper und Geist. In den Mythen der Griechen traf Milon ein Ende, wie es einem Halbgott zukam: Allein im Wald sah er einen frisch gefällten Baum, in dem Keile zum Spalten steckten. Von der eigenen Kraft überzeugt, steckte er beide Hände in den Spalt, um so den Baum zu zerreissen. Es gelang ihm auch, den Baum so weit auseinander zu ziehen, dass die Keile herausrutschten; dann aber schnappte der Baum zurück und beide Hände Krotons wurden eingeklemmt. Allein im Wald wurde Kroton in der Nacht dann von wilden Tieren zerrissen. In Wirklichkeit wurden Milon und andere Anhänger des Phythagoras allerdings auf Geheiss eines vom Orden der Pythagoreer abgelehnten Mitbürger niedergemetzelt.