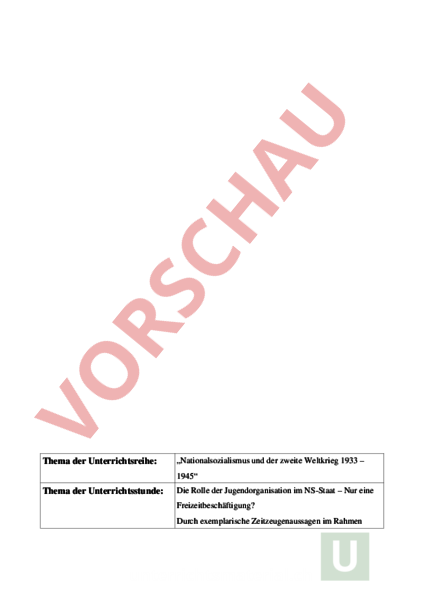Arbeitsblatt: Die Hitlerjugend
Material-Details
Unterrichtsentwurf und Material
Geschichte
Neuzeit
9. Schuljahr
21 Seiten
Statistik
171240
1450
33
01.05.2017
Autor/in
Blüten Zauber
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Thema der Unterrichtsreihe: „Nationalsozialismus und der zweite Weltkrieg 1933 – 1945 Thema der Unterrichtsstunde: Die Rolle der Jugendorganisation im NSStaat – Nur eine Freizeitbeschäftigung? Durch exemplarische Zeitzeugenaussagen im Rahmen eines Partnerpuzzles werden die Freizeitangebote und die Erziehungsziele der Jugendorganisation benannt und die NSErziehung als Instrument nachhaltiger Machtsicherung in Ansätzen beurteilt. Inhaltsverzeichnis 1. Längerfristige Unterrichtszusammenhänge 1 1.1. Leitgedanken und Intention 1 1.1.1 Legitimation der Unterrichtsreihe 1 1.1.2 Lernausgangslage der Lerngruppe 2 1.1.3 Sachanalyse 2 1.1.4 Konzeptionelle Anlage der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge 3 1.1.5 Kompetenzförderung 4 1.2 Tabellarische Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge 2. Planung der Unterrichtsstunde 5 6 2.1 Legitimation der Unterrichtsstunde 6 2.2 Lernvoraussetzungen 7 2.3 Lernaufgabe 7 2.3.1 Didaktische Überlegung 7 2.3.2 Methodische Entscheidung 8 2.4 Ziele der Unterrichtsstunde Kompetenzzuwachs 10 2.5 Verlaufsplanung der Unterrichtsstunde 11 3. Literaturangaben 13 3.1 Didaktik und Methodik 13 3.2 Lehrpläne 13 3.3 Literatur zur Thematik 13 3.4 Websites 13 3.5 Bilder 14 0 4. Anhang 15 1. Längerfristige Unterrichtzusammenhänge 1.1 Leitgedanken und Intention 1.1.1 Legitimation der Unterrichtsreihe Die vorliegende Unterrichtsreihe wird zum einen durch den Kehrlehrplan Geschichte legitimiert. Das Inhaltsfeld 11 „Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg beinhaltet unter anderem die Ausprägung und Auswirkungen der NSHerrschaft und die Ziele, Ereignisse und Strukturen der NSGewaltherrschaft mit Genozid sowie individuelle Verhaltensunterschiede von Zeitgenossen. 1 Es bildet somit die Basis für die vorliegenden und die nachfolgenden Unterrichtseinheiten. Zum anderen wird die Unterrichtsreihe durch den schulinternen Lehrplan Gesellschaftslehre der . Auch das an der Schule verwendete Lehrwerk „Gesellschaft bewusst enthält die einzelnen Themenbereiche.2 Schülerinnen und Schüler sind oft sehr interessiert an der Zeit zwischen 1933 und 1945, da diese Zeit bis heute spürbare Auswirkungen hat. Dieses Thema bietet daher die Möglichkeit, dass sich die Jugendlichen intensiv mit diesem Zeitraum auseinandersetzen und so aus dem Vergangenen für die Zukunft lernen können. Das Thema Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg in Deutschland stellt im Unterricht eine besondere Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer dar, da das Thema sensibel und reflektiert behandelt werden muss. Denn auch heute noch gibt es in Deutschland eine Gruppe von Menschen, die Teile der nationalsozialistischen Vergangenheit leugnen und der nationalsozialistischen Ideologie anhängen. Daher ist die intensive Behandlung dieses Themas im Geschichtsunterricht ein Beitrag, um eine Manipulation und Verführung der Schülerinnen und Schüler durch rechte Kreise 1 Vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung, Kernlehrplan Gesellschaftslehre NRW, S. 20. 2 Vgl. Andreas Bremm, Bonn Myrle DziakMahler, Köln Peter Kirch et al.; Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. In: Gesellschaft bewusst, 3 (2012). S2866. 1 zu verhindern. Das Thema Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus ist für Schülerinnen und Schüler oft greifbarer, als andere Aspekte dieser Zeit. Besonders Erziehung und Schule knüpft an ihre alltägliche Erfahrungswelt an. Das Anliegen der vorliegenden Unterrichtssequenz ist es, die Lernenden einerseits durch belegte Fakten und andererseits über die historischen und gegenwärtigen Perspektiven der NSZeit aufzuklären und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Urteil zu bilden.3 1.1.2 Lernausgangslage der Lerngruppe 1.1.3 Sachanalyse Im Jahre 1933 kam Hitler an die Macht. Innerhalb kürzester Zeit kontrollierten die Nationalsozialisten alle staatlichen Einrichtungen. Durch die Gleichschaltung der Politik und Gesellschaft konnte die NSDAP ihre Macht absichern. Die Gesellschaft sollte Hitlers Ideologie akzeptieren und sich ihr anpassen. Auch Jugendliche konnten sich seinem Einfluss nicht entziehen. Hitlers Ziel war, ein Volk zu erschaffen, das stark, athletisch und furchtlos sein sollte. Die Jungen sollten zu kleinen Soldaten erzogen werden, damit sie später in den Krieg ziehen konnten. Die Mädchen sollten zu Müttern herangezogen werden, die dem Deutschen Reich viele gesunde Söhne gebären sollten. Die Kinder und Jugendlichen waren viel einfacher manipulierbar als Erwachsene. Die Ausgrenzung der Juden hatte am 1. April 1933 mit dem „Judenboykott begonnen. Seitdem wurde die Ausgrenzung mit unzähligen Verordnungen und Gesetzen, darunter die Nürnberger Gesetze von 1935, die die Juden ihrer Bürgerrechte beraubten, weiter vorangetrieben. Am 9. November 1938 fand auf Veranlassung Goebbels im ganzen Reich eine Pogromnacht statt, in der jüdische Gotteshäuser niedergebrannt, jüdische Geschäfte zerstört, jüdische Menschen misshandelt, inhaftiert und ermordet wurden.4 Der zweite Weltkrieg begann am 31.August 1939 mit dem Überfall auf Polen. Die deutsche Armee besetzte Skandinavien, Frankreich, Jugoslawien und Griechenland und überfiel die Sowjetunion. Hitler hoffte, die Sowjetunion 3 Vgl. Sauer, Geschichte unterrichten, S.16. 4 2 schnell zu besiegen. Die Sowjetarmee Rote Armee genannt war aber stärker als er gedacht hatte. Die Schlacht bei Stalingrad vom 1942 bis 1943 entschied über den Ausgang des zweiten Weltkrieges. Nach ihrem Sieg bei Stalingrad rückte die Rote Armee in Deutschland ein. Der Minister Goebbels rief auf zum Totalen Krieg: In Deutschland wurden alle alten Männer, viele Frauen und sogar Jungen ab 14 Jahre gezwungen, in der Armee zu kämpfen. 1944 verbündete sich die Sowjetunion mit Amerika, Großbritannien und Frankreich. Die Verbündeten griffen die deutsche Armee von Frankreich aus an. Im April 1945 beging Hitler Selbstmord. Am 3. Mai 1945 eroberte die Rote Armee Berlin. Am 8. Mai 1945 wurde die Kapitulation unterschrieben. Deutschland hatte den Krieg verloren. Japan, das im zweiten Weltkrieg mit den USA im Kampf lag, kapitulierte nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki am 2. September 1945. 5 Um den Lernenden einen Zugang zu diesem Themenkomplex zu ermöglichen, werden verschiedene Schwerpunktthemen beleuchtet (didaktische Reduktion). Zunächst wurde die Frühe Geschichte der NSBewegung also die Anfänge, Ziele und Ideologien der NSDAP aufgezeigt, dann wurde die Phase der Machtergreifung beleuchtet, Probleme der Massenarbeitslosigkeit in der Weimarer Republik ökonomische, soziale und politische Implikationen wurden besprochen. Im Zentrum der Unterrichtreihe steht das politische System des Nationalsozialismus und die Gleichschaltung der Politik und Gesellschaft. Nachdem diese erfolgt, wird die Jugend im NSStaat besprochen und darüber diskutiert, ob die Jugend Mittäter oder Opfer des NS Staates waren. Danach werden die Motive und Intentionen der verschiedenen Widerstandskämpfer z.B Edelweißpiraten, Weiße Rose, Swing Jugend und Stauffenberg beleuchtet und miteinander verglichen. Im Folgenden wird begründet inwiefern der Widerstand der verschiedenen Gruppen die NSRegierung beeinträchtigten. Des weiteren werden Gründen für das Scheitern der Widerstandsbewegung besprochen. Abschließend wird zu dem Zitat „Man konnte nichts tun Stellung genommen und darüber diskutiert. Die Nächste Unterrichtssequenz beinhaltet das Thema Holocaust. Hier wird das Leben der Jüdinnen und Juden in den Jahren 19331943 beschrieben und die Entrechtung, Verfolgung und Ermordung europäischer Juden, Sinti und Roma, Andersdenkender zwischen 1933 und 1945 beleuchtet. 1.1.4 Konzeptionelle Anlage der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge Die Unterrichtsreihe „der Nationalsozialismus und zweiter Weltkrieg ist ein Epochenquerschnitt. Innerhalb dieser Unterrichtsreihe werden verschiedene Themengebiete (Politik, Gesellschaft, 5 3 Lebensbedingungen, etc.) untersucht. Somit können die Lernenden aus den unterschiedlichen Teilbereichen Erkenntnisse gewinnen und diese auf andere Teilbereiche der Reihe anwenden. Welches zu einem ganzheitlichen Bilde der Epoche (Epochenprofil) führt.6 In dieser Unterrichtsreihe wird besonders darauf geachtet, dass das Vorwissen der Lernenden Aktiviert wird. Somit erhalten die Lernenden die Gelegenheit, die neuen Inhalte mit den vorhandenen kognitiven Strukturen zu verbinden. Durch das aktivieren der mentalen Netze, haben die Lernenden eine Möglichkeit, das neu zu Lernende geistig zu verarbeiten, zu integrieren und zu behalten. Daher ist es besonders wichtig, zu Beginn eines Lernprozesses die mehr oder weniger komplexen Wissensbestände der Schülerinnen und Schüler zu aktivieren. Diese werden beim Lernen dann weiter differenziert, ergänzt oder verändert. Die notwendige Aktivierung des Vorwissens erfolgt mit Hilfe des Dreischrittes ThinkPairShare, wo die Schülerinnen und Schüler wiederholen müssen, „Was habe ich in der/ den Letzten Stunden gelernt?.7 Des weiteren wird in der Unterrichtsreihe an bestimmten Stellen auf individuelles Lernen Rücksicht genommen und bestimmte Inhalte oder auch Methoden Differenziert. Die Differenzierung erfolgt durch die Bereitstellung von Hilfekarten oder durch homogene Lerngruppen, wo die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Leistungsanforderungen erfüllen müssen. Besonders Wert wurde in dieser Unterrichtsreihe auf Schüleraktivierung gelegt. Die Schüleraktivierung erfolgt durch kooperative Lernformen wie z.B Partnerpuzzle, ThinkPaireShare Gruppenvorträge u.s.w Die Leistungsbewertung in dieser Reihe erfolgt, durch die kriterienorientierte Noten der Gruppenvorträge, mündliche Leistungen, Geschichtsmappen. 1.1.5 Kompetenzförderung Der Kompetenzzuwachs innerhalb der Sachkompetenz findet am Anfang der Unterrichtsreihe durch die Einordnung und Erläuterung der Machtübernahme Hitlers. Im Folgenden wird die Intention und Ideologien Hitlers herausgearbeitet.Anschließend werden die Gründe und Motive die zum Zweiten Weltkrieg führten erörtert. Die Lernenden werden dazu angeleitet, historische Perspektiven kurzzeitig zu übernehmen und historische Lebenssituationen mit der eigenen zu vergleichen. Durch die vielfältige Kompetenzförderung im Bereich der Methodenkompetenz, findet ein Kompetenzzuwachs statt. Die Lernenden können mit Sachtexten, Quellentexten, Liedtexten, Bildquellen und Dokumentarfilmen arbeiten. 6 Vgl. Sauer, Geschichte unterrichten, S.60. 7 Vgl. Ludger Brüning/Tobias Saum, Schüleraktivierendes Lehren und Kooperatives Lernen – ein Gesamtkonzept für guten Unterricht. In: GEW NRW (Hg.), Frischer Wind in den Köpfen. (Sonderdruck) Bochum 2011. S.9 4 Die Unterrichtsreihe ermöglicht, durch die verschiedenen Situationen der historischen Personen die Schülerinnen und Schüler im Bereich Urteilskompetenz auszubilden. Die Lernenden werden angespornt anhand von historischen Erkenntnissen einen Urteil zu bilden. Diese müssen durch Argumente und gegebenfalls durch Belege unterstützt werden. Die Handlungskompetenz werden anhand von Diskussionsrunden gefördert. Hier müssen die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Meinung oder Position vertreten. Der Lernprozess ist spiralförmig angelegt. 1.2 Tabellarische Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge Vorherige Unterrichtssequenz: „Das politische System des Nationalsozialismus und die Gleichschaltung der Politik und Gesellschaft. Std. Thema der Unterrichtsstunde Beabsichtigter Lernzuwachs und Kompetenz entwicklung (Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten .) 12. Std. Wie legitimierten die Nationalsozialisten ihre Politik? Die Ideologie der NSHerrschaft Selbstständige Erarbeitung der charakteristischen Eigenschaften der Rassenlehre, des Antisemitismus, der Lebensraumtheorie und der „Volksgemeinschaft anhand von Quellentexten, Vergleichen eine Karikatur über die Flüchtlingspolitik mit dem Plakat aus der NSZeit mit anschließendem Diskussion über die Konsequenzen des eigenen politischen Handelns im Hinblick auf die NS Ideologie. können die charakteristische Eigenschaften der Rassenlehre, des Antisemitismus der Lebensraumtheorie und der „Volksgemeinschaften aus verschiedenen Quellentexten entnehmen und die Gemeinsamen Ziele dieser herausarbeiten (SK). können die Karikatur und das Plakat der NS Zeit zeitlich zuordnen (MK). können Gründe nennen wie gegen die Flüchtlinge in der heutigen Zeit gehetzt wird (MK). können Gründe nennen wie gegen nicht arischen Menschen in der NSZeit gehetzt wurde (MK). können die Karikatur und das Plakat der NS Zeit miteinander vergleichen und erarbeiten die gemeinsamen Intention (die Belastung der Bevölkerung durch die Flüchtlinge und Juden). (MK). können Stellung nehmen und begründen ihr eigenes politisches Handeln im Hinblick auf die NSIdeologie (HK). 3. Std. Das Fahnenlied der Hitlerjugend können reflektieren wie das Lied auf sie wirkt (HK). gemeinschaftsstiftender können Schlüsselbegriffe aus dem Liedtext Liedgesang? entnehmen und begründen welche Bedeutung 5 es für den Inhalt des Liedes hat (MK). können die Botschaft des Liedes benennen und begründen (MK). 4. Std. Schule und Bildung im NSStaat können die Auswirkungen der NSIdeologie auf die schulische Erziehung der Jugend erläutern (SK). erkennen, dass Kinder und Jugendliche im Unterricht zur Zeit der NSRegierung direkt und indirekt im nationalsozialistischen Sinne beeinflusst wurden. (SK). können Sach und Werturteile zu den nationalsozialistischen Erziehungsprinzipien stellen (UK). 5. Std. Die Rolle der Jugendorganisation im Siehe Punkt 2.4 NSStaat – Nur eine Freizeitbeschäftigung? Durch exemplarische Zeitzeugenaussagen im Rahmen eines Partnerpuzzles werden die Freizeitangebote und die Erziehungsziele der Jugendorganisation benannt und die NSErziehung als Instrument nachhaltiger Machtsicherung in Ansätzen beurteilt. 6.Std. Die SwingJugend 7.Std. Abschlussdiskussion: Die Jugend im NS-Staat – Mittäter oder Opfer? können einen Bericht anhand von ThinkPair ShareVerfahrens erarbeiten (MK). können die Vorwürfe an die SwingJugend benennen (SK). können den Widerstand der SwingJugend Beurteilen und anhand des Berichtes festlegen. (HK) können anhand von erworbenem wissen Stellung nehmen (SK). können ihre eigene Positionen in angemessener Form vertreten (HK). Nachfolgende Unterrichtssequenz „Widerstand in der NSZeit – Gründe für das Scheitern des Widerstands. Eine schüleraktivierende Unterrichtsreihe zu den Widerstandskämpfern in der NS Zeit. 2. Planung der Unterrichtsstunde 2.1 Legitimation der Unterrichtsstunde 6 Die folgende Unterrichtsstunde legitimiert sich anhand des Kernlehrplans für die Gesamtschule im Fach Gesellschaftslehre als auch durch den schulinternen Lehrplan der (s.Punkt.1.1). Neben dieser formalrechtlichen Legitimation gibt es weitere Gründe, die Sichtweise Jugendlicher auf die NSJugendorganisation zu thematisieren sowie Motive für ihre Begeisterung zu beleuchten.8 Durch die leichte Zugänglichkeit und das Interesse am Thema, können sich die Schülerinnen und Schüler mit der Geschichte und den Erlebnissen anderer Jugendlichen eher identifizieren als andere Personengruppen. Insbesondere die Entscheidungssituation des Eintritts in die HJ/ den BDM, vor der die Schüler zur Zeit des Nationalsozialismus gestanden hätten, kann sie zum Nachdenken bringen, wie sie sich damals verhalten hätten. Durch diese Entscheidungssituation entsteht ein Gegenwarts und Zukunftsbedeutung. Zumal die Schülerinnen und Schüler immer wieder vor Entscheidungsprozessen stehen, bei denen sie Vor und Nachteile vor Augen haben und sich entscheiden müssen, entweder mitzumachen oder ausgeschlossen zu werden. Die Lernenden erkennen, mit welchen Mitteln die Nationalsozialisten durch dir HitlerJugend viele Jugendlichen begeisterten und beeinflussen konnten. Die Lernenden können somit ähnliche Beeinflussungen und Propaganda heutiger rechter Gruppen leichter durchschauen und diese entgehen. 2.2 Lernvoraussetzungen Im Mittelpunkt der Unterrichtsreihe steht die Jugend im NSStaat. Die Stunde knüpft unmittelbar an Vorkenntnisse der vorangegangenen Unterrichtsstunden an. Die NS – Ideologie wurde in ihren Grundzügen besprochen. Des weiteren verfügen die Schülerinnen und Schüler wissen über den Aufbau der damaligen Schulen und den Lehrplan. Methodisch ist die Lerngruppe mit dem Partnerpuzzle als kooperative Lernform vertraut. Die Schülerinnen und Schüler können historische Quellentexte wiedergeben und die daraus resultierenden Intentionen herausarbeiten und anwenden. Des weiteren ist zu erwähnen, dass die Klasse 9a über ein hohes Maß an sozialen Kompetenzen und setzt diese in Partnerpuzzle um. 2.3 Lernaufgabe 2.3.1 Didaktische Überlegung Das zentrale Thema der Unterrichtsstunde ist die Frage, ob die Jugendorganisation „Hitlerjugend 8 Vgl. Bergmann Klaus/ Thun, Susanne; Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus. In: Geschichte lernen Heft 24 (1991). S.19 7 und „Bund Deutscher Mädel eine Freizeitbeschäftigung war oder nicht. Das zunächst unverfängliche Freizeitangebot mit Liedern, Wanderungen und Gemeinschaftserlebnissen sprach viele Kinder und Jugendliche an, die bislang solche Aktivitäten nicht kannten oder sich nicht leisten konnten. Andere hingegen erhofften sich Vorteile für ihre berufliche Zukunft oder suchten eine Möglichkeit, um eine Pause von Schule oder Elternhaus zu bekommen.9 Bei genauerer Betrachtung sieht man, dass alle angeführten Tätigkeiten dasselbe Ziel hatten. Die Jugend sollte sich nach der NSIdeologie richten, diese sollte durch die Erziehungsinstitutionen erreicht werden. Die Männer sollten auf ein Leben als späterer „Deutscher Soldat und die Frauen sollten auf ein Leben als Hausfrau und Mutter vorbereitet werden.Aus diesem Grund lief die Erziehung je nach Geschlecht anders ab, weshalb es nicht nur die Hitlerjugend, sondern auch den Bund Deutscher Mädel gab. Demnach kann man sagen, dass beide Organisationen in erster Linie auf eine Erziehung zu Gehorsam, Disziplin, Pflichterfüllung und Opferbereitschaft ausgerichtet waren. Diese Ziele galten als Grundlage für die ideologische Erziehung.10 Abschließend ist festzuhalten, dass die früheren Jugendorganisationen keineswegs nur der Freizeitgestaltung dienten und nicht im Sinne der Jugendlichen entstanden, sondern sehr durchdachte Hintergründe hatten. Alle Tätigkeiten trugen dazu bei, den nationalsozialistischen Gedanken weiterzuführen und im Kopf der Jugendlichen zu verankern. Dies tarnten die Nationalsozialisten, indem sie mit einer vielversprechenden Freizeitgestaltung warben und die Jugendlichen somit anlocken konnten. Die Auswahl der beiden Zeitzeugenaussagen erfolgte im Hinblick auf die Leitfrage der Stunde und erschien mir funktional. Beide Aussagen der Zeitzeugen wurden aus didaktischen Gründen qualitativ und quantitativ reduziert. Einerseits, um Verständnisproblemen vorzubeugen, andererseits, um durch die Kontrastivität die beiden Kategorien der Leitfrage eindeutig zu bedienen. Die Partnergruppen sind heterogen organisiert, damit leistungsschwächere Lernende durch leistungsstarke Schülerinnen und Schüler unterstützt werden können. Des weiteren haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit in der Erarbeitungsphase Tippkarten zu heranzuziehen und somit wird auch eine Differenzierung gewährleistet. Es ermöglicht schwache Schülerinnen und Schüler die Aufgaben zu lösen. 2.3.2 Methodische Entscheidungen Als Einstieg dient ein stummer Impuls bestehend aus den Folien 14. Auf den Bildern sind zum einen Propaganda Plakate der Jugendorganisation zu sehen und zum anderen einige Aktivitäten, die 9 Krentz, Natalie 2002: Der Bund Deutscher Mädel (BDM). 10 Hg. Stadt Köln: Hitlerjugend (HJ). 8 die Jugend in der Jugendorganisation ausübten. Der Einstieg als Stummer Impuls, soll die Schülerinnen und Schüler dazu animieren, das Bild zu beschreiben und im Weiteren ihr Vorwissen und ihrer Vermutungen bezüglich des Unterrichtsthemas zu aktivieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen spätestens zum Ende der Phase erkannt haben womit wir uns in dieser Unterrichtsstunde beschäftigen und benennen ansatzweise das Thema der Unterrichtsstunde. Nachdem dies erfolgt, wird kurz der Verlaufsplan von der Lehrperson wiedergegeben. Laut Hilbert Meyer erleichtert und begünstigt eine klare Strukturierung des Unterrichts Lernprozesses. 11 Somit wird den Lernenden der Verlauf der Stunde transparent gemacht, indem ein Stundenverlaufsplan an der Tafel steht. Die Verlaufstranzparenz bietet den Lernenden die Möglichkeit jederzeit zu wissen, in welcher Phase sich das Unterrichtsgeschehen befindet. Es werden zwei Zeitzeugen Texte zum Thema „Hitlerjugend und „Bund Deutscher Mädel ausgeteilt alle Schülerinnen und Schüler bekommen einen Zeitzeugentext und ein Arbeitsblatt Die Aufgabe 1a) wird gemeinsam gelesen, um Probleme aufzudecken und vorzubeugen.Während der Erarbeitung ist eine innere Differenzierung sinnvoll, da leistungsstarke Schülerinnen und Schüler die Aufgaben sicherlich schnell durchdringen werden, wohingegen schwächere Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Stellen Probleme bei der Bearbeitung haben könnten. Eine Differenzierung mit Hilfe von TippKarten, die insbesondere schwächeren Schülerinnen und Schülern Hilfestellungen und Struktur bieten, soll als Mittel der individuellen Förderung und zur Integration aller Lernenden dienen. Hierbei können die einzelnen Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, ob sie die TippKarten zu Hilfe nehmen. Durch diese Differenzierung wird allen ermöglicht, an dem anschließenden Partnerarbeit teilzunehmen. Zudem ist auf dem Arbeitsblatt eine Zusatzaufgabe sowie eine weiterführende Übungsaufgabe vorhanden, mit denen sich schnellere Schülerinnen und Schüler nach Bearbeitung der Elementaraufgaben befassen können. In der Erarbeitungsphase wurde die Methode Partnerpuzzle gewählt. Laut Brüning und Saum ist diese Form der arbeitsteiligen Partnerarbeit Schüler aktivierend und lernwirksam. Durch die wechselseitige Abhängigkeit wird der Partner gleichsam zum Lehrer, der den anderen Schüler unterrichtet. Aus diesem Grund erfolgt eine Intensive Kooperation statt. 12 Diese Unterrichtsform habe ich ausgewählt, da sie sich gut für die Aneignung von neuen Lerninhalten eignet. In der Ersten Phase des Partnerpuzzle sollen die Lernenden zunächst den Zeitzeugen Text in Einzelarbeit lesen und die Aktivitäten und Erziehungsziele der Jugendorganisation unterstreichen. Nachdem diese Erfolgt wird nach Verständnisfragen gefragt, um auftretende Verständnisschwierigkeiten aufzudecken und vorzubeugen. Anschließend sollen die 11 Vgl. Meyer Hilbert: Was ist guter Unterricht? Berlin 2004, S.2538. 12 Vgl. Brüning und Saum: Methodenkoffer Kooperatives Lernen 2014, S.1 9 Lernenden ihre Ergebnisse in eigenen Worten in die Tabelle auf dem Arbeitsblatt eintragen. Nachdem erfolgt die Partnerarbeit I. Hier sollen die Lernenden sich zum dahinter sitzenden Klassenkameraden drehen und über den selben Zeitzeugen Text austauschen ihrer Ergebnisse vergleichen und korrigieren. In der Partnerarbeit II sollen die Schülerinnen und Schüler sich mit dem Sitznachbarn über ihre Ergebnisse austauschen und diese in die eigene Tabelle eintragen. Daraufhin sollen die Lernenden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Erziehungsziele der BDM und HJ herausarbeiten. Nachdem der Partneraustausch erfolgt, werden die Lernenden gebeten nach vorne zu schauen. Die Schülerinnen und Schüler werden in die Sicherungsphase hingeführt. Die Sicherung erfolgt im Plenum und die Ergebnisse werden auf einer Folie festgehalten. Die Lernenden korrigieren und ergänzen ihre Ergebnisse auf dem Aufgabenblatt. Daraufhin sollen die Schülerinnen und Schüler beantworten welche Rolle die Mädchen und die Jungen in der NSZeit einnehmen sollten. Nachdem sollen sie beschreiben wonach sich die Erziehungsziele und Aktivitäten richteten (Stichpunkt: Ideologien). Und sollen begründen welche Intention sich hinter Hitlers Ideologien verbirgt. Abschließend wird eine Diskussionsrunde eingeführt. Die Lernenden sollen sich in die Lage der damaligen Jugendlichen hineinversetzen. Die Lernenden sollen begründen und diskutieren, warum sie an der Jugendorganisation „Hitlerjugend oder „Bund Deutscher Mädel begeistert wären oder nicht begeistert wären. Ziel der Diskussionsrunde ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihr neu erworbenes Wissen anwenden können und selber darüber reflektieren können. Des weiteren sollen die Lernenden die Jugend in der NSZeit nachvollziehen, die sich für die Jugendorganisation entschlossen haben. 2.4 Ziele der Unterrichtsstunde/ Kompetenzzuwachs Die Schülerinnen und Schüler • können anhand des Bildes „Jugend dient dem Führer (Propaganda – Plakat der Hitlerjugend (1935) und Werbeplakat der HitlerJugend/Bund Deutscher Mädel (1940) eines zweiten Bildes (Freizeitbeschäftigung) das Thema der Stunde: „Die Rolle der Jugendorganisation im NSStaat – Nur eine Freizeitbeschäftigung? annäherungsweise benennen und diese Materialien der NSZeit einordnen (MK 6). • können anhand der Tabelle, die einen Vergleich darstellt, die Funktionen (Erziehungsziele und Aktivitäten) und die Rollen der Geschlechter („Bund Deutscher Mädel (BDM) und „Hitlerjugend (HJ)) analysieren (Partnerpuzzle, erste Phase der Partnerarbeit). Außerdem 10 können sie in Partnerarbeit (Partnerpuzzle, zweite Phase der Partnerarbeit) die Handlungsmöglichkeiten dieser Gruppen (BDM HJ) anhand der Gemeinsamkeiten und Unterschiede analysieren (SK 9). • können durch impulsive Fragestellungen in der Ergebnissicherungsphase die Mittel der Herrschaftssicherung im Nationalsozialismus beschreiben. (Urteilskompetenz) • können den Nationalsozialismus als eine Form totalitärer Herrschaft beschreiben (Urteilskompetenz). • können in einer Diskussionsrunde begründet für oder gegen eine Mitwirkung an konkreten politischen Aktionen und Maßnahmen wie „der Jugendorganisation im NS Staat Stellung nehmen und diskursiv ihre Entscheidung vertreten (HK 7). 11 2.5 Verlaufsplanung der Unterrichtsstunde Unterrichts phase Beginn der Stunde Einstieg 12 Minuten Erarbei tung 25 Minuten Unterrichtsgeschehen Sozialform Didaktischmethodischer Kommentar /Medien LAA begrüßt die SuS. Das Begrüßungsritual signalisiert den SuS den Stundenbeginn. LAA legt die Folie mit den Werbeplakaten ohne weiteren Kommentar auf. Bildbeschreibung: SuS äußern sich zu den Bildern, Werbeplakaten. Sammeln der ersten Ideen zum Thema LAA fragt nach den Freizeitaktivitäten der SuS Plenum Der stumme Impuls soll die SuS auf das Thema der Stunde aufmerksam machen und die Motivation und Neugier wecken OHP/Bilder Aktivierung des Vorwissens Hinführung zum Thema LAA erläutert das weitere Vorgehen und gibt die Quellentexte und die Arbeitsblätter heraus. es gibt unterschiedliche Texte/Quellen; jeder SuS eine Quelle. Quellen texte Die SuS bearbeiten den Text mit Hilfe einer Tabelle mit einem vorgegeben Raster, welches besonders für schwächere SuS eine Hilfe sein wird. die SuS lesen den Text LAA fragt nach ob alle Begriffe und der Inhalt verstanden wurde die Aufgabe eins wird gemeinsam besprochen Einzelarbeit Plenum die SuS beginnen mit der Aufgabe eins SuS tragen ihre Ergebnisse in die Tabelle ein und schreiben die Erziehungsziele Hitlers auf Einzelarbeit Die Frage nach Verständnisfragen und das Besprechen der Arbeitsaufträge dient dazu, auftretende Verständnisschwierigkeiten aufzudecken und vorzubeugen. Methode: Partnerpuzzle die SuS sollen zunächst selbstständig arbeiten. LAA steht beratend zur Seite. Differenzierung: Von der LAA werden Tippkarten als Hilfestellung für die leistungsschwachen SuS zur Verfügung gestellt. LAA fragt nach dem Prinzip des Partnerpuzzles Plakat/ Plenum Plenum die Aufgabe zwei wird besprochen, LAA erklärt die Partnerbildung. SuS beginnen mit der Aufgabe zwei SuS tauschen und ergänzen sich in Partnerarbeit mündlich über ihre Ergebnisse aus und werden zu Experten SuS tauschen sich nun mit dem anderen Experten aus der anderen Gruppe aus und tragen die ihnen fehlenden Ergebnisse in die Tabelle ein. Partner arbeit Die SuS wiederholen die Phasen des Partnerpuzzles und wissen somit wie sie die Aufgabe zwei erarbeiten müssen. Die Bearbeitung in Einzelarbeit und anschließend in Partnerarbeit soll sicherstellen, dass sich jeder Schüler eigene Gedanken zu diesem Thema machen kann, bevor der kooperative Austausch über ihre Ergebnisse beginnt. LAA sreht beratend zur Seite. Sollten einige SuS schneller mit der Aufgabe fertig sein, wird die Zusatzaufgabe gemacht. Sicherung 15 Minuten Transfer 8 Minuten SuS stellen ihre Ergebnisse vor. OHP/ LAA hält die Ergebnisse der SuS auf der Folie fest. Plenum SuS korrigieren, ergänzen die Ergebnisse auf dem Arbeitsblatt. Anhand der erarbeiteten Freizeitaktivitäten der Plenum Jugendorganisationen und dem Zweck und Ziel hinter deren, vergleichen die SuS im Unterrichtsgespräch die Ziele Hitlers mit den heutigen Freizeitaktivitäten und Erziehungszielen. Puffer: Diskussionsrunde: SuS sollen sich in die Jugend der NS Zeit versetzen und begründen warum sie von der Jugendorganisation damals begeistert wären beziehungsweise nicht begeistert wären Der Vergleich mit dem Gegenwart soll den SuS verdeutlichen, dass die von Hitler angestrebte Erziehung in den Jugendorganisationen zum Ziel hatte, spätere Soldaten und Mütter zu erschaffen, um die Zukunft und die Macht Hitlers zu sichern. Sollte dies aus Zeitgründen nicht mehr in der Stunde geschehen, erarbeiten die SuS dies als Hausaufgabe. Legende: SuS Schüler und Schülerinnen; EA Einzelarbeit; PA Partnerarbeit; LAA Lehramtsanwärterin 3. Literaturangaben 3.1 Didaktik und Methodik Bergmann Klaus/ Thun, Susanne; Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus. In: Geschichte lernen Heft 24 (1991). Ludger Brüning/Tobias Saum, Methodenkoffer Kooperatives Lernen 2014. Ludger Brüning/Tobias Saum, Schüleraktivierendes Lehren und Kooperatives Lernen – ein Gesamtkonzept für guten Unterricht. In: GEW NRW (Hg.), Frischer Wind in den Köpfen. (Sonderdruck) Bochum 2011. Meyer Hilbert: Was ist guter Unterricht? Berlin 2004. Sauer, M., Geschichte unterrichten.Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. 9.Aufl. Seelze Velber: Kallmeyer 2010. 3.2 Lehrpläne Ministerium für Schule und Weiterbildung (Hrsg.), Kernlehrplan für die Gesamtschule NRW Gesellschaftslehre 3.3 Literatur zur Thematik Krentz, Natalie, Der Bund Deutscher Mädel (BDM) 2002. 3.4 Lehrwerke und Themenhefte Andreas Bremm, Bonn Myrle DziakMahler, Köln Peter Kirch et al.; Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. In: Gesellschaft bewusst, 3 (2012). Das IGLBuch: Gesellschaftslehre 3. Klett, 2011. Buch: Entdecken und Verstehen 4. Cornelsen, 2013. 3.5 Websites Deutsche Geschichten: KategorieID1003, Zugriff: 12.03.2017 Der Verlauf des zweiten Weltkrieges in wenigen Worten Zugriff: 12.03.2017 15 3.6 Bilder Hitlers Kinder: Zucht (3/5) Folie 3 Zugriff: 12.03.2017 Hitler Jugend Folie 1 und Folie 2: Zugriff: 12.03.2017 Stock Foto Tent camp of BDM, 1937 Folie 4: Zugriff: 12.03.2017 16 Anhang Folie 14 Folie 1 17 Folie 2 Folie 4 18 Folie 3 Tippkarte für Text A: Folgende Zeilen geben dir Informationen über die Aktivitäten der Jugendorganisation HJ: Zeile: 14 15f. 17 19 21f. Folgende Zeilen geben dir Informationen über die Erziehungsziele der NSDAP (Hitler): Zeile: 24 25 26 30f. 19 Tippkarte für Text B: Folgende Zeilen geben dir Informationen über die Aktivitäten der Jugendorganisation BdM: Zeile: 17 18 19f. 20 23 Folgende Zeilen geben dir Informationen über die Erziehungsziele der NSDAP (Hitler): Zeile: 29 30 31 32 20 Fülle die Tabelle aus. Bund Deutscher Mädel (BDM) Hitlerjugend (HJ) Erziehungsziele (Prinzipien von Hitler) Aktivitäten (Mitgliedschaft bei der HJ ist Pflicht (10 – 18 Jahren)) Zusammenzugehörigkeit sportlicher Körperbau gewalttätig, herrisch, unerschrocken stark (nicht schmerzempfindlich) möglichst viele Kinder gebären (Mutter/Hausfrau) (alle tragen eine Uniform) wöchentliche Heimabende gemeinsames Singen Marschieren Handarbeitskurse Nähen,Stricken, Häkeln sportliche Aktivitäten Leichtathletik gewalttätig, herrisch, unerschrocken, stark, nicht schwach und zärtlich, mutig, schön körperliche Ausbildung, sportlicher Körper Erziehung zum Parteimitglied Erziehung zum Soldat, Offizier (alle tragen eine braune Uniform) gemeinsame Fahrten besuchen an Wochenenden neue Umgebungen sammeln Holz Lagerfeuer singen gemeinsame Lieder sportliche Aktivitäten Wettkampfspielen, Schießübungen Die Gemeinsamkeiten der Erziehungsziele der BDM und HJ waren, dass die Jugend gewalttätig, herrisch und unerschrocken sein. Die Jugend soll einen sportlichen Körperbau haben und stark sein. Die Unterschiede der Erziehungsziele der BDM und HJ waren, dass die Mädchen möglichst viele Kinder gebären sollten.Die Mädchen wurden auf die Rolle der Hausfrau und Mutter vorbereitet. Die Jungen sollten entweder Parteimitglied oder Soldaten/Offiziere werden. Für ganz schnelle Paare: Erläutere die folgende Äußerung von Adolf Hitler: „Wer die Jugend besitzt, hat die Zukunft.