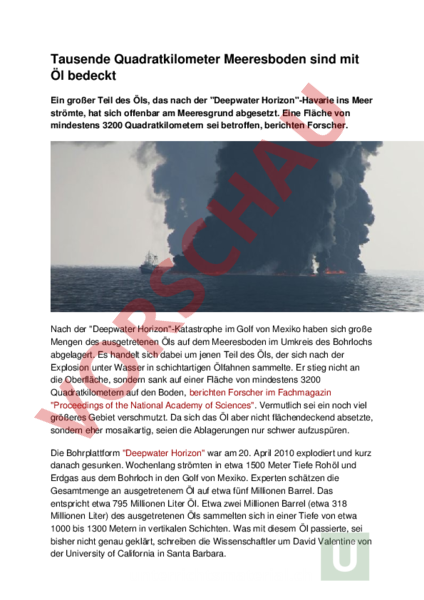Arbeitsblatt: Deep Water Horizon
Material-Details
Zeitungsartikel zur Ölkatastrophe.
Geographie
Gemischte Themen
7. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
172284
682
7
10.06.2017
Autor/in
Armaga Zürcher
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Tausende Quadratkilometer Meeresboden sind mit Öl bedeckt Ein großer Teil des Öls, das nach der Deepwater HorizonHavarie ins Meer strömte, hat sich offenbar am Meeresgrund abgesetzt. Eine Fläche von mindestens 3200 Quadratkilometern sei betroffen, berichten Forscher. Nach der Deepwater HorizonKatastrophe im Golf von Mexiko haben sich große Mengen des ausgetretenen Öls auf dem Meeresboden im Umkreis des Bohrlochs abgelagert. Es handelt sich dabei um jenen Teil des Öls, der sich nach der Explosion unter Wasser in schichtartigen Ölfahnen sammelte. Er stieg nicht an die Oberfläche, sondern sank auf einer Fläche von mindestens 3200 Quadratkilometern auf den Boden, berichten Forscher im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences. Vermutlich sei ein noch viel größeres Gebiet verschmutzt. Da sich das Öl aber nicht flächendeckend absetzte, sondern eher mosaikartig, seien die Ablagerungen nur schwer aufzuspüren. Die Bohrplattform Deepwater Horizon war am 20. April 2010 explodiert und kurz danach gesunken. Wochenlang strömten in etwa 1500 Meter Tiefe Rohöl und Erdgas aus dem Bohrloch in den Golf von Mexiko. Experten schätzen die Gesamtmenge an ausgetretenem Öl auf etwa fünf Millionen Barrel. Das entspricht etwa 795 Millionen Liter Öl. Etwa zwei Millionen Barrel (etwa 318 Millionen Liter) des ausgetretenen Öls sammelten sich in einer Tiefe von etwa 1000 bis 1300 Metern in vertikalen Schichten. Was mit diesem Öl passierte, sei bisher nicht genau geklärt, schreiben die Wissenschaftler um David Valentine von der University of California in Santa Barbara. Ölabbau geht schleppend voran Die Forscher werteten Messdaten von mehr als 3000 Sedimentproben aus, die an insgesamt 534 Entnahmestellen im Umkreis des Bohrlochs gewonnen worden waren. Sie bestimmten daraus die HopanKonzentration in den Sedimenten. Hopan ist ein Kohlenwasserstoff, der als Biomarker auf das Vorhandensein von Öl hinweist. So zeigten sie, dass Verschmutzungen westlich des Bohrlochs bis in mindestens 40 Kilometer Entfernung fleckenartig auftreten. Golf von Mexiko: Die MegaÖlpest der USA Anhand der Menge, der räumlichen Verteilung sowie weiterer chemischer und ozeangrafischer Betrachtungen kommen die Forscher zu dem Schluss, dass das Öl auf den Sedimenten vor allem aus den vertikalen Ölfahnen stammt, die sich unter Wasser gebildet haben. Vermutlich sei nur ein kleinerer Teil von der Wasseroberfläche herabgesunken. Die Wissenschaftler spekulieren, dass Biomasse, die sich bei Algenblüten gebildete hat, wie ein Fällmittel gewirkt und die Ölpartikel an den Meeresboden transportiert habe. An einigen Stellen sprießen neue Pflanzen Wenn sich Öl auf den Sedimenten ablagert, stirbt das Leben am Meeresboden auf sehr lange Zeit ab, erläutert Jörg Feddern, Ölexperte bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Ein mikrobieller Abbau des Öls finde kaum statt, weil unter den Teermatten weder Sauerstoff noch Nährstoffe für die Bakterien vorhanden seien. Die ökologischen Folgen für die Region seien auch vier Jahre nach dem Unglück kaum abzuschätzen. Im Mai 2014 hatte eine Studie ergeben, dass Bakterien, entgegen der Hoffnung vieler Fachleute, das ausgetretene Öl nur unzureichend gefressen hatten. Eine weitere Untersuchung vom Juli 2014 hat gezeigt, dass die Ölpest nach dem Unglück auch viele Korallen geschädigt hat. Demnach setzten Ölpartikel oder die zu deren Zersetzung verwendeten Chemikalien Tiefseekorallen noch in einer Entfernung von 22 Kilometern zu. Die Pflanzen an dem betroffenen 75 Kilometer langen Küstenstück des USStaats Louisiana erholten sich dagegen vergleichsweise rasch. Zunächst hatte das ausgeströmte Öl zahlreiche von ihnen absterben lassen, wodurch auch die Küstenlinie zum Teil erodierte. Betroffen war Marschland, wo salztolerante Pflanzen bis an die Wasserlinie heranreichen. Eine Bestandsaufnahme im Januar 2012 zeigte, dass sich einige Bereiche ganz erholt hatten, die Pflanzenbedeckung also komplett zurückgekehrt war. Dies ging auf das Aussprießen von Seitentrieben zurück. Wo die Erosion infolge des Ölunfalls schon zugeschlagen hatte, wuchs allerdings nichts mehr. Deepwater Horizon FOCUSOnlineAutorin Lara Schwenner Mittwoch, 22.04.2015 Zwei Tage nach der Explosion versank die BPÖlplattform Deepwater Horizon am 22. April 2010 im Golf von Mexiko. Tote Meerestiere und ein botanisch ausgelöschter Küstenstreifen waren die Folgen der Ölpest. Die Natur hat sich fünf Jahre später augenscheinlich erholt. Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt. Am. 22. April 2010 sank die BPÖlplattform Deepwater Horizon. 780 Millionen Liter Öl liefen ins Meer. Eine Million Liter Chemikalien wurden zur Bekämpfung des Ölteppichs eingesetzt. Rückblickend ergriffen die Verantwortlichen die falsche Maßnahme. Ein Ölteppich, flächenmäßig etwa viermal so groß wie Deutschlands Nachbarland Luxemburg, war die Folge der bis heute schlimmsten Ölpest aller Zeiten. Am 20. April 2010 war die BPÖlplattform „Deepwater Horizon explodiert und zwei Tage später gesunken, weil Erdgas aus dem Bohrloch im Golf von Mexiko strömte. Elf Arbeiter ließen bei dem Unglück ihr Leben. Doch mindestens genauso folgenschwer waren die Auswirkungen auf die Natur: Bis zur provisorischen Abdichtung des Bohrlochs im Juli 2010 strömten monatelang aus mehreren Lecks etwa 780 Millionen Liter Öl ins Meer so viel wie bei keiner anderen Ölpest in der Geschichte. Zum Vergleich: Bei der Havarie des Tankers „Exxon Valdez 1989 strömten vor der Küste Alaskas „nur etwa 41 Millionen Liter Öl ins Meer. Verklebtes Gefieder, verstopfte Poren Schon wenige Tage nach der Katastrophe hatte sich der Ölteppich auf der Wasseroberfläche auf eine Größe von etwa 10.000 Quadratkilometern ausgedehnt. Seevögel, Meeressäugetiere und Schildkröten kamen durch den klebrigen Ölfilm um und auch die Küsten der Umgebung wurden großflächig verschmutzt. Viele Pflanzen an dem betroffenen 75 Kilometer langen Küstenabschnitt des US Bundestaats Lousiana starben durch das Öl massenhaft ab. Die Küstenlinie war in den Monaten nach der Katastrophe wie ausgelöscht. Fischfangverbot an der Küste Floridas In den Bundesstaaten Louisiana, Florida, Mississippi und Alabama mussten die Behörden kurzerhand der Notstand ausrufen. Anfang Juli 2010 erreichte das Öl schließlich sogar die Küste von Texas. Etwa zur selben Zeit verhängte die US amerikanische Wetterbehörde NOAA im Bereich der MississippiMündung und der Küste Floridas ein Fischfangverbot. Das Ausmaß der Ölpest schien unermesslich. Doch schon wenige Jahre nach der Umweltkatastrophe schien sich am Golf von Mexiko der Ursprungszustand wieder einzustellen: Viele Pflanzenbestände konnten sich erholen, Fischer fingen wieder genießbaren Fisch und Touristen kehrten zurück an die Strände der zuvor mit Öl verschmutzten Regionen. Gegenmaßnahmen mit Risikopotential An den Küsten und auf der Meeresoberfläche ist von dem ausgelaufenen Öl nichts mehr zu sehen – verschwunden ist es allerdings nicht. Bis zum 5. Mai 2010 hat BP rund eine Million Liter Chemikalien eingesetzt, um den Ölteppich aufzulösen. Das toxische Gemisch mit dem Namen „Corexit 9500 sollte das Öl dispergieren, also fein unter die Wassermassen der Tiefsee verteilen, damit die Wellen es nicht länger an Land schwemmen und weitere Vegetation zerstören oder Vogelgefieder verkleben. Falsche Maßnahme getroffen Rückblickend war das die falsche Maßahme, wie sich vier Jahre später herausstellte. Im Oktober 2014 haben Forscher der University of California und des Woos Hole Oceanographic Instituts in einer Studie publiziert, dass sich ein großer Teil des Öls in einer Fläche von mindestens 3200 Quadratkilometern im Umkreis des Bohrlochs am Meeresboden abgesetzt hat. Leben am Meeresboden kann für lange Zeit absterben Dort ist das Öl, wenn auch in mikroskopisch kleinen Tropfen, nicht besser aufgehoben. Wenn es sich auf den Sedimentschichten ablagert und auf diese Weise in die marine Nahrungskette eindringt, kann das Leben am Meeresboden für lange Zeit absterben. Selbst die Bakterien, die sich nach der Katastrophe rasend schnell vermehrt und große Teile des Öls abgebaut hatten, können den Auswirkungen des Öls langfristig nicht rasch genug entgegenwirken. Eine Studie der University of Georgia konnte zeigen, dass die Bakterien das Öl in der Tiefsee zu langsam abbauen.